Gelesen: Wächter des Kristariums

 Nachdem im letzten Heft der faszinierende Planet Fal eingeführt wurde, wird die Faszination hier beinahe kaputt gemacht. Der Roman ist zwar spannend, doch die Spannung kommt ausschließlich von Ballerorgien. Das ist auf Dauer ermüden und alles andere als interessant.
Nachdem im letzten Heft der faszinierende Planet Fal eingeführt wurde, wird die Faszination hier beinahe kaputt gemacht. Der Roman ist zwar spannend, doch die Spannung kommt ausschließlich von Ballerorgien. Das ist auf Dauer ermüden und alles andere als interessant.Wie sich der gesamte Roman liest, erfährt man wie immer auf sf-radio:
Sternenfaust Band 144 - Wächter des Kristariums
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Die verblödete Republik (Thomas Wiezcorek)
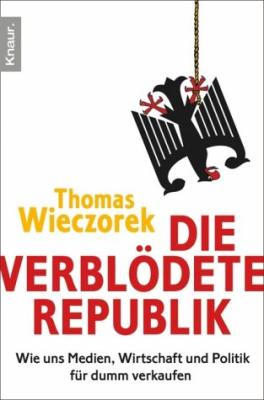 Wer erinnert sich noch an den Wahlkampf 2006 als Alice Schwarzer Angela Merkel nur unterstützte, weil sie eine Frau ist?
Wer erinnert sich noch an den Wahlkampf 2006 als Alice Schwarzer Angela Merkel nur unterstützte, weil sie eine Frau ist?Oder wer erinnert sich noch an den April 2005 als Kurt Beck SPD-Vorsitzender wurde?
Niemand?
Sind wir eine verblödete Republik?
Nein, denn diese beiden Ereignisse geschahen gar nicht zu dem Zeitpunkt!
Der Wahlkampf war 2005 und Kurt Beck wurde erst im April 2006 SPD-Vorsitzender.
Ist es nicht ein wenig peinlich, wenn solche Fehler in einem Buch mit dem Titel „Die verblödete Republik“ stecken?
Ja, und das Buch ist insgesamt ein wenig peinlich.
Thomas Wieczorek nimmt sich über 300 Seiten lang Platz um Medienschelte vor zu nehmen. Danach ist klar: Der deutsche Bundesbürger wird eigentlich konsequent hinters Licht geführt. Über all finden sich Lobbyisten und INSM-Vertreter, die unser Mediensystem zersetzen. Dabei führt Wieczorek auch immer Ungrechtigkeiten unseres demokratischen Systems aufs Korn.
Dabei hat er mit fast allem Recht. Jede Ungerechtigkeit, die er beschreibt, ist seit Jahren bekannt, getan wird nichts. Und wer täglich SpiegelOnline, Stern.de oder andere Internetseiten liest, dem ist klar, dass es längst keine unabhängige Berichterstattung mehr gibt, sondern dass fast alles nur noch Meinungsmache ist.
Aber Wieczorek hat einen furchtbaren Hass darauf. Den kann man haben, aber man muss ihn irgendwie unterdrücken können, wenn man ein Buch schreiben möchte. Denn „Die verblödete Republik“ ist so ironisch, verbissen und polemisch, dass sie die Qualität dessen erreicht, was sie kritisiert.
Zumal Wieczorek auch nur meckert. Es gibt keine positiven Punkte. Selbst die Linkspartei, die doch eigentlich die Ungerechtigkeiten, die er anprangert bekämpfen möchte, stellt er in ein neoliberales Licht. Damit mag er durchaus recht haben, denn überall dort wo diese Partei regiert (Berlin!) fällt sie in den selben Trott wie die anderen Parteien. Aber muss ein Buch, dass alles kritisiert, nicht zumindest ein paar Wege aufzeigen, wie es anders laufen könnte?
Wieczorek ist für mehr Volksentscheide. Er findet, die Bevölkerung müsse häufiger befragt werden. Aber wenn die Bevölkerung nicht unabhängig informiert wird, wenn ihre Meinung durch abhängige, durch Lobbyisten zersetzte Medien gebildet wird, sind Volksentscheide dann nicht ein Weg den Lobbyisten Tor und Tür zu öffnen?
„Die verblödete Republik“ ist ein Pamphlet mit Fehlern, in dem gemeckert wird, aber keine einzige Lösung angeführt wird. Obwohl er mit vielen Punkten recht hat, ist das schwach, denn der beißende Stil macht vieles kaputt und meckern kann jeder, verändern ist viel schwieriger.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gesehen: Carpenter Street (Enterprise Folge 63)
Inhalt: Daniels kehrt auf die Enterprise zurück. Er kann nichts Neues über die Xindi-Waffe erzählen. Doch dafür weist er Archer daraufhin, dass drei Xindi in das Jahr 2004 gereist sind. Archer und T'Pol reisen in die Zeit, um herauszufinden, was die Xindi tun...
Kritik: Es ist wirklich beeindruckend, wie schnell Enterprise den Xindi-Storybogen vorantreibt. Die Biowaffe, die erst vor wenigen Folge bekannt gegeben wurde, ist jetzt schon wieder vom Tisch.
Allerdings ist es sehr merkwürdig, dass Daniels keine Ahnung von den Xindi haben soll. Im Rahmen des Temporalen Kalten Krieges sollte es für ihn durchaus möglich sein, diese Information zu sammeln. Immerhin ist ihm ja auch aufgefallen, dass sich die Mission der Enterprise verändert hat. Aber das ist wohl eine der großen Logiklücken, die automatisch mit einem Temporalen Kalten Krieg daherkommen.
Die Episode selbst ist solide und teilweise äußerst spannend inszeniert. In dem Menschen, der den Xindi hilft, hat man wirklich all das schlechte gesammelt, was ein Mensch unserer Zeit so bieten kann.Er ist gerade deswegen so skrupellos, weil es ihm gelingt, bei allem ein gutes Gewissen zu erzeugen.
Zum Schluss ist es fast schon enttäuschend einfach, wie die Auslösung der Waffe dann doch verhindert wird.
Mit dieser Folge sollte T'Pol nun endlich von Zeitreisen überzeugt sein. Leider gibt es dazu kein weiteres Gespräch. Denn die Episode endet eigentlich nur damit, dass Archer und T'Pol zurückkehren und Trip überraschend. Dabei kommt heraus, dass Archer und T'Pol nur wenige Sekunden weg waren. Da stellt sich dann die Frage, warum am Anfang der Episode auf einmal Eile geboten war. T'Pol hat nämlich recht, wenn sie anmerkt, dass man mit Zeitreisen doch eigentlich alle „Zeit“ der Welt hat. Auch wieder so eine Logiklücke.
Insgesamt ist „Carpenter Street“ gut und solide. Wie die vorherige Episode unterhält sie sehr gut, schwächelt aber an der Story. Jetzt müssen nur noch die Logiklöcher gestopft werden, dann ist Enterprise auf einem sehr guten Kurs. 3,5 von 5 Punkten.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Lord Of The Flies (von William Golding)
 Eine Gruppe sechs bis zwölf jähriger Kinder stürzt mit einem Flugzeug ab. Die Kinder können sich auf eine Insel retten, kein Erwachsener überlebt. Schnell organisieren sich die Kinder und wählen einen von ihnen, Ralph, zu ihrem Anführer. Es muss ein Feuer aufrecht erhalten werden, damit Schiffe sie sehen können, es müssen Unterkünfte gebaut werden und es muss gejagt werden.
Eine Gruppe sechs bis zwölf jähriger Kinder stürzt mit einem Flugzeug ab. Die Kinder können sich auf eine Insel retten, kein Erwachsener überlebt. Schnell organisieren sich die Kinder und wählen einen von ihnen, Ralph, zu ihrem Anführer. Es muss ein Feuer aufrecht erhalten werden, damit Schiffe sie sehen können, es müssen Unterkünfte gebaut werden und es muss gejagt werden.Die Ordnung zerbricht rasch, die Regeln werden immer seltener befolgt und der Anführer der Jäger, Jack, hat Probleme damit, sich ph unterzuordnen...
Man merkt schnell wie die „Zivilisation“ der Kinder immer mehr auseinanderfällt. Durch die Furcht vor einer vermeintlichen Bestie werden die kleinen Kinder immer ängstlicher. Werte wie Mut und Stärke gewinnen immer mehr an Gewicht. Schwächere Kinder, wie der dicke Junge, der immer nur „Piggy“ genannt wird, verlieren mehr und mehr an Einfluß. Zum Schluss wird der einzige Überlebende der „rationalen“ Fraktion, Ralph, wie ein Schwein über die Insel gejagt und soll getötet werden. Just in dem Moment als die Jäger in finden, kommt die Rettung der britischen Flotte.
Das Ende wirkt daher ein wenig konstruiert. Bis dahin gibt es auch einige Passagen, die etwas langatmig erscheinen.
Die meiste Zeit über ist die Lektüre aber relativ spannend. Zunächst, weil nicht geklärt ist, ob es wirklich gefährliche Tiere auf der Insel gibt. Später, weil klar ist, dass der Zusammenhalt der Gruppe nicht lange hält. Zum Schluss, weil es ungewiss ist, was für eine Lösung es für die vertrackte Situation gibt.
Es sterben drei Kinder in dem Roman.
Der erste ist ein kleiner Junge, der gleich zu Beginn von einem Feuer, dass die Gruppe im Übermut entfacht hat, verzehrt wird. Seinen Tod bekommt niemand mit und die Existenz dieses Jungen, der zum ersten Mal das „Biest“ ins Spiel bringt, wird geleugnet.
Der zweite Tote ist ein älterer Junge, der viel in der Natur wandert. In einem rituellen Tanz, den die Jäger aufführen, rennt er hinein und schreit, er habe die Bestie gesehen. Daraufhin halten die Kinder ihn in Trance für die Bestie und schlachten ihn ab. Auch dieses Ereignis wird im Nachhinein geleugnet, diejenigen die den Tod erkannt haben, weisen die Schuld dem Jungen zu.
Der dritte Tod ist offensichtlich. Piggy wird von einem Felsen erschlagen, den ein andere Junge auf ihn wirft. Ab da ist unverkennbar, dass sich die Kinder endgültig zu „wilden“ entwickelt haben und dass Vernunft kaum noch eine Rolle spielt. Das einzige was in der Gesellschaft zählt ist das Recht des Stärkeren.
Interessant ist, dass sich für den Tod des Jungen kaum jemand der „Jäger“ interessiert. Der Tod und das Morden ist da schon so normal geworden, dass es für die Jungen scheinbar keinen Unterschied macht, ob ein Schwein oder ein Mensch getötet wird. Zumal der Mensch, der gestorben ist, dick war und aufgrund seines Asthmas kaum etwas zur Gesellschaft beitragen konnte.
Golding soll seinen Roman einmal selbst als Fabel beschrieben haben. Es sprechen hier zwar keine Tiere, aber es ist gut möglich, dass er tatsächlich Fabel-Elemente hat. Das würde bedeuten, dass Menschen sich in so einer Situation höchstwahrscheinlich so verhalten wie die Kinder in dem Roman. Das ist durchaus glaubwürdig. Denn könnte unsere Demokratie funktionieren, wenn bei uns so viel Elend herrschen würde wie in einem afrikanischen Entwicklungsland?
Vielleicht, vielleicht aber auch nicht.
Bei Golding siegt das „vielleicht aber auch nicht“.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Loodon

 Die Sternenfaust erreicht den Planeten Fal. Dort wollen sie den gefunden, 40 000 Jahre alten Außerirdischen Yaag nach Hause bringen und mehr über die mysteriösen Quallen herausfinden. Aber im Orbit löst sich das Shuttle auf...
Die Sternenfaust erreicht den Planeten Fal. Dort wollen sie den gefunden, 40 000 Jahre alten Außerirdischen Yaag nach Hause bringen und mehr über die mysteriösen Quallen herausfinden. Aber im Orbit löst sich das Shuttle auf..."Loodon" ist eine ungewöhnliche aber intensive "Sternenfaust"-Folge. Endlich wird wieder einmal eine fremdartige Welt beschrieben, die leider in einigen Punkten doch wieder einer vergangenen Welt auf der Erde ähnelt.
Wie sich der Roman liest, erfährt man wie immer auf sf-radio.de:
Sternenfaust Band 143 - Loodon (von Volker Ferkau)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Der Abgrund (von David Weddle & Jeffrey Lang)

 "Der Abgrund" ist sowohl ein Einzelroman als auch der dritte Teil der achten "Deep Space Nine"-Staffel. Der Roman war auch Teil der "Sektion 31"-Miniserie, die eigentlich nur aus Einzelromanen bestand.
"Der Abgrund" ist sowohl ein Einzelroman als auch der dritte Teil der achten "Deep Space Nine"-Staffel. Der Roman war auch Teil der "Sektion 31"-Miniserie, die eigentlich nur aus Einzelromanen bestand. Dr. Bashir kommt mal wieder in Kontakt mit Sektion 31 und muss sich auf den Weg in die Badlands machen. Dort hat ein ebenfalls genetisch optimierter Arzt eine Produktionsanlage des Dominions unter seine Kontrolle gebracht und produziert Jem'hadar. Mit diesen möchte er sich zu einem gerechten Herrscher über den Alpha-Quadranten aufschwingen.
Wie sich das liest, kann man auf trekzone nachlesen. Meine Rezension ist die dritte:
Der Abgrund
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Unspoken Truth (von Margaret Wander Bonanno)

 "Unspoken Truth" konzentriert sich auf die Halbvulkanierin Saavik. Das Buch erzählt ihre Erlebnisse zwischen dem dritte und dem vierten "Star Trek"-Kinofilm. Dabei arbeitet die Autorin vor allem mit wilden Zeitwechseln und Rückblenden, durch die einen Saaviks Leben näher gebracht werden soll.
"Unspoken Truth" konzentriert sich auf die Halbvulkanierin Saavik. Das Buch erzählt ihre Erlebnisse zwischen dem dritte und dem vierten "Star Trek"-Kinofilm. Dabei arbeitet die Autorin vor allem mit wilden Zeitwechseln und Rückblenden, durch die einen Saaviks Leben näher gebracht werden soll.Leider schaft das keine Spannung sondern höchstens Verwirrung. Gepaart mit einer netten Liebesgeschichte und einer dämlichen Agentenstory ist das Buch leider kein Höhenflug.
Die gesamte Rezension kann man bei trekzone lesen:
Star Trek - Unspoken Truth
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Das Sakrament (von Tim Willocks)
 Das Osmanische Reich ist 1565 am Punkt der größten Ausdehnung angekommen. Eine Flotte mit über 40 000 Soldaten steuert auf Malta zu. Fällt die Insel, ist die ganze Südküste Europas verwundbar. Auf Malta verharrt nur noch der Malteserorden, ein kriegerischer katholischer Orden. Insgesamt hat der Orden etwa 15 000 Leute aufzubieten - viel zu wenig. Der Orden wurde vor der Invasion durch Matthias Tannhäuser gewarnt, einem Deutschen der als kleines Kind von den Türken entführt wurde und jahrelang in deren Reihen gekämpft hat. Der Großmeister des Ordens möchte, dass sich Tannhäuser den Verteidigern anschließt. Er setzt dafür eine Frau mit einem merkwürdigen Wunsch ein...
Das Osmanische Reich ist 1565 am Punkt der größten Ausdehnung angekommen. Eine Flotte mit über 40 000 Soldaten steuert auf Malta zu. Fällt die Insel, ist die ganze Südküste Europas verwundbar. Auf Malta verharrt nur noch der Malteserorden, ein kriegerischer katholischer Orden. Insgesamt hat der Orden etwa 15 000 Leute aufzubieten - viel zu wenig. Der Orden wurde vor der Invasion durch Matthias Tannhäuser gewarnt, einem Deutschen der als kleines Kind von den Türken entführt wurde und jahrelang in deren Reihen gekämpft hat. Der Großmeister des Ordens möchte, dass sich Tannhäuser den Verteidigern anschließt. Er setzt dafür eine Frau mit einem merkwürdigen Wunsch ein...Willocks Roman besticht mit seinen ungewöhnlichen Hauptfiguren. Im Gegensatz zu den spannenden und gelungen historischen Romanen von Rebecca Gablé ist die Hauptfigur alles andere als ein Held. Stattdessen wird sie von eher niederträchtigen Motiven geleitet: Geldgier und Triebe. Das ist zunächst einmal positiv. Im Laufe des Romans gerät dies jedoch zur Schwäche. Denn Willocks beschreibt die Taten Tannhäusers absolut unkritisch, obwohl dessen Taten durchaus zur Kritik nötigen. Man könnte noch argumentieren, dass die Grausamkeit, die Tannhäuser erfährt und vor allem ausübt, besonders realistisch für die Zeit ist. Allerdings muss man in dem Fall sagen, dass sich Tannhäuser aus vielen Situationen retten kann, in denen er außerhalb der literarischen Welt garantiert den Tod gefunden hätte.
Tod ist sowieso zu Überfluss in dem Roman vorhanden. Knappe 150 Seiten dauert es, bis die Türken Malta erreichen. Danach geht das Gemetzel los. Am Ende kann sich der Leser nicht mehr erinnern, wie viele Schlachten Willocks beschrieben hat. Mit Glück fallen einem noch die Namen der Gefallenen Bastionen ein (St. Elmo und dann?).
Tannhäuser wird von einer Edeldame nach Malte gelockt, die dort ihren unehelichen Sohn sucht. Unglücklicherweise ist der Vater des Kindes ein hohes Tier in dem heiligen Orden der Inquisition. Und so wird schnell Tannhäusers bisheriges Händlerleben zerstört, sodass er eigentlich keine Wahl hat als nach Malta zu gehen. Die Suche nach dem Sohn, die Liebschaft zu der Dame und deren Freundin sowie die Intrigen der Inquisition bilden dann auch die Geschichte, die es neben dem Gemetzel tatsächlich noch gibt.
Auch hier zeigt Willocks, dass er sich durchaus etwas gedacht hat. Alle Institutionen sind sauber recherchiert, die Charaktere wirken meist glaubwüridg.
Dennoch kommt kaum Spannung auf. Zwar ist der Ausgang des Romans nicht vorhersehbar, aber jedes Ereignis ist es. Wenn man liest, kann man immer erahnen, was als nächstes geschieht. Mal weiß man bereits was die Inquisition plant, bevor Tannhäsuer es erfährt, mal liegt es einfach auf der Hand, was als nächstes passieren wird. Das macht gerade ein mehr als 700 seitigen Roman recht langwierig.
Erst zum Schluss als die größte Intrige des Inquisitors offenbahrt wird, entsteht so etwas wie Spannung. Willocks "entsorgt" im folgenden fast alle Nebencharaktere. Das geschieht mit entsetzlich wenig Gefühl. Auf wenigen Seiten werden Freunde und Feinde, die bisher die blutigsten Gefechte überstanden habe, vernichtet. Während Willocks zwar zugibt, dass der Tod der Freunde, Tannhäuser und der Dama Carla zu schaffen machen, berührt das den Leser kaum. Stattdessen ist man verblüfft, wie wenig solche Grausamkeiten berühren. Vielleicht waren die vorherigen Schlachten einfach zu viel.
Völlig unsinnig ist dann die Kehrtwende des Inquisitors, der für die Entstehung von Carlas Sohn verantwortlich ist. Er ist das Böse in Person und auch noch davon überzeugt, dass er für das gute kämpft. Als Tannhäuser ihn aber zum Schluss (durch extrem viel Glück) besiegt und er im Sterben liegt, zeigt er Tannhäuser, dass er sich gebessert hat. Kurz vor seinem Tod erkennt er, der Schlächter im Namen Gottes, seine Fehler. Kitschiger geht es eigentlich nicht. Zumal die Kehrtwende "nur" durch den Anblick seines Sohnes ausgelöst wurde. Für jemanden, der bis dahin das Böse in Person war, ist das ganz schön wenig.
Man muss Willocks zu Gute halten, dass er eine interessante Zeit herausgepickt hat und dass er den sinnlosen Fanatismus auf beiden Seiten sehr gut darstellt. Nach dem Buch hat man, gerade weil alle dem Krieg so unkritisch gegenüberstehen, die Nase voll davon. Ob das für einen guten Roman ausreicht, sei dahingestellt.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Die Mittagsfrau (von Julia Franck)
 Der sieben-jährige Peter wird kurz nach dem zweiten Weltkrieg von seiner Mutter auf dem Weg nach Westen an einem Bahnhof stehen gelassen. Nach dem Prolog setzt die Geschichte kurz vor dem ersten Weltkrieg ein. Die beiden Halbjüdinnen Helene und Martha verabschieden ihren Vater in den Krieg und sind nun mit ihrer komplizierten Mutter allein...
Der sieben-jährige Peter wird kurz nach dem zweiten Weltkrieg von seiner Mutter auf dem Weg nach Westen an einem Bahnhof stehen gelassen. Nach dem Prolog setzt die Geschichte kurz vor dem ersten Weltkrieg ein. Die beiden Halbjüdinnen Helene und Martha verabschieden ihren Vater in den Krieg und sind nun mit ihrer komplizierten Mutter allein...Helene erlebt im weiteren Verlauf einsame und arme Jahre in Bautzen. Danach zieht sie mit ihrer Schwester nach Berlin um, wo sie eine glückliche Beziehung führt. Als ihr Partner bei einem Unfall stirbt, wird sie von einem Ingenieur umworben. Der überzeugte Nazi besorgt ihr neue Papiere, doch die Ehe scheitert. Sie nennt sich ab da an Alice und kümmert sich um ihren Sohn.
Das Buch zeichnet also eine bewegte Familiengeschichte nach, die durch zwei Kriege beeinflusst ist. Dabei ist das Verhältnis zwischen Müttern und Kindern in dem Buch nie wirklich intakt. Helene kann keine Beziehung zu ihrer Mutter aufbauen, wird von dieser nie wirklich geliebt. Die Passagen, die ihre Sicht auf Peter beschreiben, sind ähnlich distanziert. Sie sorgt dafür, dass er durchkommt, kann ihm aber auch nicht viel mehr bieten. Ihr fehlt schlicht die Kraft, seinem Bedürfnis nach Liebe nachzukommen.
Helene wird einem im Verlauf des Romans durchaus sympatisch. Umso gelungener ist es, dass Prolog und Epilog aus der Sicht Peters geschrieben sind. Dadurch bekommt man einen anderen Blick auf die Hauptperson des Romans.
Allerdings wirkt einiges arg konstruiert. Die vielen jüdischen Beziehungen, der stereotype Arier-Ingenieur, das sind beinahe ein paar Zufälle zu viel.
Dafür sind die Abschnitte gelungen, in denen Helene noch Träume hat und die auch realisierbar erscheinen. Immer wieder ist das Studium in Reichweite. Aber immer wieder verhindert ein Zwischenfall dies.
Franck schreibt zwar bildhaft, aber in einigen Teilen auch langatmig. Es gelingt in dem Buch zwar Sympatien für Helene aufzubauen, Spannung kommt aber kaum auf. Zurück bleibt eine Familientragödie, die in erster Linie durch die Zeit zustande kam. Mangelnde Kommunikation trägt allerdings auch ihren Teil dazu bei. Für diese Tragödie vierhundert Seiten zu lesen, kann teilweise recht hart sein.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Atemschaukel (von Hertha Müller)
 Der Roman "Atemschaukel" erzählt von der fünfjährigen Lagerzeit des Ich-Erzählers Leopold Auberg. Er ist ein Deutscher, der in Rumänien lebt und nach dem zweiten Weltkrieg von den Russen deportiert wird.
Der Roman "Atemschaukel" erzählt von der fünfjährigen Lagerzeit des Ich-Erzählers Leopold Auberg. Er ist ein Deutscher, der in Rumänien lebt und nach dem zweiten Weltkrieg von den Russen deportiert wird.Das kommt ihm zunächst beinahe gelegen, denn er muss als homosexueller ein Leben im Geheimen leben. Daher geht er gerade zu heiter seinem Lagerleben entgegen.
Die fünf folgenden Jahre sind jedoch unglaublich hart.
Die Kapitel des Buches sind sehr kurz gehalten. Jedes einzelne zeichnet ein Bild des Lageralltags. Das reicht vom "Meldekraut" über "Von den Langweilen" bis zu "Vom Lagerglück". Dabei umgibt Auberg, der mit gerade einmal 17 Jahren verhaftet wurde, ständig der Tod. Lediglich die Worte "Ich weiß, Du kommst wieder" seiner Großmutter erinnern ihn an zuhause.
Der Roman versucht nicht Spannung aufzubauen. Von vornherein erzählt der Ich-Erzähler, dass die Lagerzeit fünf Jahre dauert und dass er die Lagerzeit lebendig übersteht. Stattdessen werden - wie schon erwähnt - pro Kapitel Bilder und kleine Geschichten erzählt, die meist die Probleme des Lagerleben aufzeigen.
Merkwürdigerweise wird die Lektüre mit der Zeit immer erträglicher. Je mehr sich Auberg im Lager eingerichtet hat, normale Abläufe pflegt desto "normaler" erscheinen die Beschreibungen. Natürlich sind Hunger und Tod auch dann noch allgegenwärtig. Aber dadurch dass Auberg dies als Noramlität empfindet, färbt das irgendwie auch auf den Leser ab.
Es werden immer wieder auch merkwürdige Träume Aubergs erzählt, die etwas mit seinem Hunger zu tun haben. Er redet immer nur von dem "Hungerengel", den es auszutricksen gilt. Diese - selbst aufgebaute - Parallelwelt bleibt bis zum Schluss eigentlich unfassbar, ist aber wohl der einzige Weg für Lagerinsassen, den Wahnsinn zu überleben.
"Atemschaukel" liest sich nicht unbedingt leicht. Einige Kapitel, die nur beschreiben, langweilen gar ein wenig. Aber es gibt auch immer wieder verstörende oder erhellende Einblicke. Dabei stechen gerade die Beschreibungen der anderen Lagerinsassen und die Bewertung durch Auberg hervor.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
... ältere Einträge
