Sebastián und Costa drehen einen Film über einen Chrstioph Kolumbus, in dem sie sich mit den negativen Folgen der spanischen Kolonisierung und des europäischen Goldrausches auseinandersetzen. Die Spanier drehen in Bolivien, da es dort am günstigsten ist.
Bereits das geplante offene Castin gerät aus dem Ruder, zu viele Bewerber tauchen auf. Dennoch werden alle überprüft, der Film nimmt Fahrt auf. Besonders Sebastián ist von der Wirkung des Films sehr überzeugt, der der ganzen Welt vor Augen führen soll, wie schlecht die Europäer die Indios behandelt haben.
Was dem europäischen Team dabei zunächst gar nicht auffällt: Sie nutzen selbst Indios aus. Und sie verschließen die Augen vor dem Leid der Indios, deren Wasserpreise gerade aufgrund einer Privatisierung um 300 Prozent gestiegen sind. Ein gewalttätiger Konflikt bahnt sich an.
Der Film stellt die Doppelmoral mit der zum Beispiel Westeuropäer oft an ihr koloniales Erbe herangehen, wunderbar dar. Natürlich weiß man über das Unrecht, dass man angerichtet hat, Bescheid. Dennoch gelingt es häufig, die noch immer herrschenden, ungerechten Verhältnisse auszublenden.
Der idealistische Regisseur Sebastián scheint zunächst am ehesten für die Probleme der Indios offen zu sein. Sein Produzent Costas hält ihn regelmäßig zurück, damit der Film reibungslos produziert werden kann. Am offensten tritt die Scheinheiligkeit Costas zutage, als er einen Indio-Darsteller, Daniel, überreden möchte, die Demonstrationen gegen die gestiegenen Wasserpreise zu verlassen. Costas befürchtet, seinem wichtigsten Indio-Darsteller könnte etwas geschehen und das wiederum würde die Dreharbeiten aufhalten. Während des Gesprächs wird er von seinen englischsprachigen Investoren angerufen. Da er Indios pauschal für ungebildet hat, besitzt er keine Hemmungen direkt vor Daniel darüber zu sprechen, dass die Indio sich mit „nur“ zwei Dollars am Tag für „fucking gods“ halten. Blöd nur, dass Daniel mehrere Jahre in den Vereinigten Staaten gearbeitet hat.
Dies ist die vielleicht beste Szene des Films, da sie auf witzige und gleichzeitig erschütternde Art zeigt, mit welcher Geringschätzung die Indios in einer Produktion behandelt werden, die sich doch gegen deren Ausbeutung aussprechen soll. Dem Film gelingt auch im weiteren Verlauf die Gratwanderung zwischen witzig-erschreckend und verharmlosend-übertrieben.
Der Wasserkrieg gerät immer weiter außer Kontrolle und die Spanier geraten selbst immer mehr in Gefahr. Es ist sehr überzeugend, dass ausgerechnet die Schauspieler, die sich zuvor lautstark für das Wohl der Indios eingesetzt haben, die ersten sind, die das Land verlassen wollen. Ausgerechnet der Zyniker aus der Truppe spricht sich dafür aus, zu bleiben, um den Film fertig zu drehen.
Die Vorgehensweise des bolivischen Staates gegen die Demonstranten und vor allem die Rechtfertigung der Gewalt wirken zynisch. Die Indios sind jarhhundertelang ausgebeutet worden, daher seien sie nun so von Misstrauen erfüllt, dass sie Wohltaten (eine 300 prozentige Wasserpreiserhöhung!) nicht mehr erkennen können. Das ist so eine dämliche Begründung, dass man unfreiwillig lachen muss. Das Lachen bleibt selbstverständlich im Halse stecken, wenn man bedenkt, dass der Kampf um die Privatisierung der Wasseranlagen in Bolivien tatsächlich ausgefochten wurde – mit den im Film gelieferten Begründungen.
Natürlich lebt der Film zusätzlich von den vielen Gegensätzen die sich auf tun. Die Demonstranten auf der einen, die Regierungsbeamten auf der anderen Seite. Die bolivischen Statisten auf der einen, die spanischen Schauspieler auf der anderen Seite. Der Film zeigt immer beide Lebenswelten, bei der eine Seite keine Ahnung hat, wie es in der anderen wirklich aussieht.
Der einzige weniger überzeugende Punkt an dem Film ist, dass dem knallharten Costas das Schicksal der Indios plötzlich nicht mehr egal ist und er das Leben eines kleinen Mädchen über dass des Films stellt. Das ist natürlich richtig. Und es sorgt für ein gelungenes Finale. Aber es geht halt doch etwas zu schnell, dass der „harte“ Costas, der zuvor kein Problem damit hatte, Daniel nur temporär von der Polizei auszuleihen, anstatt auf seine dauerhafte Freilassung zu drängen, sich ändert. Dem wird immerhin ein Sebastián entgegengesetzt, der in all dem Elend und vor allem nach der gerade erwähnten Entscheidung, sich Daniel von der Polizei „auszuborgen“, seinen Idealismus verloren hat.
„Even the Rain“ ist ein berührender, dabei doch witziger und oft nachdenklicher Film. Es gelingt ihm, ein ernstes und sehr verstörendes Thema größtenteils beinahe unterhaltsam zu vermitteln. So wird man unterhalten, ist gebannt von der unglaublichen Welt, die sich vor einem auftut und lernt viel. Ein guter Film.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
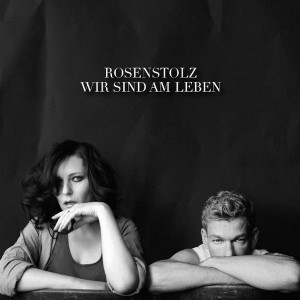 Der siebte Titel auf der aktuellen Rosenstolz-Platte ist zunächst ein semantisches Wunder. Wie soll man denn Amok küssen? Bei Amok denkt man schließlich automatisch an Amokläufe, bei denen ein gestörter Mensche viele andere Menschen in den Tod reißt und sich in der Regel danach selbst tötet. Wikipedia stellt dazu fest, dass die ursprüngliche Bedeutung des Wortes "in blinder Wut angreifen und töten" ist. Dennoch seien damit lediglich psychische Extremsituationen mit mehr oder minder starker Unzurechnungsfähigkeit und starker Gewaltbereitschaft gemeint.
Der siebte Titel auf der aktuellen Rosenstolz-Platte ist zunächst ein semantisches Wunder. Wie soll man denn Amok küssen? Bei Amok denkt man schließlich automatisch an Amokläufe, bei denen ein gestörter Mensche viele andere Menschen in den Tod reißt und sich in der Regel danach selbst tötet. Wikipedia stellt dazu fest, dass die ursprüngliche Bedeutung des Wortes "in blinder Wut angreifen und töten" ist. Dennoch seien damit lediglich psychische Extremsituationen mit mehr oder minder starker Unzurechnungsfähigkeit und starker Gewaltbereitschaft gemeint.
Musikalisch reiht sich "Wir küssen Amok" in den Stil seiner beiden Vorgänger ein: Es gibt nichts Überraschendes. Das Lied plätschert vor sich hin, lediglich der Einsatz des Basses in der zweiten Strophe stört die Gefälligkeit.
"Wir küssen Amok" könnte eine friedliche Alternative zum Amoklauf sein. Anstatt dass man in einer verzweifelten Situation gewalttätig Menschen tötet, rettet man sich in eine Beziehung. Das klingt schräg, wird vom Text so nicht gestützt. Stattdessen scheint mit dem Amok eher die Gefühle der betroffenen Personen gemeint zu sein. Sie sind so heftig, dass man sich in einer psychischen Extremsituation befindet und nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Die Gewaltbereitschaft ist dadurch nicht direkt gegeben. Doch die Gefühle sind so heftig, so gewaltig, dass hinter dem ganzen ein ordentliches Maß an "Gewalt" steckt.
Die beiden Strophen bieten relativ wenig Inhalt. Deutlich wird nur, dass man aufeinander nicht verzichten kann und vor einer großen Herausforderung steckt. Anstatt davor die Augen zu verschließen, bleibt man wach und rückt näher zueinander. Trotz des Gegenwinds, den beide Partner verspüren, tut die Krise ziemlich gut, da mit der Angst auch der Mut wachse. Das ist ein hoffnungsvoller Ausblick in einem kritischen Moment.
Der Refrain liefert die Begründung, warum die Krise gemeinsam überstanden werden kann: Du machst mich an/ Und was ich kann / Ist nichts dafür / Nichts dagegen. Man ist so zueinander hingezogen, dass gar nichts anderes übrig bleibt, als zusammenzubleiben und das Problem zu lösen. Nach einer weiteren Betonung, dass es nun einmal nicht anderes geht, kommen die titelgebenden Zeilen: Wir küssen Amok / Im schönsten Regen. Das deutet tatsächlich darauf hin, dass mit dem "Wir küssen Amok" der heftige Ausbruch von Gefühlen gemeint ist, was sich sowohl in einem (negativen) Streit als auch in einem (positiven aber bewegenden) Problemlösungsprozess äußern kann. Beide Varianten laufen in einem Umfeld ab, das ein Scheitern, also eine Trennung, aufgrund noch immer stark vorhandener Anziehungskräfte ausschließt.
Nachdem das Lied also beschreibt, wie eine Krise in einer Beziehung, die nicht scheitern kann/darf, angegangen wird, endet es sehr versöhnlich. Denn nachdem zuvor betont wird, dass man sich gar nicht wehren könne, heißt es zum Schluss: Will mich nicht wehrn / Mich nicht beschwern / Wir küssen Amok / Im Schönsten Regen. Zuletzt setzt sich somit die Erkenntnis durch, dass man der emotionalen Extremsituation nicht nur nicht entgehen kann, sondern dass dies auch gar nicht ratsam wäre. Denn nach so einer extremen Phase wird das Verhältnis stärker sein als zuvor.
Diese schöne, nachdenkliche und ind er Realität nur schwer zu akzeptierende Botschaft, die man - wie so viele Lieder des Albums - auch unter dem Gesichtspunkt der Burn-Out-Erfahrungen des Sängers Peter Plates betrachten könnte, wird leider durch die Musik nicht unterstützt. Das Lied wirkt unaufgeregt, die extremen Gefühle die vom Text angesprochen werden, wirken nicht. So klafft eine enorme Lücke zwischen dem theoretischen Inhalt des Textes und dem, was das Lied transportiert. Das ist schade.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
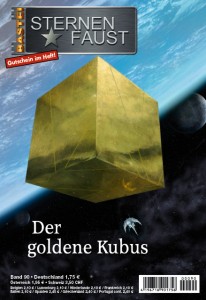 Wenn man etwas regelmäßig macht, vergisst man häufig, bei runden Momenten inne zu halten. Vor beinahe vier Jahren begann ich mit meinen regelmäßigen "Sternenfaust"-Rezensionen auf SF-Radio. Seitdem habe ich alle zwei Wochen das aktuelle Heft kommentiert. Angefangen mit dem 90. Band der Serie "Der goldene Kubus" von Michelle Stern bis zu meiner jüngsten Rezension. Michelle Stern verfasste übrigens nicht nur den Roman, den ich zuerst rezensierte, sondern auch den Roman, zu dem ich meine 100. Rezension geschrieben habe, "In Pranurs Gewalt". Und obwohl die Serie gerade einmal zehn Heft, nachdem ich die erste Rezension (Band 90 - Der goldene Kubus von Michelle Stern) verfasste, ihre bisherige Tiefphase erreichte, ist "Sternenfaust" die einzige Heftromanserie geblieben, die ich kontinuierlich über einen langen Zeitraum verfolgt habe. Die Tiefphase fand übrigens in den Romanen 100 bis 125 statt und wurde kurz danach überwunden. Damals orientierte sich die Serie zu sehr an dem (vermeintlich) großen Bruder "Perry Rhodan" und kopierte dessen Prinzip möglichst wenig Handlung in einen Roman zu packen. Das wurde mittlerweile geändert, sodass "Sternenfaust"-Romane fast immer abgeschlossene, spannende Geschichten bilden und dabei die Haupthandlung voran bringen.
Wenn man etwas regelmäßig macht, vergisst man häufig, bei runden Momenten inne zu halten. Vor beinahe vier Jahren begann ich mit meinen regelmäßigen "Sternenfaust"-Rezensionen auf SF-Radio. Seitdem habe ich alle zwei Wochen das aktuelle Heft kommentiert. Angefangen mit dem 90. Band der Serie "Der goldene Kubus" von Michelle Stern bis zu meiner jüngsten Rezension. Michelle Stern verfasste übrigens nicht nur den Roman, den ich zuerst rezensierte, sondern auch den Roman, zu dem ich meine 100. Rezension geschrieben habe, "In Pranurs Gewalt". Und obwohl die Serie gerade einmal zehn Heft, nachdem ich die erste Rezension (Band 90 - Der goldene Kubus von Michelle Stern) verfasste, ihre bisherige Tiefphase erreichte, ist "Sternenfaust" die einzige Heftromanserie geblieben, die ich kontinuierlich über einen langen Zeitraum verfolgt habe. Die Tiefphase fand übrigens in den Romanen 100 bis 125 statt und wurde kurz danach überwunden. Damals orientierte sich die Serie zu sehr an dem (vermeintlich) großen Bruder "Perry Rhodan" und kopierte dessen Prinzip möglichst wenig Handlung in einen Roman zu packen. Das wurde mittlerweile geändert, sodass "Sternenfaust"-Romane fast immer abgeschlossene, spannende Geschichten bilden und dabei die Haupthandlung voran bringen.Daher, kurz nach meiner 101. Rezension und nach mittlerweile 44 "Sternengeflüster"-Kolumnen auf dem Zauberspiegel der (wenig überraschende) Hinweis: Diese Heftromanserie lohnt sich wirklich, ist seit Thomas Höhls Führung enorm spannend und bietet ein hohes Suchtpotential. Einsteigen!
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 In Roulettenburg wartet ein verschuldeter General auf den Tod seiner kranken Mutter. Das Erbe der vermögenden Frau würde seine Situation schlagartig ändern und die Hochzeit mit einer reichen Frau ermöglichen. In seinem Anhang befindet sich Aleksej Iwanowitsch, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt ist und der in die Tochter des Generals, Polina, verliebt ist. Seine Liebe wird zunächst nicht erwidert. Dann taucht die Mutter plötzlich kerngesund auf und verfällt dem Roulettespiel. Auch bei Aleksej machen sich schleichend Zeichen der Spielsucht bemerkbar.
In Roulettenburg wartet ein verschuldeter General auf den Tod seiner kranken Mutter. Das Erbe der vermögenden Frau würde seine Situation schlagartig ändern und die Hochzeit mit einer reichen Frau ermöglichen. In seinem Anhang befindet sich Aleksej Iwanowitsch, aus dessen Perspektive die Geschichte erzählt ist und der in die Tochter des Generals, Polina, verliebt ist. Seine Liebe wird zunächst nicht erwidert. Dann taucht die Mutter plötzlich kerngesund auf und verfällt dem Roulettespiel. Auch bei Aleksej machen sich schleichend Zeichen der Spielsucht bemerkbar.Die knappe Erzählung wirkt wie ein Rausch. Von Anfang an ist der Leser gefangen in der Dynamik der Geschichte. Die Intrigen im Anhang des Generals, in dem es in erster Linie darum geht, den tölpelhaften General um sein Erbe zu bringen, sind für sich bereits spannend. Dazu gesellt sich die ständige Bedrohung durch die Spieltische. Der Ich-Erzähler selbst analysiert scheinbar neutral und mit einem gewissen Abstand die verschiedenen Typen von Spielern. Da wirkt es noch unmöglich, dass er selbst dem Glücksspiel verfallen kann. Seine heftigen Gefühlsausbrüche gegenüber Polina, die seine Liebe nicht erwidert und ihn gnadenlos ausnutzt, deuten jedoch darauf hin, dass keineswegs ein nüchterner Mensch ist.
An vielen Stellen ist die Geschichte urkomisch. Der habgierige Anhang wird durch die sehr vitale und plötzlich auftauchende Mutter desillusioniert. Als diese dann beginnt, ihr gesamtes Vermögen am Roulettetisch zu verlieren, greift Panik um sich. Daraus entstehen hektische, unbedachte und häufig sehr komische Situationen.
Der Ich-Erzähler leidet derweil an seiner unerfüllten, aber heftigen Liebe zu Polina. Er ist nicht in der Lage, ihr irgendeinen Wunsch auszuschlagen. An dieser Konstante lässt sich im Verlauf der Geschichte der Fortschritt seiner Spielsucht ablesen. Zum Schluss ist er nicht mal in der Lage, das Glücksspiel hinter sich zu lassen, als er erfährt, dass Polina ihn doch lieben würde, wenn er zu ihr käme. Die Sucht hat ihn so gepackt, dass sie seine Liebe überwiegt beziehungsweise Gefühle gar nicht mehr zulässt.
Trotz des übersichtlichen Umfangs der Erzählung ist sie reich an skurrilen Charakteren und Unterhaltungen. Einige davon sind offen rassistisch, wenn zum Beispiel darüber diskutiert wird, dass Russen allgemein empfänglich für die Spielsucht sind. Im Nachwort wird dieses Problem immerhin etwas eingeordnet. Im Größtenteil sorgen die Charaktere und die gewitzten Dialoge aber für gute Unterhaltung.
„Der Spieler“ ist eine erschreckende, aber ungemein fesselnde Erzählung, die sowohl mit unterhaltsamen und interessanten Charakteren aufwartet als auch die zerstörende Kraft von Glücksspielen eindringlich verdeutlicht.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

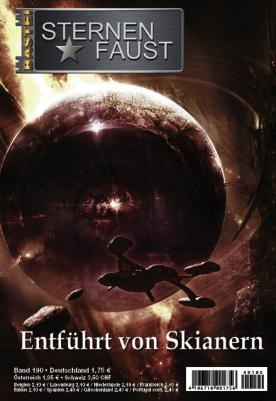 Die Sternenfaust und ihre Besatzung sind auf der Suche nach dem sechsten Akoluthorum. Sie finden es auf einem Planeten mit einem interessanten Volk, auf dem sich unglücklicherweise auch die mächtigen Skianer befinden. Da die Besatzung das zu spät bemerkt, kommt es beinahe zu einer Katastrophe.
Die Sternenfaust und ihre Besatzung sind auf der Suche nach dem sechsten Akoluthorum. Sie finden es auf einem Planeten mit einem interessanten Volk, auf dem sich unglücklicherweise auch die mächtigen Skianer befinden. Da die Besatzung das zu spät bemerkt, kommt es beinahe zu einer Katastrophe.
Mit diesem Roman tauchen zum ersten Mal die Skianer direkt in der Serie auf. Bisher hat man nur von ihnen gehört. Es stellt sich leider heraus, dass die Skianer nicht besonders pfiffig sind.
Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Sternenfaust Band 190 - Entführt von Skianern (von Christian Schwarz)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

In der vergangenen Woche schrieb ich in meiner "Sternenfaust"-Kolumne auf dem Zauberspiegel über die Erwartungen an den aktuellen "Sternenfaust"-Roman. Das Schiff und seine Besatzung treffen in diesem zum ersten Mal auf die Skianer. Dieses Volk könnte sich als der "große" Gegner erweisen, der in dem derzeitigen "Andromeda"-Zyklus noch nicht aufgetaucht ist.
Organisierter Widerstand?
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
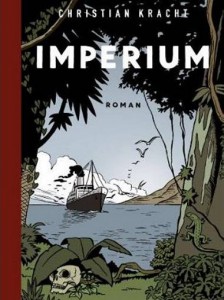 Der Deutsche Engelhardt hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Vision. Der überzeugte Vegetarier glaubt fest daran, ein besserer Mensch zu werden, wenn er sich ausschließlich von Kokosnüssen ernährt. Daher siedelt er in eine deutsche Pazifikkolonie über und betreibt dort eine Kokosnussplantage. Er hält stoisch an seinem Ziel fest, sich ausschließlich von Kokosnüssen zu ernähren. Dabei räumt er vermeintliche Jünger aus dem Weg und ignoriert die Welt, die um ihn herum untergeht.
Der Deutsche Engelhardt hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Vision. Der überzeugte Vegetarier glaubt fest daran, ein besserer Mensch zu werden, wenn er sich ausschließlich von Kokosnüssen ernährt. Daher siedelt er in eine deutsche Pazifikkolonie über und betreibt dort eine Kokosnussplantage. Er hält stoisch an seinem Ziel fest, sich ausschließlich von Kokosnüssen zu ernähren. Dabei räumt er vermeintliche Jünger aus dem Weg und ignoriert die Welt, die um ihn herum untergeht.Dem Roman kann zugute gehalten werden, dass er äußerst dicht erzählt ist. Auf gerade einmal etwas mehr als hundert Seiten wird nicht nur Engelhardts krudes Gedankenwerk ausgebreitet, sondern auch die Geschichte vieler anderer Inselbewohner erzählt. Kracht schafft dabei in erster Linie Stereotypen, die im Lauf des Romans keinerlei Wandlungen durchlaufen. Das gelingt ihm aber gut, man kann sich die meisten Typen sofort vorstellen. Oft sind die Charaktere merkwürdig genug, um Interesse zu erwecken.
Kracht bemüht sich dabei immer, die großen Konflikte der jeweiligen Zeit mit einzubinden. Daher wimmelt es von Rassisten, Antisemiten und Fortschrittsgläubigen. Das ist teilweise recht anstrengend. Indem Kracht überkommene Denkmuster darstellt, produziert er viele rassistische Szenen. Die Einwohner der Inseln sind extrem primitiv dargestellt. Kritisch dürfte vor allem sein, dass Kracht Kanibalismus als bewiesene Tatsache ansieht. Krachts Bemühen auf die Denkweisen der damaligen Zeit einzugehen, ist weitestgehend anstrengend. Das liegt in erster Linie daran, dass es tatsächlich bemüht wirkt.
Engelhardt entfernt sich im Laufe des Romans der Zivilisation immer mehr. Es geht ihm psychisch und physisch immer schlechter. Zwei Jünger schließen sich ihm nacheinander an. Beide entfernt Engelhardt auf herzlose Weise aus seiner Welt. Das Ende des Romans suggeriert, dass Engelhardts Kokosnussdiät tatsächlich ein kleines gesundheitliches Wunder (eine Lepra-Heilung) vollbringen kann. Dabei verfällt Engelhardt in alberne Marotten (Daumenlutschen), Selbstkannibalismus und Mordlust. Das ist meist eklig zu lesen. Völlig überrascht ist der Leser, als Engelhardt nach dem zweiten Weltkrieg ohne weiteres in der Lage dazu ist, amerikanischen Soldaten seine Lebensgeschichte zu erzählen. Nachdem er zuvor nicht in der Lage war, zu einem Freund ein Kommunikationsverhältnis aufzubauen, ist das Ende verwirrend und wirkt unrealistisch.
„Imperium“ ist an den Stellen stark, in dem man den Habitus eines maroden Reiches und dessen mörderischer Lebenseinstellung spüren kann. Dass man aus dieser Lebenseinstellung nicht entfliehen kann, indem man auf eigene Faust versucht, einen utopischen Lebensentwurf in die Realität umzusetzen, zeigt das Schicksal Engelhardts. Doch leider geht dieser Teil der Geschichte zu oft hinter ekligen Wunden Engelhardts, primitiven Ureinwohnern und kindermissbrauchende Kapitänen unter.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Puntila säuft seit zwei Tagen, da unterbricht ihn sein Knecht Matti. Er hat keine Lust mehr zu warten. Puntila erkennt in ihm „einen Menschen“, möchte sich mit seinem Knecht anfreunden. Kurz darauf hält er es sogar für möglich, Matti seine einzige Tochter, die eigentlich einem verschuldeten Attaché versprochen ist, zur Frau zu geben. Die Stimmung ändert sich schlagartig, als Puntila wieder nüchtern wird.Dann ist er ein strenger Herr, der alles sehr genau nimmt. Doch dabei sehnt er sich immer wieder den Rausch herbei, in dem er zumindest die Möglichkeit sieht, den Menschen näher zu kommen.
Puntila säuft seit zwei Tagen, da unterbricht ihn sein Knecht Matti. Er hat keine Lust mehr zu warten. Puntila erkennt in ihm „einen Menschen“, möchte sich mit seinem Knecht anfreunden. Kurz darauf hält er es sogar für möglich, Matti seine einzige Tochter, die eigentlich einem verschuldeten Attaché versprochen ist, zur Frau zu geben. Die Stimmung ändert sich schlagartig, als Puntila wieder nüchtern wird.Dann ist er ein strenger Herr, der alles sehr genau nimmt. Doch dabei sehnt er sich immer wieder den Rausch herbei, in dem er zumindest die Möglichkeit sieht, den Menschen näher zu kommen.Das Stück ist auf einer spartanischen Bühne inszeniert. Gegenstände gibt es kaum, stattdessen hohe Wände, die zu einer Drehbühne arrangiert sind. Dazu erklingt laute Musik, die die Boxen teilweise überdehnt. Die begrenzten Möglichkeiten der Charaktere und der Lärm des Rausches werden so gut dargestellt.
Zu Beginn sieht man einen Säufer, der viele Male hintereinander auf die Bühne kotzt. Sofort vermutet man, das ist Puntila. Doch es stellt sich heraus, dass der zweite, zu dem Zeitpunkt noch ruhigere Schauspieler der Puntila ist. Die andere Person taucht nicht wieder auf, ist einfach nur ein Säufer, der zum Schluss sogar zusammenbricht. Das ist ein geschickter Einfall. Denn das Stück suggeriert an vielen Stellen, dass der Alkohol zwar nichts an den gesellschaftlichen Verhältnissen ändern kann, bei einem Kapitalisten wie dem Puntila aber wenigstens das Gute im Menschen zutage fördern kann. Diese Inszenierung beginnt mit den gefährlichen, den zerstörerischen Auswirkungen des Alkohols.
Darüber hinaus ist das Stück an vielen Stellen natürlich lustig. Puntilas Stimmungsschwankungen sorgen für manche komische Szene. Er verlobt sich zum Beispiel im Schnelldurchgang mit drei Frauen an einem Nachmittag. Das wird freilich von zwei ernsten Komponenten flankiert. Erstens erfährt man von jeder Frau, was für ein karges und ausgebeutetes Leben sie führen. Zweitens löst Puntila die Verlobung sofort wieder auf, als er nüchtern ist. Die Frauen werden somit in dem Moment ihrer Hoffnung beraubt, als sie gerade zum ersten Mal seit langem so etwas wieder entwickelt haben.
Stark ist Mattis scheinbar teilnahmslose Darstellung. Wenn er mit Puntila redet, bemüht er sich immer, seine Meinung nach hinten zu stellen. Er akzeptiert das System, akzeptiert, dass auf dem Markt Arbeiter wie Waren gehandelt werden. Er drängt Puntila, wenn dieser besoffen ist, das Notwendige zu tun. Gelegentlich aber bricht er aus seiner Rolle heraus. Dann macht er einen Spaß und meist fällt das zusammen mit Puntilas nüchternen Phasen, was schief gehen muss. Am weitesten bricht er gegenüber Puntilas Tochter aus seiner zurückhaltenden Position, hier erlaubt er sich viel. Das geht jedoch nicht so weit, dass er sie tatsächlich heiraten könnte. Natürlich will er es, er weiß aber, dass die Standesunterschiede zu groß sind, die Lebensrealitäten zu weit voneinander entfernt, als dass hier Liebe oder gar eine Ehe gelingen könnten.
Das ist zum Schluss auch die Hauptaussage. Obwohl Matti ein zurückhaltender, häufig angepasster Knecht ist, der sich vieles gefallen lässt, reicht selbst ein halb guter Herr nicht, um die Verhältnisse erträglich werden zu lassen. Die Kluft zwischen Herr und Knecht kann auch im Rausch nicht überwunden werden. Die Verhältnisse sind im herrschenden System nicht zu überwinden, auch nicht durch Alkohol.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
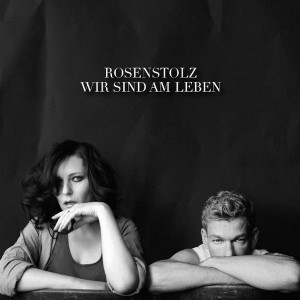 "Marilyn" folgt als sechstes Lied des Albums "Wir sind am Leben" auf das schwache "Mein Leben im Aschenbecher". Dennoch hinterlässt das Lied einen musikalisch beliebigen, textlich sperrigen und verwirrenden Eindruck. Dieses Lied muss man in erster Linie unter den Umständen betrachten, unter denen das Album entstanden ist. Bekanntlich musste Peter Plate die "Bist Du dabei?"-Tour zum Album "Die Suche geht weiter" aufgrund einer Burn-Out-Erkrankung abbrechen. Viele Lieder des aktuellen Albums thematisieren dies und drücken daher wie zum Beispiel "Überdosis Glück" - auf positive Weise - das Bedürfnis nach positiven Veränderungen im Leben aus. "Marilyn" nähert sich dem Thema von einer anderen Seite.
"Marilyn" folgt als sechstes Lied des Albums "Wir sind am Leben" auf das schwache "Mein Leben im Aschenbecher". Dennoch hinterlässt das Lied einen musikalisch beliebigen, textlich sperrigen und verwirrenden Eindruck. Dieses Lied muss man in erster Linie unter den Umständen betrachten, unter denen das Album entstanden ist. Bekanntlich musste Peter Plate die "Bist Du dabei?"-Tour zum Album "Die Suche geht weiter" aufgrund einer Burn-Out-Erkrankung abbrechen. Viele Lieder des aktuellen Albums thematisieren dies und drücken daher wie zum Beispiel "Überdosis Glück" - auf positive Weise - das Bedürfnis nach positiven Veränderungen im Leben aus. "Marilyn" nähert sich dem Thema von einer anderen Seite.Der Text ist eine Ansprache an eine Person. Dabei muss es sich nicht um Marilyn Monroe handeln, sondern um eine Person, die sich so fühlt. Darauf deuten die Textstellen "Du bist Marilyn Monroe - ist für mich ok" und "Du nennst Dich Marilyn - sag mir wer ich dann bin" hin. Ganz eindeutig wird dann zum Schluss ("Marilyn - egal wie man das nennt"), dass sich das Lied metaphorisch an eine allgemeine Person richtet, die am Leben oder einem Ereignis verzweifelt.
Die Metaphorik wird direkt in den Abschnitte über das Rampenlicht und das Drehen eines Film aufgegriffen. Aus diesem Teil strahlt vor allem Verständnis. Der Text betont, dass es gar nicht darum geht, die Handlungen im Rampenlicht zu verstehen. Solange klar ist, dass dieses Verhalten getrennt von dem Auftreten zu Zweit zu sehen ist, scheint das für den Ansprechenden in Ordnung zu sein. Das ist aus dem Zusammenhang gerissen merkwürdig, aber wichtig für den allgemeinen Teil. Denn es macht klar, dass es bei der folgenden Beziehung oder der Hilfe nicht darum geht, die Taten der Person zu bewerten. Sie sind unerheblich, und müssen nicht einmal verstanden werden.
Auf den speziellen Teil folgen Ermutigungen. Geht man davon aus, dass es sich bei "Marilyn" tatsächlich um eine Metaphorik handelt, versichert man sich zunächst des gegenseitigen Antriebs. Und wir zünden einander an, und wir halten einander warm. Bei so einer gegenseitigen Wirkung sind Schwierigkeiten leicht zu meistern. Da die angesprochene Person mit dem oder ihrem Leben nicht zufrieden ist, bedarf es großen Zuspruchs. Deswegen wird ihre Klugheit, ihre Schönheit und zuletzt auch ihre Stärke betont. Dieser Teil soll Mut machen.
Von diesem Abschnitt an, wird der bisherige, ruhige Rhythmus verlassen. Unter lauteren Klängen nähert sich das Lied dem Ende. Nachdem versichert worden ist, wie stark die angesprochene, verzweifelte Person ist, kommt nun noch Bedingungslosigkeit in der Beziehung zwischen Ansprecher und Angesprochenem hinzu. "Ich schau in Dein Gesicht - Du schaust in mein Gesicht - mehr brauch ich nicht". Besonders gelungen ist die Betonung, dass man keineswegs ein "Teil" des jeweils anderen ist, aber dennoch zusammengehört. Denn "Liebe" sei nun einmal komplex.
In der Schlusstrophe wird endgültig aufgelöst, dass es sich bei dem Titel des Liedes um eine Metapher handelt (Marilyn - egal wie man das nennt). Um die Verzweiflung nach aufbauenden, lobenden Worten und der Versicherung der bedingungslosen Liebe (ob freundschaftlich oder nicht, wird nicht geklärt) endgültig zu vertreiben, wird noch einmal betont, wie stark die angesprochene Person unterstützt und gemocht wird. Gleichzeitig macht sich aber Verzweiflung darüber breit, dass das nicht anerkannt, ja gar nicht gesehen wird. Das ist dann (trotz vieler weiterer Aussagen) die Message, die zum Schluss hängen bleibt: In einer verzweifelten Situation gibt es fast immer jemanden, der sich genug um einen sorgt, dass er Hilfe (bedingungslos) anbieten würde. In den meisten Fällen wird das im Rausch der Verzweiflung nur nicht gesehen.
Diese schöne Aussage, verbunden mit dem Aufruf zu mehr Selbstbewusstsein ändert nichts daran, dass das Lied musikalisch beliebig wirkt. Hat man den Text aber erst einmal erfasst, ist das Lied ein Aufruf, in der gefühlten Verzweiflung den Kopf nie ganz hängen zu lassen, sondern sich nach den Dingen umzugucken, die einen aufbauen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
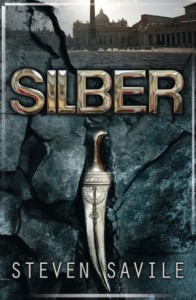 Dreizehn Engländer verbrennen sich gleichzeitig in dreizehn verschiedenen Städten. Zuvor verkündet jeder von ihnen vierzig Tage des Terrors, an deren Ende der Glaube fallen wird. Die Welt ist geschockt. Während die Medien noch rätseln, was geschehen ist, ruft Sir Charles Windham sein geheimes Team zusammen. Das besteht aus vier ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern, alle mit illustrer Vergangenheit, und einem äußerst geschickten Hacker. Charles Windham sitzt seit vielen Jahren im Rollstuhl, weiß aber bereits, dass die Judas-Sekte hinter dem aktuellen Wirbel steckt. Sechs Personen müssen nun herausfinden, mit welchen Methoden die Sekte die Menschheit terrorisieren möchte.
Dreizehn Engländer verbrennen sich gleichzeitig in dreizehn verschiedenen Städten. Zuvor verkündet jeder von ihnen vierzig Tage des Terrors, an deren Ende der Glaube fallen wird. Die Welt ist geschockt. Während die Medien noch rätseln, was geschehen ist, ruft Sir Charles Windham sein geheimes Team zusammen. Das besteht aus vier ehemaligen Geheimdienstmitarbeitern, alle mit illustrer Vergangenheit, und einem äußerst geschickten Hacker. Charles Windham sitzt seit vielen Jahren im Rollstuhl, weiß aber bereits, dass die Judas-Sekte hinter dem aktuellen Wirbel steckt. Sechs Personen müssen nun herausfinden, mit welchen Methoden die Sekte die Menschheit terrorisieren möchte."Silber" ist spannend und kurzweilig geschrieben. Die Kapitel sind nicht zu lang, es geschieht viel. Der Autor schreibt dabei angenehm ausgewogen. Um den Judas-Mythos enthüllt er eine Reihe von Theorien. Das braucht häufig mehrere Seiten und ist teilweise kompliziert. Diesen spannenden, aber langwierigen Ausführungen stellt Savile viele Action-Szenen gegenüber. So wechseln sich Geschichtslektionen mit Verfolgungsjagden und Schießereien regelmäßig ab.
Die Darstellung des Mythos ist dabei besonders gelungen. Der Autor erweckt mit diesem Roman tatsächlich den Eindruck, alles was sein Team erfährt und erlebt, könnte tatsächlich so geschehen sein. Das ist für einen Religionsthriller bereits ein wichtiger Schritt. Einzig die Rückblenden in die Zeit nach Judas Tod hätte man sich sparen können. Diese Szenen wirken wie ein Nachspiel , von dem, was man bereits in der Gegenwart erfahren hat. Abgesehen davon, dass sie dem Leser wohl zeigen sollen, dass es sich bei dem Dolch tatsächlich um das Silber, das Judas für den Verrat an Jesus erhalten hat, handelt, haben sie keinerlei Funktion.
Saviles Charaktere sind allesamt skurril. Sie alle haben eine bewegte Geschichte hinter sich, die in dem Roman meist nur mit ein paar Sätzen kommentiert wird. Nur bei der einzigen Frau im Team, Orla, und Windham wird ausführlicher auf die Vergangenheit eingegangen. Das ist einerseits angenehm, da Romane mit ständigen Rückblicken häufig konstruiert und bemüht wirken. Andererseits bleiben die meisten Charaktere dadurch blass. Keiner der "Guten" erlebt im Roman eine Wandlung. Und bis auf Orla erlebt niemand eine wirklich schlimme Situation. Daran kann kein Charakter wachsen. Außerdem sind alle Teammitglieder die reinsten Tötungsmaschinen, denen es leicht fällt, alleine sechs Feinde auszuschalten. Das wirkt an einigen Stellen unrealistisch.
Ärgerlich ist zudem, dass trotz der dichten Handlung wenig geschieht. Der Leser erfährt bis zum Schluss zwar alle Zusammenhänge (oder glaubt das zumindest), das Team selbst erreicht jedoch wenig. Es gelingt, zwei Bösewichte auszuschalten. Doch den grausamsten übersieht man und so geht der Plan der Sekte doch in Erfüllung. Das erscheint am Ende eines vierhundertseitigen Roman, der nicht als Beginn einer Reihe gekennzeichnet ist, doch etwas enttäuschend. Der Cliffhanger ist zweiffelsohne gelungen, schöner wäre es aber gewesen, wenn der Fall in diesem Roman zu Ende gebracht worden wäre.
"Silber" ist ein flott geschriebener Roman, der mit einem gut gestrickten Religionsmythos aufwarten kann. Leider bleiben die Charaktere hinter der Komplexität der Geschichte zurück. Obwohl jeder eine Besonderheit aufweist, wirken sie hölzern und können selten überzeugen. Wer den Roman liest, muss sich darauf einstellen, dass hier lediglich der Mythos entstrickt wird. Die eigentliche Handlung wird wohl erst in der Fortsetzung einsetzen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Die zweite Staffel "Perry Rhodan Neo" ist vorbei. Wer meine Rezensionen verfolgt hat wird es gemerkt haben, für alle anderen: In meinen Augen waren die acht Bände eine riesige Enttäuschung. Die Handlung kam nicht voran, anstatt Geschichten zu erzählen, schienen die Autoren keine Ahnung zu haben, wie sie die 160 Seiten eines jeden Romans füllen sollten. Bereits nach der Hälfte der Staffel war deutlich, dass man nur noch auf das Finale zu schrieb. Zu allem Überfluss war das Finale der Staffel dann kreativlos und somit langweilig.
Etwas genauer setzt sich ein Artikel auf dem Zauberspiegel mit dieser unbefriedigenden Staffel auseinander:
Kreativlose Langeweile: »Perry Rhodan Neo« bietet nach zwei Staffeln nichts Neues!
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
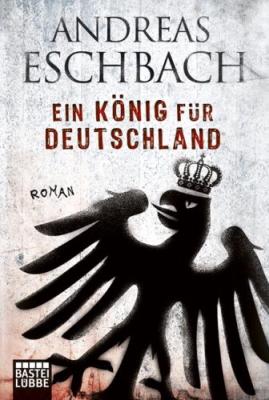 Vincent ist ein Hacker. Er hat den notorischen Tick, in seinen Viren eine Signatur zu hinterlassen, was ihm eine schnelle Verurteilung einbringt. Vorbestraft möchte ihn niemand einstellen, bis sich eine IT-Firma erbarmt. Dort erhält er nach kurzer Zeit den Auftrag, ein Verfahren zu entwickeln, um elektronische Wahlmaschinen zu manipulieren. Nach verschiedenen Testversuchen wird das Projekt in Amerika fallen gelassen. Doch ein zwielichter Mann mit Verbindungen zur Mafia zwingt Vincent das Programm zu verfeinern, um es in Deutschland einzusetzen. Vincent kann kurz nach der Vollendung des Programms fliehen und schickt das Programm an seinen Vater in Deutschland: Simon König. Der hat nun ein Verfahren in der Hand, Wahlen zu manipulieren.
Vincent ist ein Hacker. Er hat den notorischen Tick, in seinen Viren eine Signatur zu hinterlassen, was ihm eine schnelle Verurteilung einbringt. Vorbestraft möchte ihn niemand einstellen, bis sich eine IT-Firma erbarmt. Dort erhält er nach kurzer Zeit den Auftrag, ein Verfahren zu entwickeln, um elektronische Wahlmaschinen zu manipulieren. Nach verschiedenen Testversuchen wird das Projekt in Amerika fallen gelassen. Doch ein zwielichter Mann mit Verbindungen zur Mafia zwingt Vincent das Programm zu verfeinern, um es in Deutschland einzusetzen. Vincent kann kurz nach der Vollendung des Programms fliehen und schickt das Programm an seinen Vater in Deutschland: Simon König. Der hat nun ein Verfahren in der Hand, Wahlen zu manipulieren.Andreas Eschbach ist es sehr wichtig, dass der Leser weiß, dass alles, was in dem Roman geschildert wird, theoretisch möglich ist. Daher finden sich viele Fußnoten in dem Buch. Das ist ganz nett, gerade am Anfang jedoch etwas übertrieben. Gegen Ende, wenn regelmäßig das Grundgesetz zitiert wird, erfüllt das zwar einen gewissen Bildungsauftrag, ist für den Fortgang des Romans aber nicht besonders nützlich.
Denn die Geschichte tritt dadurch etwas in den Hintergrund und die Lektüre wird durch das Anliegen des Autors dominiert. Eschbach weist zurecht darauf hin, dass Wahlcomputer der Manipulation Tor und Tür öffnen. Daher muss immer darauf verwiesen werden, dass der in dem Buch geschilderte Irrsinn tatsächlich möglich ist. Das wird leider zu offensiv betrieben. Etwas mehr Story, weniger Plädoyer wäre nützlich gewesen.
Der Roman teilt sich in mehrere Teile. Zunächst erlebt man über einen langen Zeitraum mit, wie Vincent dazu kommt, das Programm zu erstellen. Das verwundert zunächst. Denn auf dem Buchrücken erfährt der Leser bereits, dass Vincents Vater irgendwann zum Deutschen König gekrönt wird. Das ist wie der Titel ungünstig, zu vorhersehbar ist die Handlung.
Dennoch ist dieser Teil nicht ganz schlecht. Das liegt, wie im Rest des Romans, an Eschbachs kurzweiligem und unterhaltsamen Srachstil. Alles liest sich flüssig, obwohl die Charaktere alle eindimensional sind, kann man sich mit ihnen identifizieren.
Der zweite Teil ist der beste. Hier erhält Simon die CD und sie wird ihm sofort wieder geklaut. Danach macht der Kleinbürger und Lehrer Simon mit einigen Hackern Pläne, wie sie eine Manipulation der Wahlen verhindern können. Dieser Teil ist gelungen, weil Simon langsam in seine Rolle wechselt. Vincent hat auch in dem Wahlfälschungsprogramm eine Signatur hinterlassen. Also muss die Gruppe eine Partei mit Vincents Initialien gründen: VWM, Volksbewegung für die Wiedereinführung der Monarchie.
Dieser Teil ist geprägt durch viele Interviews Simons, die alle sehr real wirken. Die Art und Weise wie die Medien auf diese Splitterpartei eingehen und daraus eine kleine Sensation machen, wirkt lebensnah. Dieser Abschnitt des Buches ist skurril und dadurch spannend. Außerdem nähert sich Simon hier immer mehr den phrasendreschenden Politikern an, die unerfüllbare Dinge versprechen. Nur bei ihm weiß man, dass er es gut meint. Auch das dürfte bei politisch weniger interessierten Lesern, für einen kleinen Lerneffekt sorgen. Für politisch gebildete Leser macht das keinen Unterschied.
Leider fällt das Ende stark ab. Die VWM wird mit überwältigender Mehrheit gewählt, es waren zu viele Wahlmaschinen im Einsatz. Daraufhin wird Simon König zum König gekrönt, weil die Initiatoren der Partei selbst nicht mehr glauben, dass sie alles manipuliert haben. Dieser Größenwahnsinn ist albern. Die Aufklärung der ganzen Geschichte lässt zu wünschen über. Einige Hacker verschwinden einfach spurlos, der ursprüngliche Auftraggeber wird ermordet, bevor er den Trick, wie er so viele Maschinen mit dem Manipulationsprogramm ausstatten konnte, verraten kann. Am Ende erhält Simon, der sich die ganze Zeit über moralisch richtig verhalten hat und die Königswürde einfach ablehnt, ein eigenes Schloss von einem Industriellen gestellt. Dieser Kitsch zum Ende ist etwas übertrieben. Auch die Wiedervereinigung mit seiner Ex-Frau geht ein Stück zu schnell und wird nicht überzeugend erzählt.
„Ein König für Deutschland“ greift ein wichtiges Thema auf. Wie können wir sichere Wahlen mit unsicheren Maschinen garantieren? Die Möglichkeiten der Manipulation zeigt Eschbach in dem ersten Teil der Handlung ordentlich auf. Im Mittelteil erlebt man unterhaltsam und gut zu welchen Absurditäten die Medien in Deutschland in der Lage sein könnten. Außerdem gelingt es Eschbach hier unterhaltsam einen Wahlkampf zu schildern, wenn auch für eine Spaß-Partei. Zumindest Simons Aussagen sind hier sehr beachtlich und sind für politikferne Leser sicherlich lehrhaft. Das Ende fällt dann leider stark ab, hier hätte es einer besseren Auflösung bedurft. „Ein König für Deutschland“ ist ein kurzweiliger Roman, mit einem wichtigen Thema. Die einzelnen Teile des Romans sind von höchst unterschiedlicher Qualität.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
