 Lessing kritisierte sein eigenes Stück einst, dass es auf der Bühne entschlackt und drastisch gekürzt werden müsste. Genau das tut die Inszenierung am Berliner Ensemble. Übrig bleiben lediglich die drei Hauptfiguren: Der Verführer Mellefont, seine Geliebte und Verlobte Sara Sampson und seine ehemalige Geliebte und Mutter seiner Tochter, Marwood.
Lessing kritisierte sein eigenes Stück einst, dass es auf der Bühne entschlackt und drastisch gekürzt werden müsste. Genau das tut die Inszenierung am Berliner Ensemble. Übrig bleiben lediglich die drei Hauptfiguren: Der Verführer Mellefont, seine Geliebte und Verlobte Sara Sampson und seine ehemalige Geliebte und Mutter seiner Tochter, Marwood.
Diese Reduzierung tut dem Stück richtig gut, denn sie lenkt den Fokus von den bürgerlichen Tugenden. Mit Sir William Sampson ist der gutmütigste und tugendhafteste Charakter aus dem Stück geschrieben. Freilich wird er erwähnt und sein Brief taucht auf, aber seine langen Vergebungszenen entfallen.
Sara wirkt weitaus weniger tugendhaft. Viel mehr verdeutlicht die Inszenierung stärker das naive Mädchen. Insgesamt spielt sie aber eher eine Nebenrolle. Denn die meiste Zeit steht Marwood auf der Bühne und ringt um ihre verflossene Liebe.
Natürlich ist auch hier Marwood dafür verantwortlich, dass Sara am Ende stirbt und Mellefont sich umbringt. Sie kann nicht akzeptieren, dass sie nun nicht mehr geliebt wird und führt alles ins Feld, um Mellefont zurückzuerobern. Dass zum Beispiel ihr Argument, die gemeinsame Tochter Arabella brauche einen Vater, nur vorgeschoben ist, wird dadurch deutlich, dass sich Marwood in keiner Weise um die Belange ihrer Tochter kümmert. Alles was sie im Stück sagt und tut, muss also als List verstanden werden.
Und dennoch wird durch die Straffung deutlicher als im Dramentext, dass sie nicht die alleinig böse ist. Sie ist nicht die einzige, die der bürgerlichen Tugend und damit der Hochzeit Mellefont und Sara im Weg steht. Mellefont selbst hat durch seinen Lebensstil das Unglück heraufbeschworen. Das erkennt er auch im Original und bringt sich daher um. Auf der Bühne aber wird deutlicher, welche Schäden seine Affären hinterlassen haben. Marwood ist zu einem großen Teil das Opfer ihrer eigenen Gutmütigkeit, die von Mellefont ausgenutzt wurde und die sich danach in einen Wahn gesteigert hat. Aber selbst wenn man ihren Liebeswahn ignoriert, bleibt die Tatsache, dass Mellefont sie ihrer gesellschaftlichen Stellung beraubt hat und zu einer entehrten Person gemacht hat. Das scheint ihn kaum zu kümmern, er denkt allein an sich. Dadurch wird noch klarer, dass Mellefont die egozentrische Person in dem Stück ist, die zwar die wahre Liebe gefunden hat, sie aber nicht verdient. Tragischerweise vernichtet eine alte Liebe seine wahre Liebe und damit auch ihn.
Die Darstellung Marwoods in der Inszenierung des Berliner Ensembles überzeugt und ist sehr eindringlich. Die Kürzungen und Veränderungen des Stückes tun ihr genau so gut, wie die behutsame Modernisierung durch das Verwenden von Mobiltelefonen. Sehr gelungen ist daüber hinaus, dass zu Beginn, in der Mitte und am Schluss Fabeln zitiert werden, die höchstwahrscheinlich an den bekannten lessingschen Fabeln angelehnt sind. In ihnen dreht es sich zunächst um einen alternden Wolf, der auf die Hartherzigkeit der Welt mit rasendem Wahn reagiert (Marwood), und später um ein Schaf, das erst von Zeus eine Verteidigung gegen Feinde erbittet und sie ablehnt als es erkennen muss, dass dies seinen Charakter verändern wird und sich zum Schluss (diesmal für Jupiter) bereitwillig opfern lässt. Diese beiden Fabeln werden natürlich von Sara zitiert.
Die Inszenierung macht aus dem etwas gemächlichen und umfangreichen Werk eine berührende, gefühlvolle und dramatische Aufführung. Dabei stehen nicht so sehr die heilsamen bürgerlichen Werte und die „reinen“ Möglichkeiten des Bürgertums im Mittelpunkt, sondern das Leid, das durch das Erlöschen einer Liebe und die darauf folgende Eifersucht ausgelöst werden kann. Das nimmt den Zuschauer mit und lässt ihn nicht nur mit dem gescheiterten Paar, sondern auch mit der rasenden, liebestollen Marwood leiden.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Die Bremer Polizei arbeitet seit neuestem mit einer privaten Sicherheitsfirma zusammen und hat das Projekt "Security DNA" entwickelt. Dabei handelt es sich um Alarmanlagen, die im Notfall DNA-Spritzer auf den Dieb schießen. Die Polizei benötigt nur noch eine Taschenlampe, die die DNA sichtbar macht. Der erste Verbrecher ist damit schnell gefangen: Der Polizei Assitent Claas Berding schnappt einen Spielbankeinbrecher. Kommissarin Evernich macht also beruhigt Urlaub, während sich die politische Leitung mit dem raschen Fahndungserfolg schmückt. Kaum ist die Kommissarin bei ihrem sterbenden Vater, wachsen bei Staatsanwalt Gröninger und bei ihrem Assistenten Berding Zweifel, ob der Verdächtige tatsächlich schuldig ist, bloß weil er die "Security DNA" an seiner Jacke hatte. Bevor sie ihn interviewen können, begeht der Verdächtige jedoch Selbstmord.
Die Bremer Polizei arbeitet seit neuestem mit einer privaten Sicherheitsfirma zusammen und hat das Projekt "Security DNA" entwickelt. Dabei handelt es sich um Alarmanlagen, die im Notfall DNA-Spritzer auf den Dieb schießen. Die Polizei benötigt nur noch eine Taschenlampe, die die DNA sichtbar macht. Der erste Verbrecher ist damit schnell gefangen: Der Polizei Assitent Claas Berding schnappt einen Spielbankeinbrecher. Kommissarin Evernich macht also beruhigt Urlaub, während sich die politische Leitung mit dem raschen Fahndungserfolg schmückt. Kaum ist die Kommissarin bei ihrem sterbenden Vater, wachsen bei Staatsanwalt Gröninger und bei ihrem Assistenten Berding Zweifel, ob der Verdächtige tatsächlich schuldig ist, bloß weil er die "Security DNA" an seiner Jacke hatte. Bevor sie ihn interviewen können, begeht der Verdächtige jedoch Selbstmord."Ein klarer Fall" ist natürlich nicht klar. Stattdessen verdeutlicht der Radiotatort aus Bremen auf eindrucksvolle Weise, dass Technik keineswegs Polizeiarbeit ersetzt. Zu Beginn wird ständig von dem Täter gesprochen. Erst mit den ersten Zweifeln gelangt langsam das Wort "Verdächtiger" in den Tatort. Das macht klar, "im Zweifel für den Angeklagten" gilt in Zeiten von "Security DNA" nicht mehr. Hat jemand die richtige DNA, ist er schuldig. In diesem Fall nützt das vor allem dem wahren Täter.
Doch der Tatort ist nicht allein ein Lehrstück auf die moderne Fahndungstechnik. In einer Kurzschlussreaktion lässt sich Berding in ein Gefängnis einschleusen und Staatsanwalt Gröninger muss feststellen, dass es schwierig ist, gegen eine politisch gewollte Ermittlungsmethode vorzugehen. Das ist spannend und unterhaltsam.
In einer Nebenhandlung erfährt Kommissarin Everning, warum ihr Vatr ihre Berufswahl immer ablehnte. Er wurde als überzeugter, linker Pfarrer einst in der Strafvollzugsseelsorge entführt. Er teilte die Forderungen der Entführer, musste aber mit ansehen, wie die Verbrecher erschossen wurden. Das nimmt er der Polizei bis heute übel und gibt sich gleichzeitig eine Mitschuld an der Tragödie. Denn er ließ die Polizei in dem Glauben, die Entführer besäßen tatsächlich Waffen. Damit wollte er deren Verhandlungsposition stärken, verursachte im Endeffekt aber eine übertrieben Polizeiaktion. Everning erfährt das nicht direkt von ihrem Vater, zu einer Aussprache kommt es nicht, da sie Gröninger und Berding dabei helfen muss, den "Security DNA"-Fall aufzulösen.
Die spannende und erschreckend realistisch wirkende Handlung um eine unsinnige und gefährliche neue Ermittlungsmethode wird somit durch ein persönliches Schicksal abgerundet. Leider ahnt man von Anfang an, dass es zu der Aussprache zwischen Vater und Tochter nicht mehr kommen wird. Das hätte man zwar besser lösen können, es ist aber der einzige Kritikpunkt an einem außerordentlich gelungenen Radiotatort.
Die Folge kann noch bis zum 19. Juni auf der Homepage der Serie heruntergeladen werden.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

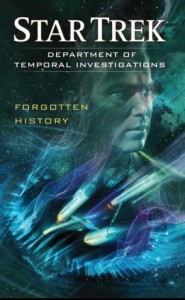 Nach "Watching The Clock" liefert Christopher L. Bennett einen weiteren sehr guten "Star Trek"-Roman um das "Department Of Temporal Investigations" ab. Ging es im ersten Band in erster Linie um die Zeitreisen an sich und den Kalten Krieg, der darum tobt, dreht sich im zweiten Band der Reihe alles um Geschichte. Die Agenten lernen anhand eines Zeitunfalls, dass die Zeitgeschichte der Föderation und vor allem des DTI selbst bei weitem nicht so makellos ist, wie sie gedacht haben. Der Roman verdeutlicht zu auf spannende Weise, wie Geschichte umgeschrieben und -gedeutet werden kann.
Nach "Watching The Clock" liefert Christopher L. Bennett einen weiteren sehr guten "Star Trek"-Roman um das "Department Of Temporal Investigations" ab. Ging es im ersten Band in erster Linie um die Zeitreisen an sich und den Kalten Krieg, der darum tobt, dreht sich im zweiten Band der Reihe alles um Geschichte. Die Agenten lernen anhand eines Zeitunfalls, dass die Zeitgeschichte der Föderation und vor allem des DTI selbst bei weitem nicht so makellos ist, wie sie gedacht haben. Der Roman verdeutlicht zu auf spannende Weise, wie Geschichte umgeschrieben und -gedeutet werden kann.Darüber hinaus beschäftigt sich Bennett a mit den Classic-Charakteren. Ihm gelingt es aber nicht, Scott und Kirk neue Facetten abzugewinnen. Spock und Sulu hingegen haben Auftritte, die man so nicht erwartet hat, die aber dennoch zu den Charakteren passen.
Die komplette Rezension zu dem gelungenen Roman ist auf Trekzone nachzulesen:
Star Trek: Department Of Temporal Investigations - Forgotten History (von Christopher L. Bennett)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
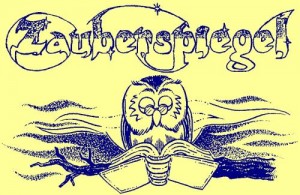
Am vergangenen Dienstag beschäftigte sich meine "Sternenfaust"-Kolumne auf dem Zauberspiegel mit der Frage, wer oder was wohl der "starke" Gegner Im Andromeda-Zyklus sein wird. Dabei wird auch die Frage behandelt, ob ein Zyklus wirklich immer einen großen, übermächtigen, nicht zu besiegenden Gegner benötigt, der am Ende klein ist,nichtmehr mächtig ist und besiegt wurde.
Schwache Gegner? Oder braucht es keinen Gegner?
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Auf Trekzone habe ich einen knappe Meldung über die "Star Trek"-Neuerscheinungen im Monat Juni verfasst. Der deutsche Verlag "Cross Cult" veröffentlicht unter anderem den von mir im Dezember rezensierten Roman "Das jüngste Gericht" in einer deutschen Ausgabe. Die komplette Meldung findet man hier.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
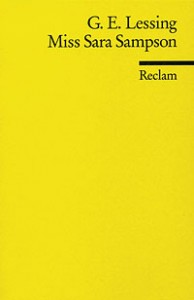 Die tugendhafte Sara Sampson ist mit ihrem Liebhaber Mellefont durchgebrannt und befindet sich auf dem Weg nach Frankreich. Sie möchte heiraten, Mellefont zweifelt und verschiebt die weitere Abreise mit dem Vorwand, auf eine Erbschaft zu warten. Zu Beginn des Stückes erreicht Saras Vater, Sir William Sampson, den Gasthof, in dem sie und Mellefont verweilen. Kurz darauf trifft auch Mellefonts ehemalige Geliebte Marwood mit der gemeinsamen unehelichen Tochter Arabella ein. Während Saras Vater ihr vergibt, versucht Marwood Mellefont erst zurückzuerobern, dann zu töten und als beides misslingt bemüht sie sich, Sara gegen Mellefont aufzubringen und vergiftet sie zum Schluss. Der verzweifelte, sich selbst die Schuld gebende Mellefont, der mittlerweile erkannt hat, dass er Sara tatsächlich liebt, bringt sich daraufhin um.
Die tugendhafte Sara Sampson ist mit ihrem Liebhaber Mellefont durchgebrannt und befindet sich auf dem Weg nach Frankreich. Sie möchte heiraten, Mellefont zweifelt und verschiebt die weitere Abreise mit dem Vorwand, auf eine Erbschaft zu warten. Zu Beginn des Stückes erreicht Saras Vater, Sir William Sampson, den Gasthof, in dem sie und Mellefont verweilen. Kurz darauf trifft auch Mellefonts ehemalige Geliebte Marwood mit der gemeinsamen unehelichen Tochter Arabella ein. Während Saras Vater ihr vergibt, versucht Marwood Mellefont erst zurückzuerobern, dann zu töten und als beides misslingt bemüht sie sich, Sara gegen Mellefont aufzubringen und vergiftet sie zum Schluss. Der verzweifelte, sich selbst die Schuld gebende Mellefont, der mittlerweile erkannt hat, dass er Sara tatsächlich liebt, bringt sich daraufhin um.Lessings „bürgerliches Trauerspiel“, das als erstes dieser Art gilt, trägt den Titel einer zerrissenen Hauptfigur. Sara Sampson wird von Mellefont in erster Linie für ihre Tugendhaftigkeit geliebt. Sie selbst sieht sich ebenfalls als tugendhaft und sieht es trotz der unangemessenen Flucht als nötig an, zu heiraten. Ihr Weltbild muss aber wanken, da sie ja mit ihrem Liebhaber durchgebrannt ist und damit ihren Vater schwer verletzt hat. Dadurch hat sie selbst das Gefühl, große Schuld auf sich geladen zu haben.
Auf den Leser wirkt das zunächst tragisch, da Mellefont dieses Opfer gar nicht zu schätzen scheint. Er wirkt zu Beginn als der Bösewicht des Stückes und man traut ihm nicht zu, dass er sich längerfristig an eine Person binden könnte. Das merkt dieser selbst und verzögert die Abreise und damit die Hochzeit.
Marwood wirkt gegenüber dem wankelmütigen Mellefont immerhin standfest. Sie wird zwar bei weitem nicht so tugendhaft wie Sara dargestellt, verfolgt aber ein klares Ziel: Mellefont. Dieser hat ihr übel mitgespielt und behandelt sie noch immer schlecht. So entreißt er ihr die gemeinsame Tochter, liebt diese über alles und bezeichnet sie gegenüber Marwood dennoch als Symbol deren Schande. Die Sympathien für Marwood verfliegen jedoch mit den Methoden, die sie wählt.
So versucht sie Mellefont zu töten und vergiftet zum Schluss Sara als sich ihr die Gelegenheit gibt. Dazwischen versucht sie in umfangreichen Dialogen und mit der Kontaktierung des Vaters die Beziehung zwischen Mellefont und Sara zu verhindern. Doch Mellefont und Sara erweisen sich als zu standfest und der Vater als zu gütig, als dass ihr Plan aufgehen könnte. Die bürgerlichen Werte, die ihre drei Kontrahenten verinnerlicht haben, lassen die Intrige im Sande verlaufen. Als sie erkennt, dass sie für sich keinen Erfolg haben wird, gönnt sie anderen kein Glück und greift zur Gewalt.
Das bietet Sara die Möglichkeit endgültig zur tragischen Person aufzusteigen. Ihr Fehler wurde ihr von ihrem Vater verziehen, alles schien gelöst und dann stirbt sie durch das Gift ihrer Nebenbuhlerin. Doch anstatt zornig zu werden, vertraut sie darauf, dass das Gewissen Marwood genügend quälen wird, Rache sei nicht nötig. Diese reife Entscheidung ist nach einem – häufig mit viel zu langen Dialogen ausgestatteten – Stück bewegend. Es ist somit nicht nur ein Stück, das allgemein die bürgerlichen Werte in den Mittelpunkt stellt, sondern zum Schluss vor allem das Gebot der Güte und Verzeihung betont.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Ein junges Paar heiratet und lädt sieben Gäste in die neue, kleine aber eigene Wohnung. Bei viel Essen und eben so viel Alkohol soll die Hochzeit gefeiert werden. Doch der Abend verläuft anders als geplant. Die typischen Familienstreitigkeiten brechen aus, das eingeladene Ehepaar stellt sich als streitlustig heraus und während der Sohn der Vermieter mit der Schwester der Braut anbandelt, brechen die vom Ehemann getischlerten Möbel aufgrund des schlecht gemischten Leim nacheinander auseinander.
Ein junges Paar heiratet und lädt sieben Gäste in die neue, kleine aber eigene Wohnung. Bei viel Essen und eben so viel Alkohol soll die Hochzeit gefeiert werden. Doch der Abend verläuft anders als geplant. Die typischen Familienstreitigkeiten brechen aus, das eingeladene Ehepaar stellt sich als streitlustig heraus und während der Sohn der Vermieter mit der Schwester der Braut anbandelt, brechen die vom Ehemann getischlerten Möbel aufgrund des schlecht gemischten Leim nacheinander auseinander.Die Bühne des Theaters kann nicht die enge einer kleinbürgerlichen Wohnung darstellen. Stattdessen wird zu Beginn des Stückes eine containergroße Wohnung aus dem Bühnenboden hochgefahren. Nur mit Mühe und Not passen die neun Schauspieler in das Zimmer mit den vielen Möbeln. Die gedrängte Atmosphäre ist somit nicht nur spürbar, sondern sofort ersichtlich. Das Zimmer ist beweglich, sodass es durch absenken oder schaukeln die Stimmung des Abends darstellen kann.
Obwohl der Raum viel zu klein ist und die Möbel hässlich, muss alles zu Beginn gelobt werden. Die Stimmung ist noch ausgezeichnet und der Stil gebietet frohe Worte. Lediglich eine verbitterte, aus unverständlichen Gründen mit der Familie befreundete Frau sprich von Anfang an all das aus, was eigentlich alle denken. Das wird zu dem Zeitpunkt jedoch noch von den Zoten des Bräutigamsvater übertönt.
Im Lauf des Abends stellt sich jedoch heraus, dass die Beziehungen zwischen allen Charakteren zerrüttet sind. Die Eltern des Bräutigams können ihre gegenseitigen Marotten nicht mehr ertragen. Die Braut ist von ihrer Schwester genervt, der Bräutigam von seinem besten Freund. Den Sohn der Vermieter, der die Schwester der Braut anmacht, möchte niemand eingeladen haben. Das befreundete Ehepaar sorgt ausschließlich für schlechte Stimmung da sich die Partner gegenseitig nur blamieren wollen. Und zuletzt stellt sich heraus, dass das Brautpaar nicht aus Liebe geheiratet hat, sondern nur um die Schmach einer unehelichen Schwangerschaft zu übertünchen.
Kurzum: Eigentlich ist nichts gut. Die zerfallenden Möbel deuten nur an, wie brüchig die kleinbürgerliche Fassade ist, die alle Beteiligten bis zum Schluss versuchen, aufrecht zu halten. Dabei wird häufig betont, wie wichtig doch die „deutsche“ Familie als Institution sei, obwohl die Runde zeigt, dass in vier beispielhaften Partnerschaften keine einzige dem Familienideal gerecht wird. Wirklichen Halt und Stabilität kann keine bieten.
Auf bitterböse Art wird also der bürgerliche Schein dekonstruiert. Das könnte lustig sein, ist es jedoch nur an wenigen Stellen. Es stechen vor allem die Eltern des Bräutigams hervor, die ausgezeichnet gespielt sind. Die anderen Rollen bleiben etwas blass, wirken meist übertrieben gespielt. Das sorgt – vielleicht gewollt – dafür, dass das Stück keine durchgehend lustige Satire ist.
Die Gäste verlassen am Ende eine völlig zerstörte Wohnung. Jeder am Anfang aufgekommene Spaß ist zu Ende. Die junge Ehefrau sorgt sich nicht um ihre Wohnung, sondern in erster Linie darum, dass die Gäste ihre „Schmach“ in die Welt hinaustragen und ihr das ewig anhängen wird. So wird zum Schluss deutlich, dass Kleinbürger zwar in kärglichen und unglücklichen Verhältnissen gefangen sind, Traditionen und Rituale sie aber daran hindern, ihrer Situation bewusst zu werden und den Unsinn um sie herum zu erkennen. Stattdessen sorgt das Netz an Wertvorstellungen dafür, dass sich die Verhältnisse nicht ändern. Das ist eine gute und interessante Botschaft, die aber einem eher anstrengenden als unterhaltsamen Theaterstück entspringt.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
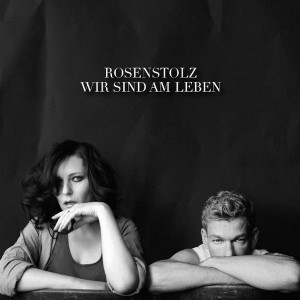 Das Lied hat keine erkennbaren Strophen in einem wiederkehrenden Rhythmus, was den Refrain sehr in den Mittelpunkt stellt. Der sagt aber nicht viel mehr aus, als dass eine Person, an Energie wartet und glaubt. In der zweiten Hälfte des Liedes kommt ein Kinderchor dazu, der endgültig von dem Text des Liedes ablenkt.
Das Lied hat keine erkennbaren Strophen in einem wiederkehrenden Rhythmus, was den Refrain sehr in den Mittelpunkt stellt. Der sagt aber nicht viel mehr aus, als dass eine Person, an Energie wartet und glaubt. In der zweiten Hälfte des Liedes kommt ein Kinderchor dazu, der endgültig von dem Text des Liedes ablenkt.Dabei ist die Grundidee gar nicht blöd und vielleicht die direkteste Anspielung auf Peter Plates Burnout-Erkrankung. Denn die englische Bezeichnung der Krankheit spielt ja darauf an, dass einfach keine Energie für den Alltag übrig ist.
Die ersten Zeilen zeigen, dass das Lied von einer Zweisamkeit ausgeht. Es gibt so viele schöne Worte / doch zu uns fiel mir keins ein / das war irgendwie bezeichnend / hab gedacht, das muss so sein. Diese scheint jedoch beendet zu sein, was bereits dadurch angedeutet wird, dass alle Aussagen im Präteritum formuliert sind. Die Gemeinsamkeit konnte nicht beschrieben werden, das wurde für normal gehalten und war wahrscheinlich einer der Gründe für das Scheitern.
Bereits die nächsten Zeilen sind dann eine reine Konzentration auf die eigenen Belange. Ich hab nichts mehr zu verschenken / Ich brauch den letzten Rest für mich. Das ist die Eröffnung, dass nun Zeit und Ruhe für die eigene Person gebraucht wird. Das fällt nicht leicht: Tut mir leid, ich kann nicht denken / nicht an Dich, nicht an mich. Die Situation ist also so verfahren oder so unbefriedigend, dass nicht einmal mehr die Zeit oder die Kraft bleibt, um über das eigene Wohlbefinden hinaus zu denken. Das eigene Leben muss erst geordnet werden, bevor an andere gedacht wird. Gleichzeitig deuten diese Zeilen auch an, dass die Situation so schwierig ist, dass an sich selbst ebenfalls nicht mehr gedacht werden kann.
Die Lösung wird im Refrain präsentiert. Das Zurückfahren der eigenen Aktivitäten, das konsequente Reduzieren aller Anstrengungen und das darauffolgende Warten auf Energie, also auf Kraft, sind die einzigen Optionen. Und ich schalt mich jetzt einfach aus / Und ich ziehe den Stecker raus / Und ich warte auf Energie / Glaube an Energie. Es bleibt also gar nichts anderes übrig, als innezuhalten und darauf zu hoffen, dass die Kraft wiederkehrt. Davon zeugt auch die zweite Refrainstrophe, die ähnlich ist, aber davon spricht, dass man sich stumm schalten muss und sich dabei ganz sicher nicht um drehen wird. Sie endet mit der Aussage: Ich bleibe stark und ich weiß auch wie / Ich glaube An Energie. Somit ist die einzige Möglichkeit während einer solchen Erschöpfungserscheinung stark zu bleiben, der starke Glaube daran, dass es besser werden kann.
Nach dem Refrain setzt der Kinderchor ein und buchstabiert das Wort Energie. Dabei fällt beim Aufbau des Liedes kaum auf, dass zu jedem Buchstaben ein Zusammenhang gesungen wird. Beim Hören klang es für mich eher wie eine Ansammlung zusammenhangsloser Worte. Doch wenn die Kinder zum ersten Mal E rufen heißt es für Ekstase und Exzentrik. Weiter geht es mit N – für ein Nein und nicht so schwer. So wird sich durch das ganze Wort Energie durchgearbeitet. Das ist vielleicht ein etwas alberner Einfall, aber durchaus sinnig. Denn neben den bereits zitierten Hinweisen, dass man auch mal über die Stränge schlagen muss, häufiger Nein sagen sollte, folgen noch die Ratschläge nicht alles an sich heranzulassen, sich auch mal Ruhe zu gönnen, gelassener durchs Leben zu gehen, auch mal Irrtümer und Idotien zu begehen und vor allem Euphorie erleben. Das ist ein schönes Konglomerat, das zusammen ist: ENERGIE und damit genau das, was fehlt, wenn man sich vom Leben erschöpft fühlt. Diese Ratschläge sind wohl nicht nur hilfreich, wenn man gerade an einem Burnout-Syndrom leidet, sondern allgemein nutzbar, wenn man von dem aktuellen Lebensalltag nicht zufrieden ist.
Abgerundet wird das Lied mit dem Hinweis: Bin zwar älter, doch nicht geläutert / Bin gefallen, doch nicht gescheitert. Dies ist ein kleines Plädoyer dafür, emotionale Schwächen auch zu zeigen und vor allem sich selbst gegenüber einzugestehen. Denn nur dadurch können Veränderungen erreicht werden. Das Lied endet mit der Entschuldigung aus der zweiten Strophe: Tut mir leid, ich will nicht denken / Nicht an Dich, nicht an mich. Gelegentlich nicht denken, sondern „nur“ leben – das ist ein wichtiger Bestandteil, der ENERGIE, die wir alle brauchen.
Leider ist die schöne Botschaft über den Umgang mit eigenen Ermüdungserscheinungen und den Auswegen daraus in ein Lied eingebettet, das den Text nicht leicht verständlich macht und sich zudem auch nicht angenehm zu hören ist.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

 "Nukleus" ist der bisher gelungenste Roman in diesem Zyklus. Die Sternenfaust-Besatzung steht vor der schwierigen Entscheidung, ob sie ihre Suche nach Akoluthoren und damit ihre Galaxis aufgibt, oder weiter Akoluthoren sammelt und damit ein ganzes Volk dem Untergang weiht.
"Nukleus" ist der bisher gelungenste Roman in diesem Zyklus. Die Sternenfaust-Besatzung steht vor der schwierigen Entscheidung, ob sie ihre Suche nach Akoluthoren und damit ihre Galaxis aufgibt, oder weiter Akoluthoren sammelt und damit ein ganzes Volk dem Untergang weiht.Die ganze Rezension zu dem gelungenen Roman findet man auf SF_Radio:
Sternenfaust Band 191 - Nukleus (von Thomas Höhl und Sascha Vennemann)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
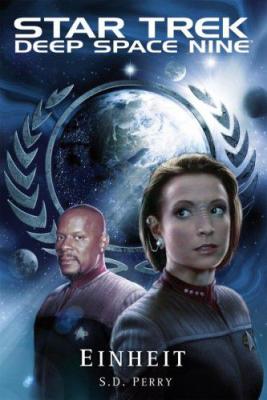 Bajor soll der Föderation beitreten. Doch kurz davor wird der bajoranische Premierminister Shakaar erschossen. Dabei stellt sich heraus, dass er von einem Parasiten beherrscht war. Auf Deep Space Nine bricht Panik aus, denn jeder kann von einem Parasiten kontrolliert sein. Auf diese Stimmung trifft die Defiant als sie von ihrer langen Mission im Gamma-Quadranten zurückkehrt.
Bajor soll der Föderation beitreten. Doch kurz davor wird der bajoranische Premierminister Shakaar erschossen. Dabei stellt sich heraus, dass er von einem Parasiten beherrscht war. Auf Deep Space Nine bricht Panik aus, denn jeder kann von einem Parasiten kontrolliert sein. Auf diese Stimmung trifft die Defiant als sie von ihrer langen Mission im Gamma-Quadranten zurückkehrt.Der Crew von Deep Space Nine bleibt nicht viel Zeit, um die Verbreitung der Parasiten aufzuhalte. Bei der Lösung des Problems müssen alle Charaktere ihre kleinen Problemchen bewältigen und mit Charakteren zusammenarbeiten, die man in der Serie gar nicht mehr erwartet hat.
Das alles sorgt für einen gelungenen Abschluss der achten "Deep Space Nine"-Staffel und der ersten Staffel, die konsequent in Roman-Form veröffentlicht wurde. Die komplette Rezension findet man auf Trekzone:
Star Trek Deep Space Nine: Einheit (von S.D. Perry)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

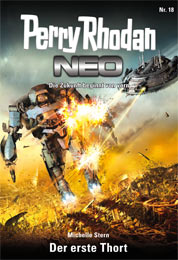 "Der erste Thort" zeigt, dass bei "Perry Rhodan Neo" doch ganze Geschichten erzählt werden können. Das ist für einen Augenblick nach der Lektüre angenehm überraschend, bis einem auffällt, dass die beiden erzählten Geschichten langweilig und vorhersehbar waren.
"Der erste Thort" zeigt, dass bei "Perry Rhodan Neo" doch ganze Geschichten erzählt werden können. Das ist für einen Augenblick nach der Lektüre angenehm überraschend, bis einem auffällt, dass die beiden erzählten Geschichten langweilig und vorhersehbar waren.Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Perry Rhodan Neo 18 - Der erste Thort (von Michelle Stern)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
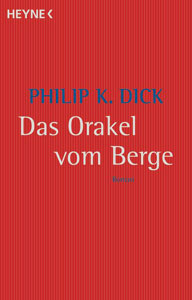 Der 1962 verfasste Roman spielt im selben Jahr in einer Alternativwelt. Die Achsenmächte haben den zweiten Weltkrieg gewonnen. Die Welt, insbesondere die USA, ist zwischen Japan und Deutschland aufgeteilt. Während das japanische Kaiserreich sich zu einem autokratischen, aber verhältnismäßig rechtsstaatlichen Regime gewandelt hat, treiben die Nazis weltweit ihr Unwesen. Nachdem sie den Völkermord an den Juden beendet haben, wandten sie sich Afrika zu, um nun zu den Sternen zu streben. Dabei nehmen die Spannungen zwischen den Nationalsozialisten und dem japanischen Kaiserreich immer weiter zu. Von alldem zunächst unbehelligt arbeiten Frank Frink und Robert Childan im japanisch besetzten Kalifornien. Weiße sind nur Bürger der zweiten Klasse, werden jedoch für ihre untergegangene Kultur geschätzt. Am meisten Geld verdient man daher mit dem Antiquitätenhandel, wobei die meisten "Antiquitäten" gefälscht sind. Zu Beginn der Handlung trifft der deutsche Agent Rudolf Wegener ein, der einen Angriff auf Japan verhindern möchte. Frinks Ex-Frau Julia trifft derweil im selbstverwalteten amerikanischen Süden auf einen Nazi-Agenten mit weniger guten Absichten.
Der 1962 verfasste Roman spielt im selben Jahr in einer Alternativwelt. Die Achsenmächte haben den zweiten Weltkrieg gewonnen. Die Welt, insbesondere die USA, ist zwischen Japan und Deutschland aufgeteilt. Während das japanische Kaiserreich sich zu einem autokratischen, aber verhältnismäßig rechtsstaatlichen Regime gewandelt hat, treiben die Nazis weltweit ihr Unwesen. Nachdem sie den Völkermord an den Juden beendet haben, wandten sie sich Afrika zu, um nun zu den Sternen zu streben. Dabei nehmen die Spannungen zwischen den Nationalsozialisten und dem japanischen Kaiserreich immer weiter zu. Von alldem zunächst unbehelligt arbeiten Frank Frink und Robert Childan im japanisch besetzten Kalifornien. Weiße sind nur Bürger der zweiten Klasse, werden jedoch für ihre untergegangene Kultur geschätzt. Am meisten Geld verdient man daher mit dem Antiquitätenhandel, wobei die meisten "Antiquitäten" gefälscht sind. Zu Beginn der Handlung trifft der deutsche Agent Rudolf Wegener ein, der einen Angriff auf Japan verhindern möchte. Frinks Ex-Frau Julia trifft derweil im selbstverwalteten amerikanischen Süden auf einen Nazi-Agenten mit weniger guten Absichten.Es geschieht wenig in Dicks Alternativweltroman. Die wichtigsten Ereignisse sind die Warnung vor dem drohenden Angriff der Nazis auf Japan und die Verhinderung eines Attentats durch Julia Frink. Trotz dieser Ereignisarmut liest sich der Roman fließend und spannend. Denn Dick zeigt einmal mehr, dass er eine komplexe Gesellschaft in knappen Augen entstehen lassen kann. Wenig wird erklärt, stattdessen kann der Leser sich aus dem Endergebnis den geschichtlichen Verlauf in der Alternativwelt zusammenreimen. Nur sporadisch werden Hinweise geliefert, woran die unterschiedliche Entwicklung zu unserer Welt liegen könnte. Es kristallisiert sich heraus, dass die fiktive Ermordung Franklin D. Roosevelts der Auslöser für die andere Entwicklung war.
Geschickt webt Dick einen Roman in seinen Roman. Unter dem Titel "Die Plage der Heuschrecke" veröffentlicht ein Südstaaten-Autor die Geschichte der siegreichen Alliierten. Jeder Charakter kommt in irgendeiner Form mit diesem Buch in Berührung, obwohl es von den Nazis verboten und von den Japanern nur toleriert wird. Dadurch erfährt der Leser Ausschnitte aus der Geschichte des Buches. Die Alliierten gewinnen zwar, aber die Geschichte nimmt dennoch einen anderen Verlauf. Großbritannien setzt sich in der nunmehr dritten Alternativwelt durch und lässt das britische Imperium wiederauferstehen. Dieser Version der Realität zeigt zum einen, dass die Bewohner einer japanisch-deutsch dominierten Welt sich keine pluralistisch-demokratische Weltordnung vorstellen können - denkt man heute. Denn 1962 bestand in der west-ost-Konfrontation ja noch die realistische Gefahr eines dritten Weltkrieges. Letztlich spielt Dick hier also mit verschiedenen Blockmöglichkeiten.
Erwähnenswert ist die wiederholte Rolle des titelgebenden Orakels. Hier stellt sich gegen Ende heraus, dass dessen Tipps das Buch "Die Plage der Heuschrecke" ermöglicht haben. Das große Vertrauen der Japaner und der Bürger in den von ihnen besetzten Gebieten in das Orakel ist beachtlich, fast alle Charaktere benutzen es als Grundlage für ihre Entscheidungen.
Der Roman ist zusätzlich berührend, weil er Amerikaner in einer unterdrückten Rolle zeigt. Das ist man sonst nicht gewöhnt. Die Besatzungsregime sind dabei so gesichert, dass niemand an Widerstand zu denken scheint. Es wird von keinem Charakter daran gedacht oder davon berichtet. Zwar gibt es nach der Lektüre der "Plage der Heuschrecken" durchaus Gedanken darüber, ob der jetzige Zustand richtig ist. Aktionen werden aber keine geplant. Auch gegen die Deutschen Verbrechen regt sich kein Widerstand. Das Reich leidet trotz seiner geographischen Stärke und seiner technologischen Übermacht an Führungsquerelen und einer schwachen Wirtschaft. Das nutzen aber weder die Japaner noch Widerstandsgruppen. Das Grauen muss akzeptiert werden, die Bürger der Erde arrangieren sich damit. Im Vergleich dazu wirkt das Japanische Kaiserreich wie ein Hort der Toleranz. Die japanischen Besatzer, mit ihrer Begeisterung für die untergegangene amerikanische Kultur wirken fast ein wenig niedlich. Das ist erschreckend, schließlich war das Kaiserreich ebenfalls für viele Verbrechen verantwortlich.
Interessant ist eine Szene, in der ein japanischer Firmenchef sich im Wahn unsere heutige Welt vorstellt. Die vielen Autos, die in der Welt des "Orakel vom Berge" durch Raketen ersetzt sind, und die weiße amerikanische Mehrheitsgesellschaft sorgen bei ihm für ein schreckliches Bild von unserer Realität.
Philip K. Dick zeigt mit "Das Orakel vom Berge", welches schlimme Schicksal die Menschheit erlitten hätte, hätten die Alliierten den zweiten Weltkrieg nicht gewonnen. Das ist noch keine Leistung, die knappe, dennoch komplex und realistisch wirkende Darstellung zusammen mit der erschreckenden Darstellung der angepassten, relativ gut lebenden und jeder Möglichkeit des Widerstand beraubten Amerikaner machen den Roman sehr lesenswert.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
