... neuere Einträge
Die fünfte Gewalt - Lobbyismus in Deutschland (von Thomas Leif und Rudolf Speth (Hrsg.))
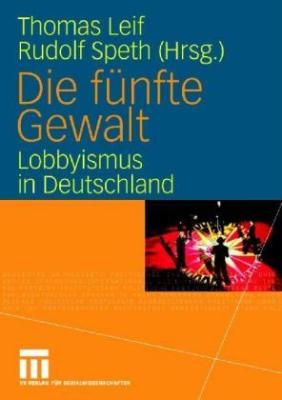 Lobbyismus als fünfte Gewalt im Staat - der Sammelband titelt bereits mit einer provokanten, nahezu populistischen These. Die gewählte Zahl (fünf) deutet darauf hin, dass die Medien bereits als gesetzte Macht neben den drei klassischen Regierungsgewalten gesehen werden. Mit dem Titel liefert der Band aber auch seine Existenzberechtigung: Lobbyismus hat - so die Autoren - in Deutschland einen hohen Stellenwert erreicht, der eine wissenschaftliche Betrachtung sinnvoll macht.
Lobbyismus als fünfte Gewalt im Staat - der Sammelband titelt bereits mit einer provokanten, nahezu populistischen These. Die gewählte Zahl (fünf) deutet darauf hin, dass die Medien bereits als gesetzte Macht neben den drei klassischen Regierungsgewalten gesehen werden. Mit dem Titel liefert der Band aber auch seine Existenzberechtigung: Lobbyismus hat - so die Autoren - in Deutschland einen hohen Stellenwert erreicht, der eine wissenschaftliche Betrachtung sinnvoll macht.Die Betrachtung erfolgt in drei Schritten. Zunächst wird das Wesen des Lobbyismus reflektiert, positiv und negativ betrachtet. In einem zweiten Abschnitt wird dann "der Lobbyist" in den Fokus gerückt. Hier finden sich auch zwei Interviews mit Vertretern aus der Praxis. Im letzten und längsten Teil werden nacheinander verschiedenene Institutionen mit Lobbyaktivitäten (Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, Kirchen) betrachtet und danach Anbieter wie Agenturen ins Augenschein nimmt. Der Band wird mit einigen knappen Thesen zur weiteren Entwicklung beziehungsweise zur notwendigen Regulierung der Lobbyaktivitäten abgerundet.
Vor- und Nachteil des Sammelbandes ist der Mix der Beiträge. Einerseits gibt es wissenschaftliche Ansätze, andererseits aber auch journalistische Beiträge. Das ist gut und dient vor allem der Leserbarkeit. Häufig geht der Band aber zu journalistisch vor. Das große Ganze wird nach den ersten beiden Abschnitten aus dem Auge verloren. Danach bietet der Band hauptsächlich Überblicksbeiträge zu einzelnen Politikfeldern. Dabei sind ausgerechnet die unkonkretesten Beiträge (die zur Gesundheitsreform) die beeindruckendsten. Hier entsteht nämlich das Gefühl einer mächtigen Lobby. Wo die Aufsätze aber konkrete Informationen über die lobbyierenden Verbände haben, entsteht der Eindruck schwächelnder Institutionen (z.B. Wirtschaftsverbände, Gewerkschaften, ADAC, Kirchen). Hier ist vor allem interessant, wie die Institutionen mit ihrer jeweiligen, spezifischen Organisationsform ihren Einfluss ausspielen. Das ist lehrreich, widerspricht aber der panischen These der fünften Gewalt.
Leider ist der zweite Abschnitt über "die Lobbyisten" sehr dünn. Hier werden keine Überblicke über einzelne Lobbyfelder dargelegt, sondern die Mentalität der Branche soll dem Leser näher gebracht werden. Das beginnt mit einem arg journalistischen, inhaltlich dünnen Einstieg von Hajo Schumacher und bietet erst zum Schluss mit einem Beitrag über das Lobbying in Brüssel mit einem spannenden Aufsatz. Denn dass der Wechsel zwischen Politik und Lobby schwierig ist, düfte vorher bereits bekannt sein und auch die Rolle der MInisterialbürokratie bei dem Lobbyprozess ist kein Wunder. Die zwei ausführlichen Interviews mit Vertretern der Branche bringen ebenfalls keine wirklich neuen Erkenntnisse. Das ist aber klar, schließlich werden Lobbyisten nicht selbst für einen Skandal sorgen.
Der Sammelband bietet insgesamt eine wenig wissenschaftliche Betrachtung des Themas. Abgesehen vom ersten Teil (zu der die pro-kontra-Betrachtung gerade noch gezählt werden kann) bietet er eher Überblicksbeiträge zu einigen Thesen. Langfristige Auswirkungen, Legitimtiätsfragen und ähnliches werden dabei nur am Rande diskutiert. Die Thesen zur weiteren Entwicklung beziehungsweise zur notwendigen Reaktion am Ende wirken lieblos. Aufgrund der bemühten Aktualität, wirkt vieles mittlerweile veraltet (erschien bereits 2006). Auch das zeigt, dass eine stärkere allgemeinere Auseinandersetzung mit dem Thema, dem Buch gut getan hätte. Die wirkliche Stärke des Bandes sind daher die Beiträge über die Arbeit einzelner Verbände. Auch wenn hier häufig eher journalistisch als wissenschaftlich gearbeitet wird, erhält man doch einen ersten Einblick in die unterschiedliche Arbeitsweise unterschiedlicher Verbände.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Infektion (von John Gregory Betancourt)

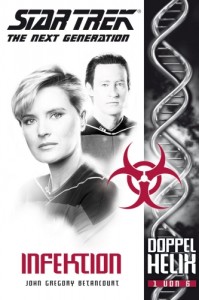 "Infektion" ist der erste Roman der sechsbändigen "Doppelhelix"-Reihe, die zur Zeit der "Next Generation"-Crew spielt. Der erste Roman setzt in der ersten Staffel der Serie ein. Auf Archaia III, einem Planeten, auf dem Menschen noch zu rassistischen Denkmustern in der Lage sind, tötet eine Seuche alle Wesen, die aus einer Verbindung unterschiedlicher Spezies entstanden sind.
"Infektion" ist der erste Roman der sechsbändigen "Doppelhelix"-Reihe, die zur Zeit der "Next Generation"-Crew spielt. Der erste Roman setzt in der ersten Staffel der Serie ein. Auf Archaia III, einem Planeten, auf dem Menschen noch zu rassistischen Denkmustern in der Lage sind, tötet eine Seuche alle Wesen, die aus einer Verbindung unterschiedlicher Spezies entstanden sind.Der Roman liest sich wie ein Prolog. Der Krankheitsausbruch ist nämlich lediglich ein perfider Test einer fremden Macht. Damit verrät man nicht zu viel: Diese Tatsache wird im ersten Kapitel enthüllt. Das ist leider etwas früh und nimmt dem Roman viel Spannung.
Die komplette Rezension kann man auf Trekzone nachlesen:
Star Trek Next Generation: Doppelhelix Band 1 - Infektion (von John Gregory Betancourt)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Die Zisternen der Zeit

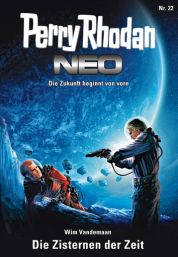 "Die Zisternen der Zeit" ist das fünfte Zeitreiseabenteuer in der mittlerweile sechsbändigen Staffel. Der Aufbau des Romans ähnelt dabei den vorherigen Zeitreisen, auf Überraschungen wird weitestgehend verzichtet. Das liest sich so langatmig und unaufgeregt wie die vorherigen Romane.
"Die Zisternen der Zeit" ist das fünfte Zeitreiseabenteuer in der mittlerweile sechsbändigen Staffel. Der Aufbau des Romans ähnelt dabei den vorherigen Zeitreisen, auf Überraschungen wird weitestgehend verzichtet. Das liest sich so langatmig und unaufgeregt wie die vorherigen Romane.Auch der sechste Band der Staffel kann also keinen neuen Impuls setzen, geschweige denn die Handlung voran bringen. Es läuft also alles darauf hinaus, dass im Finale, die seit Band 19 stagnierenden Handlungsstränge abgeschlossen werden. Es bleibt abzuwarten, ob das dann einem übereilten Bericht ähnelt, um noch etwas Handlungsmasse in die Staffel zu bekommen oder ob das wenigstens zu einer spannenden Geschichte führt.
Perry Rhodan Neo Band 22 - Zisternen der Zeit (von Wim Vandemaan)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Fehlinterpretation: Piratenpartei vergisst nur ihre Wurzeln nicht
Damit Politik der breiten Maße zugänglich gemacht werden kann, muss sie zugespitzt werden. Selbst wenn Parteien und Politiker sich um differenzierte Positionen bemühen, wird die Zuspitzung ihnen von den Medien abgenommen werden. Abweichende Ansichten oder Taten zum vermeintlichen "Oberziel" der Partei, werden rasch als Verrat an den Idealen angeprangert und sind dann äußerst schwer zu kommunizieren. Das durfte die Piratenpartei in Niedersachsen Anfang der Woche erleben. In einer unglücklich formulierten Pressemitteilung entstand der Eindruck, die Partei werde auf dem anstehenden Parteitag Kameras und Mikrofone nur in einem kleinen, begrenzten Bereich erlauben. Damit sollte die Basis vor aufdringlichen Video- und Tonjournalisten geschützt werden. In Wirklichkeit handelte es sich jedoch um eine kleine, abgegrenzte Zone, in der Kameras und Mikrofone nicht erlaubt sind. Das mag spitzfindig sein, ist aber ein Unterschied. Nicht aber für die Presse: Hier wurde einhellig darauf hingewiesen, dass dieser Wunsch mit der Forderung nach Transparenz nicht vereinbar sei. Das ist einmal mehr äußerst zugespitzt.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Hiob (von Joseph Roth)
 Mendel Singer ist ein gottesfürchtiger jüdischer Lehrer in Russland. Sein Gehalt reicht kaum aus, um sich, seine Frau und seine drei Kinder zu ernähren. Sein Glaube gibt ihm Halt, er ist mit seinem Leben zufrieden. Ein Unglück bahnt sich jedoch an, als sein viertes Kind, Menuchim, mit geistigen und körperlichen Gebrechen geboren wird und einfach nicht anfangen möchte zu reden. Mendel sieht es als eine Strafe Gottes, glaubt gottesfürchtiger werden zu müssen. Äußere Hilfe, von Ärzten oder Rabbinern lehnt er ab. Dadurch entfremdet er sich von seiner Frau. Im Folgenden wird sein ältester Sohn zum Militär eingezogen, sein zweiter Sohn desertiert nach Amerika und seine Tochter beginnt ein Verhältnis mit einem Kosaken. Das veranlasst ihn, mit der Familie (ohne seinen eingezogenen Sohn und Menuchim) ebenfalls nach Amerika zu ziehen. Dort lebt er zunächst von den Gewinnen seines zweiten Sohnes, alles scheint gut zu werden. Seine Tochter lebt allerdings ein immer nymphomaneres Leben. Mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges fällt seine Welt endgültig zusammen. Sein erster Sohn wird an der Ostfront vermisst, sein zweiter fällt an der Westfront. Seine Frau stirbt, seine Tochter wird verrückt. Dadurch wendet sich Mendel von Gott ab, bis ihn ein Wunder wieder auf den rechten Weg bringt.
Mendel Singer ist ein gottesfürchtiger jüdischer Lehrer in Russland. Sein Gehalt reicht kaum aus, um sich, seine Frau und seine drei Kinder zu ernähren. Sein Glaube gibt ihm Halt, er ist mit seinem Leben zufrieden. Ein Unglück bahnt sich jedoch an, als sein viertes Kind, Menuchim, mit geistigen und körperlichen Gebrechen geboren wird und einfach nicht anfangen möchte zu reden. Mendel sieht es als eine Strafe Gottes, glaubt gottesfürchtiger werden zu müssen. Äußere Hilfe, von Ärzten oder Rabbinern lehnt er ab. Dadurch entfremdet er sich von seiner Frau. Im Folgenden wird sein ältester Sohn zum Militär eingezogen, sein zweiter Sohn desertiert nach Amerika und seine Tochter beginnt ein Verhältnis mit einem Kosaken. Das veranlasst ihn, mit der Familie (ohne seinen eingezogenen Sohn und Menuchim) ebenfalls nach Amerika zu ziehen. Dort lebt er zunächst von den Gewinnen seines zweiten Sohnes, alles scheint gut zu werden. Seine Tochter lebt allerdings ein immer nymphomaneres Leben. Mit dem Ausbruch des ersten Weltkrieges fällt seine Welt endgültig zusammen. Sein erster Sohn wird an der Ostfront vermisst, sein zweiter fällt an der Westfront. Seine Frau stirbt, seine Tochter wird verrückt. Dadurch wendet sich Mendel von Gott ab, bis ihn ein Wunder wieder auf den rechten Weg bringt.Der Titel des Romans macht bereits klar, dass Mendel Singer viel Leid erfahren muss. Der Name Hiob verweist aber auch auf das göttliche Wunder, das am Ende vieles wieder zum Guten fügt. Für die Geschichte ist der Zusatz des Romanes - „Roman eines einfachen Mannes“ - wichtig. Mendel ist zu Beginn des Romans mit seinem Leben zufrieden. Er strebt nach nichts Höherem als das, was Gott ihm zugesteht. Lange verharrt er in der resignierten Haltung, obwohl ihm bereits viel Unrecht geschieht. Sein Schicksal steht dabei stellvertretend für viele osteuropäische Juden, die der Armut durch Auswanderung entfliehen wollen. In Amerika stehen sie vor der Frage der Assimilation oder des Fliehens in eine Parallelgesellschaft. Mendels Sohn übernimmt die amerikanische Kultur und legt seinen jüdischen Hintergrund samt Namen ab. Für die Vereinigten Staaten zieht er sogar in den Krieg. Mendel wiederum lernt nicht einmal englisch, sondern beschränkt seinen Umgang rein auf die Bewohner des jüdischen Viertels.Für ihn ist Amerika eben so wenig ein Land, in dem er sich selbst verwirklichen kann, wie Russland.
Der Roman wirkt als sei er in der schlichten Denkweise Mendels geschrieben. Dabei hat der beinahe allwissende Erzähler durchaus Einblicke in die Gedankenwelt anderer Charaktere wie Mendels Frau Deborah oder seiner Tochter Miriam. Das erzeugt einen angenehmen Ton, der die Katastrophen auf der einen Seite erträglich macht, in seiner Toleranz und Ergebenheit aber Widerstand im Leser erweckt. Dabei sind die Schicksalsschläge der Frauen und Menuchims kaum verhinderbar, während die beiden erstgeborenen Söhne durch das Fehlverhalten einer ganzen Zivilisation im Weltkrieg untergehen.
Das Wunder zum Schluss ist dann ein simples Ende, was dem auf eine biblische Vorlage anspielenden Titel Rechnung trägt. Der 1930 erschienene Roman verdeutlicht das harte Leben osteuropäischer Juden in Osteuropa und in Amerika. Dabei wird das erste Leben als kärglich aber heimelig, das zweite als reicher, aber wurzelloser beschrieben. Tragischerweise weiß man, dass gerade einmal etwas mehr als ein Jahrzehnt nach dem Erscheinen des Romans die osteuropäische jüdische Kultur von den Nazis beinahe ausgerottet wurde. War das Leben einfacher Männer bereits vorher beschwerlich, wartete kein Wunder, sondern das grausamste Verhalten, das je von Menschen begangen wurde.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gesehen: I'll try to fix you (The Newsroom Folge 4)
Irritiert durch die langfristige Bindung seiner Ex-Freundin und Produzentin MacKenzie McHale, beginnt Moderator Will McAvoy verschiedene Frauen zu daten. Er gerät jedoch ausschließlich an Klatsch-Kolumnistinnen, seine misslungenen Versuche, diese zum "richtigen Journalismus" zu bekehren, enden in peinlichen Szenen und Artikeln in Boulevard-Blättern. Recht schnell wird deutlich: Hier versucht jemand McAvoy zu schaden. Derweil versucht Don seine Freundin Maggie dazu zu bringen, seinen potentiellen Konkurrenten Jim mit ihrer Zimmernachbarin zu verkuppeln. Das Team findet erst wieder zu Hochleistung zusammen als die Kongressabgeordnete Giffords angeschossen wird. So kommt es zu einem Moment, in dem sogar der zwielichtige Don sich als wirklicher Nachrichtenmacher beweisen kann.
Die vierte Episode der Serie offenbart einmal mehr ihre Charakterschwäche. Es wirkt schlicht albern, wie verzweifelt McAvoy sich mit Frauen trifft. Jeden Tag eine andere und dennoch versucht er jede mit seinen Tiraden gegen Boulevard-Journalismus zu überzeugen. Dabei müsste auch er merken, dass er dabei keinerlei Erfolg hat. Seine Position ist zwar sympathisch, seine Herangehensweise wirkt in diesem Rahmen aber albern und leider unrealistisch. Außerdem weiß der Zuschauer längst davon, dass sich eine Medienkampagne gegen McAvoy anbahnt. Die Enthüllung am Schluss ist damit keine Enthüllung.
Auch die zweite Date-Handlung um Maggie und Jim weiß nicht ganz zu überzeugen. Es ist von Anfang an offensichtlich, dass Maggie sich zu Jim hingezogen fühlt, aber mit Don zusammen ist. Das will sie sich nicht eingestehen, Don aber merkt es. Also setzt er alles daran, dass Jim ebenfalls vergeben ist, um ihn als Konkurrenten auszuschalten. Das gelingt, was zu einem Streit zwischen Maggie und Jim führt. Irritierenderweise sorgt das für den ersten überzeugenden Moment zwischen den beiden Schauspielern, obwohl diese Handlung von Grund auf albern ist.
Ironischerweise ist es ausgerechnet der Klatsch und Tratsch, den McAvoy in dieser Folge anprangert, der den Großteil der Episode trägt. Und das ist schade. Viel interessanter wäre eine Handlung gewesen, in der die Bemühungen der Sendungsleitung, Wills Image zu beschmutzen, verhindert werden. Dafür hätte die Schmutzkampagne jedoch gestrafft werden müssen. Natürlich braucht die Serie Charaktere, die sie tragen und es ist richtig, diesen viel Zeit einzuräumen. Doch das sollte nicht immer nur mit Klatsch-Geschichten geschehen. Viel interessanter sind die Momente, in denen Jim oder Maggie eine interessante, bisher zu wenig beachtete Geschichte zutage fördern. Auch könnte Wills Einsamkeit besser behandelt werden, als durch permanente Dates.
Denn dieser Teil der Folge überzeugt wieder einmal. Das Team nimmt sich zu Beginn des neuen Jahres Zeit für Geschichten, die im vorherigen zu stark vernachlässigt worden. Da reale Ereignisse aufgegriffen werden, sind diese Handlungen nicht nur unterhaltsam, sondern auch lehrreich. Der Einblick in die Entstehung der Berichte, ist ebenfalls sehr spannend. Interessant ist zudem, dass die in der vorherigen Episode erwähnte Vertragspassage Wills, dass er nach seiner Kündigung drei Jahre nicht mehr im Fernsehen auftreten darf, erst durch seine Neuverhandlung zu Beginn der Serie entstanden ist. Dass er MacKenzie am Ende jeder Woche kündigen könnte, hat er mit dieser Regelung bezahlen müssen. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Jetzt sind die beiden nämlich auf Gedeih und Verderb auf einander angewiesen. Scheitert die Sendung, kann Will MacKenzie feuern. Doch sollte er selbst damit eingeholt werden, ist seine Fernsehkarriere ebenfalls beendet.
Außerdem ist der Schluss der Episode sehr gelungen. Denn alle großen Nachrichtensender melden den Tod der Kongressabgeordneten Gifford. MacKenzie und ihr Redaktionsteam weigern sich aber, das herauszugeben, solange keine eindeutigen Beweise vorliegen. Da greift die Sendungsleitung zum ersten Mal direkt in die Sendung ein und verlangt, den Tod der Abgeordneten zu melden. Die Verantwortlichen haben nämlich Angst, zu viele Zuschauer an andere Sender zu verlieren. Will McAvoy bleibt überraschenderweise - er hat schließlich gerade erst erfahren, dass die Leitung ihn am liebsten sofort kündigen würde und er danach nicht mehr im Fernsehen auftreten darf - hart und wird von Don, ebenfalls überaschenderweise, darin bestärkt. Der Lauf der Dinge gibt ihm Recht: Giffords lebt, News Night hat als einzige große Sendung das Richtige berichtet. Bei diesem gelungenen Schluss ist es aber wieder einmal hinderlich, dass der informierte Zuschauer bereits weiß, dass Will McAvoy und sein Team Recht haben. Wahre Fälle sind natürlich nett, aber sie reduzieren die Spannung doch ein wenig.
Wieder einmal können die Charakterszenen, diesemal die inszenierte Schmutzkampagne und die Kupplungsbemühungen Dons, nicht ganz überzeugen. Aber immerhin gibt es Verbesserungstendenzen, vor allem zwischen Jim und Maggie. Außerdem wird die Episode auch diesmal wieder von der klugen Nachrichten-Handlung und der Rahmenhandlung um die Zusammenhänge von Wills Vertrag gerettet. Das hebt die Episode auf ein insgesamt knapp gutes Niveau.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gehört: Wir sind am Leben (Rosenstolz-Album)
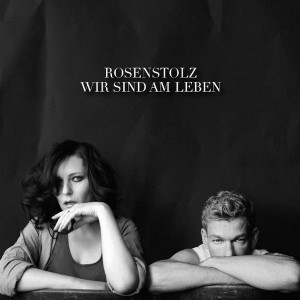 Nachdem ich mir, von der ersten bis zur letzten Liedrezension des Album vergingen über neun Monate, genügend Zeit für einen Gesamteindruck des im September erschienenen, aktuellsten Rosenstolz-Album genommen habe, kann ich für mich sagen: Das Album ist gut und hat an einigen Stellen das Potential sehr gut zu sein. Der erste Eindruck allerdings war ein ganz anderer.
Nachdem ich mir, von der ersten bis zur letzten Liedrezension des Album vergingen über neun Monate, genügend Zeit für einen Gesamteindruck des im September erschienenen, aktuellsten Rosenstolz-Album genommen habe, kann ich für mich sagen: Das Album ist gut und hat an einigen Stellen das Potential sehr gut zu sein. Der erste Eindruck allerdings war ein ganz anderer."Wir sind am Leben", das erste Lied, war als Single bekannt. "Überdosis Glück" und "Lied von den Vergessenen" hören sich gut an, sind beim ersten Mal Hören textlich aber unansprechend. Das erste Highlicht war "Sprachlos", das sprachlich schön und textlich gut daherkommt. Den Tiefpunkt des Albums markierte beim Ersthören "Mein Leben im Aschenbecher", ein Eindruck, der sich bis heute nicht geändert hat. Der darauf folgende Mittelteil des Albums wirkt zunächst unbedeutend, ja fast unsinnig. "Marilyn" und "Wir küssen Amok" haben kaum Höhen und Tiefen, die einen Aufhorchen ließen. "E.N.E.R.G.I.E." klingt wiederum so schräg, dass das nachfolgende, rhythmisch monotone "Flugzeug" geradezu beruhigend wirkt. Textlich wirken die ersten drei Mittelteillieder zunächst unsinnig, das letzte banal. Die abschließenden beiden Lieder "Irgendwo in Berlin" und "Beautiful" ließen jedoch einen ordentlichen Eindruck zurück, wobei die "Make it beautiful now"-Wiederholungen am Schluss etwas langatmig wirkten. Insgesamt war der erste Eindruck aber äußerst ernüchternd. Nach dem genialen Vorgänger, der zudem auch noch eingängige Lieder aufweist, ist "Wir sind am Leben" doch zunächst ernüchternd.
Dieser Eindruck hat sich freilich gewandelt. Die Rezensionen belegen das. Zwar dominiert das Burnout-Thema das Album und einige Lieder behandeln es wohl zu intensiv, aber an vielen Stellen ist das Wissen um Peter Plates Erkrankung erst der Schlüssel um die durchaus interessanten Botschaften der Lieder zu verstehen. Gerade der mittlere Teil bietet an vielen Stellen durchaus nachdenkenswerte und gelegentlich sogar erhellende Texte. Die zu Beginn etwas unaufregend wirkenden Lieder "Überdosis Glück" und "Lied von den Vergessenen" wirken mit der Zeit sogar schmissig und unterhaltsam. Vor allem aber reift das Ende. Herausragend ist dabei das Ende. "Beautiful" ist eines der Lieder, die mit jedem Mal hören besser und intensiver zu werden scheinen. "Wir sind am Leben" ist also eines jener Alben, das leicht zu unterschätzen ist. Die Lieder sind entweder zu eingängig, sodass sie unbeachtet durchlaufen oder aber zu sperrig, sodass sie nicht auf den ersten Höhranlauf gefallen. Dabei bietet das Album eine große Bandbreite von nachdenklich-traurigen, über sehnsüchtige bis hin zu fröhlichen, gar motivierenden Texten. Erst mehrmaliges, intensiveres Hören lässt die Eigenschaften der einzelnen Tracks zutage treten, sodass das Album geschätzt werden kann. Wer dazu bereit ist, etwas Rosenstolz-Affinität und eine gewisse Toleranz für das Burnout-Thema mitbringt, für den ist "Wir sind am Leben" ein gutes, mitunter gar sehr gutes Album.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Mappus und ENBW: Späte Aufregung
Aus Baden-Württemberg erreichte in den letzten Wochen und Monaten vor allem die Aufarbeitung um den EnBW-Kauf des ehemaligen Ministerpräsidenten Mappus die Bundespresse. Der einhellige Tenor ist, dass der Deal ein Geschmäckle hat. Es wird von Begünstigung und Steuergeldverschwendung geredet. Dazu kommen pikante Informationen wie der Hinweis eines Beteiligten, Stefan Mappus könne mit seinen "Truppen" der Kanzlerin gefährlich werden. Das alles ist reichlich unangenehm für den CDU-Landesverband in Baden-Württemberg, der sich als größte Oppositionspartei gerne mit voller Kraft auf die Pannen der neuen Regierungskonstellation grün-rot stürzen würde. Das lassen die Medien aber nicht zu. CDU-Vertreter müssen sich fragen lassen, wie Mappus den Deal quasi im Alleingang abwickeln konnte und warum die CDU jemanden wie Mappus überhaupt zum Ministerpräsidenten gemacht hat.
Dieses Trommelfeuer an “investigativen” Fragen ist äußerst scheinheilig. Denn alle diese Fragen hätten bereits Anfang 2011 gestellt werden müssen.mehr
Dieses Trommelfeuer an “investigativen” Fragen ist äußerst scheinheilig. Denn alle diese Fragen hätten bereits Anfang 2011 gestellt werden müssen.mehr
Permalink (2 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Die Delta-Anomalie (von Rick Barba)

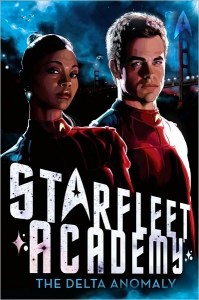 "Die Delta-Anomalie" ist der Beginn einer "Star Trek"-Jugendbuchserie, die in der alternativen Zeitlinie des letzten "Star Trek"-Films spielt. Dementsprechend ist auch der Aufbau des Buches: Wenig Seiten, große Schrift, kurze Sätze. Das sorgt für hohes Lesetempo, die Komplexität der Handlung leidet aber automatisch darunter. Dennoch gelingt es dem Autor, trotz einiger konzeptioneller Schwächen, den ein oder anderen interessanten Aspekt aus der Handlung herauszuarbeiten.
"Die Delta-Anomalie" ist der Beginn einer "Star Trek"-Jugendbuchserie, die in der alternativen Zeitlinie des letzten "Star Trek"-Films spielt. Dementsprechend ist auch der Aufbau des Buches: Wenig Seiten, große Schrift, kurze Sätze. Das sorgt für hohes Lesetempo, die Komplexität der Handlung leidet aber automatisch darunter. Dennoch gelingt es dem Autor, trotz einiger konzeptioneller Schwächen, den ein oder anderen interessanten Aspekt aus der Handlung herauszuarbeiten.Die komplette Rezension ist auf Trekzone nachzulesen:
Starfleet Academy - Die Delta-Anomalie (von Rick Barba)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Der Hüter des Krinoi'i

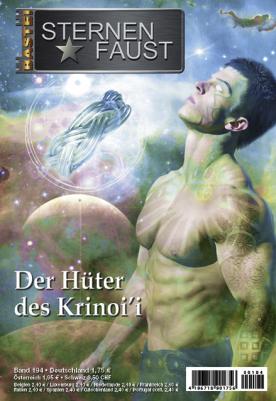 Mit "Der Hüter des Krinoi'i" steigt Mara Laue nach langer Zeit wieder als Autorin in die Serie "Sternenfaust" ein. Mara Laue schrieb einst im Schnitt jeden dritten Roman der Serie und war besonders gut darin, fremde Völker auf engem Raum zu beschreiben. Vielleicht auch um dieses Klischee zu wiederlegen, glänzt der Roman nicht mit einem neuen Volk, sondern mit einem alten und dem Innenleben der Sternenfaust-Besatzung. Denn im Gegensatz zu der etwas konventionellen Haupthandlung wissen die Nebenstränge um Verwandte der Shisheni und desillusionierte und diskriminierte Sternenfaust-Mitglieder wirklich zu überzeugen.
Mit "Der Hüter des Krinoi'i" steigt Mara Laue nach langer Zeit wieder als Autorin in die Serie "Sternenfaust" ein. Mara Laue schrieb einst im Schnitt jeden dritten Roman der Serie und war besonders gut darin, fremde Völker auf engem Raum zu beschreiben. Vielleicht auch um dieses Klischee zu wiederlegen, glänzt der Roman nicht mit einem neuen Volk, sondern mit einem alten und dem Innenleben der Sternenfaust-Besatzung. Denn im Gegensatz zu der etwas konventionellen Haupthandlung wissen die Nebenstränge um Verwandte der Shisheni und desillusionierte und diskriminierte Sternenfaust-Mitglieder wirklich zu überzeugen.Die komplette Rezension ist auf SF-Radio nachzulesen:
Sternenfaust Band 194 - Der Hüter des Krinoi'i (von Mara Laue)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gesehen: The 112th Congress (The Newsroom Folge 3)
Will McAvoy, Moderator der Nachrichtensendung News Night, entschuldigt sich zu Beginn der Episode in einem Editorial dafür, zu lange oberflächliche Nachrichten produziert zu haben. Im Nachgang geht er, als Republikaner, hart gegen den Populismus der "Tea Party"-Bewegung vor und versucht, für einen seriösen Konservatismus einzutreten. Das wird in der Firmenzentrale äußerst kritisch gesehen, der Verantwortliche für die Nachrichtensendung, Charlie Skinner, bekommt das deutlich zu spüren. Im Hintergrund menschelt es in der Redaktion: Wills viele Dates regen seine Ex-Freundin und Produzentin MacKenzie auf, obwohl sie selbst wieder in einer Beziehung ist. Der zweite Produzent Jim, hilft der Journalistin Maggie zwar in einer Notsituation, in der sie von ihrem Freund im Stich gelassen wird. Das reicht jedoch nicht aus, um sie davon zu überzeugen, sich endgültig von ihm zu trennen.
Der Beginn der Folge ist gut anzuhören und dramatisch inszeniert. Will spricht dabei viele Wahrheiten, die man über Fernsehnachrichten, nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, beklagen könnte, aus. Dabei betont er immer, dass er ausschließlich sich selbst beschuldigt und andere Journalisten weder kritisieren noch zu einer ähnlichen Entschuldigung auffordern möchte. Das ist äußerst rücksichtsvoll und trägt damit leider nur noch mehr dazu bei, dass dieser Teil äußerst unrealistisch wirkt. Aus dieser Eingangsszene sprüht so viel Idealismus, dass es wieder einmal etwas zu viel ist. So sehr man sich so einen Ansatz auch wünschen mag, wahr kann er wohl nicht werden. Daher unterstützt Wills Entschuldigung den märchenhaften Eindruck, den man von den Vorgängen in der Serie erhält.
Glücklicherweise wird der Idealismus im Verlauf der Episode mit der Realität konfrontiert. Will und sein Team machen - und das ist das Highlight an dieser Folge - in den darauf folgenden Wochen und Monaten eine seriöse und kritische Nachrichtensendung, die sich aber nicht davor scheut, Ereignisse einzuordnen. Dies zu beobachten, macht Spaß. Die vielen Sendungen werden aber nicht nur im Zeitraffer dargestellt, sondern auch als Rückblende. Alle Ereignisse sind nämlich in eine Rahmenhandlung eingebettet. Darin befindet sich Charlie, der zuständige Verwantwortliche der Firmenleitung für die Sendung, in einem Meeting mit der Führungsspitze des Senders. Anwesend ist Leona Lasing, der CEO des Senders, und ihr Sohn, ihr designierter Nachfolger.
Obwohl Wills Sendung die Quoten scheinbar gehalten hat und mit Lob überschüttet wurde, sind die beiden außer sich. Denn mit ihrem "Wahrheitskurs" verärgert News Night vor allem "Tea Party"-Abgeordnete, die in den Interviews regelmäßig vorgeführt werden oder sich selbst vorführen (je nach Lesart). Das aber macht die Zusammenarbeit der Geschäftsfrau Leona Lasing mit dem Kongress schwierig. Es ist also nicht einmal der Profit der Nachrichtenabteilung, die die Sendungsleitung dazu bringt, Druck auf News Night auszuüben, sondern die eigene Lobbykraft.
Diese Entwicklung ist ausgezeichnet. Denn während Will McAvoy, als gemäßigter Republikaner, Probleme damit hat, dass seine Partei durch die "Tea Party"-Bewegung ins Unseriöse gezogen wird, denkt Leona Lasing, als angebliche Demokratin, ausschließlich an ihre Beziehungen und ihren Profit. Bis zu dieser Enthüllung am Ende der Folge hat es den Anschein, als würde "The Newsroom" (berechtigtes?) Republikaner-Bashing betreiben und sich damit nicht von den tendenziösen Nachrichtensendungen, die es kritisiert, unterscheiden. Mit Leona Lasing sind einige Graustufen in die Handlung gekommen.
Leider wird Charlie Skinner dabei immer mehr zum heimlichen Helden der Serie. Sein Charakter ähnelt mittlerweile dem Idealismus des Eingangsstatements. Er hat dafür gesorgt, dass Will mit MacKenzie jemanden als Produzentin hat, die eine wirkliche Nachrichtensendung produzieren möchte. Er unterstützt Will auf diesem Kurs und hier schützt er Will sogar vor der Geschäftsleitung. Dabei stellt sich die Frage, ob Charlie auch einmal an sich und seine Karriere denkt. Etwas Graustufen in seinem Charaktere wären auf jeden Fall hilfreich.
Sowieso sind die Charaktere auch in der dritten Folge noch die größte Schwäche der Serie. Ihre Interaktionen überzeugen nicht. Wills viele Dates und MacKenzies Reaktion darauf wirken albern. Der einzig gelungene Moment, als Will dies erkennt und sich entschuldigen möchte, wird durch eine alberne Racheaktion MacKenzies, sie bringt ihren Freund in den Produktionsraum, zunichte gemacht. Jims verzweifelte Eroberungsversuche gegenüber Maggie wirken ebenfalls entweder albern oder aber zu gekünstelt. Das muss sich ändern. Denn so schön die Handlung um eine Redaktion, die sich bemüht tatsächlich gute Nachrichten zu produzieren, auch ist, letztlich werden Fernsehserien von ihren Charakteren getragen. Bisher ist "The Newsroom" aufgrund der Idee dahinter, nicht wegen der Protgonisten sehenswert.
"The 112th Congress" fügt der Handlung viel Dramatik, in der Form einer ablehnenden Senderleitung, hinzu. Damit entstehen im politischen Spektrum kleine Grautöne, was der Serie ebenfalls gut tut. Während die Charaktere dabei bisher nicht zu überzeugen wissen, sind die Ausschnitte aus Wills Nachrichtensendung genau so spannend und unterhaltsam, wie Charlies Meeting im Hintergrund. Das alle sorgt für gute Unterhaltung.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Raise The Dawn (von David R. George III)
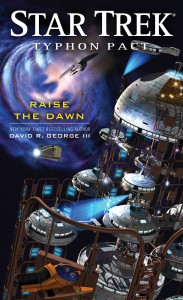 "Raise The Dawn" knüpft nahtlos an den ereignisreichen, inhaltlich aber nicht brillierenden Vorgänger "Plagues Of Night" an. "Deep Space Nine" ist zerstört, die "Typhon Pact"-Geheimdienste setzen ihre Verschwörung zur Erlangung des Slipstream-Antriebes weiterhin fort. An diese Situation, in der ein Krieg zwischen den Kithomer-Verbündeten und dem Typhon Pact unausweichlich wirkt und das stümperhafte vorgehen des romulanischen Geheimdienst zudem das Dominion erregt, gelingt David R. George ein weiterer ereignisreicher Roman, der eingies besser macht, aber noch immer einige inhaltliche Schwächen aufweist.
"Raise The Dawn" knüpft nahtlos an den ereignisreichen, inhaltlich aber nicht brillierenden Vorgänger "Plagues Of Night" an. "Deep Space Nine" ist zerstört, die "Typhon Pact"-Geheimdienste setzen ihre Verschwörung zur Erlangung des Slipstream-Antriebes weiterhin fort. An diese Situation, in der ein Krieg zwischen den Kithomer-Verbündeten und dem Typhon Pact unausweichlich wirkt und das stümperhafte vorgehen des romulanischen Geheimdienst zudem das Dominion erregt, gelingt David R. George ein weiterer ereignisreicher Roman, der eingies besser macht, aber noch immer einige inhaltliche Schwächen aufweist.Die vollständige Rezension ist auf trekzone nachzulesen:
Star Trek Typhon Pact: Raise The Dawn (von David R. George III)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gesehen: News Night 2.0 (The Newsroom Folge 2)
Die Sondersendung zu der Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko war ein großer Erfolg. Alle erwarten, dass die nächste Sendung an dieses Ereignis anknüpfen wird. Die neue Produzentin MacKenzie McHale lehnt dies ab, für sie gibt es keinen Neuigkeitswert. Der Skandal ist bekannt, es bliebe nur noch Populismus. Also konzentriert sie sich auf das gerade verabschiedete Anti-Immigranten-Gesetz aus Arizona. Während sie immer mehr merkt, dass Moderator Will McAvoy, mit dem sie einst zusammen war und den sie betrogen hat, von der Crew als "Arschloch" und "Fremdgeher" gesehen wird, versucht sie, diesen Eindruck zu korrigieren. Damit macht sie alles nur noch schlimmer. Als zu allem Überfluss die republikanische Regierung Arizonas ihre Teilnahme an der Sendung aufgrund eines Anfängerfehlers einer Mitarbeiterin absagt, gerät die abendliche Sendung zu einem Desaster.
Bereits die zweite Sendung der Serie zeigt, was bei dem anspruchsvollen Konzept MacKenzies schief gehen kann. Ruhiger, argumentativer und ausgewogener Journalismus klingt gut. Doch da Journalisten nur berichten, benötigen sie dafür auch die richtigen Quellen. In diesem Fall bleiben dem Team für die Pro-Seite des Immigrantengesetzes nur extreme Bürger der Vereinigten Statten. So muss Will ein Interview mit einer "Miss Arizona"-Kandidatin, einem rassistischen Pseudo-Wissenschaftler und einem Waffennarr führen. Dies gerät natürlich zum Desaster.
Es ist gut, dass diese Gefahr bereits in der zweiten Folge thematisiert wird. Leider tritt diese Haupthandlung stark in den Hintergrund. Wichtiger scheint es den Autoren zu sein, die alte Beziehung zwischen Will und MacKenzie zu erklären. Dabei verhält sich vor allem MacKenzie an vielen Stellen sehr unsouverän. Das ist gewollt. Auch auf ihrem fachlichen Gebiet wird sie häufig naiv inszeniert. Das wird regelmäßig dadurch ausgeglichen, dass sie, wenn es denn darauf ankommt, stark und richtig auftritt. In dieser Episode wirken sie und auch ihre Konzepte aber häufig lächerlich.
So schreibt sie ein pikante Mail, die an Will gehen soll, aus Versehen an die komplette Redaktion. Das wird als zweiter Höhepunkt neben der Sendung in der Episode inszeniert. Dabei ist gerade dieser Moment recht unnötig.
Spannender ist da die Art und Weise wie Redaktionschef Jim Harper mit dem Fehler von Maggie Jordan umgeht. Leider ist der Fehler ähnlich schlecht konstruiert wie die Aufklärung der Beziehung zwischen Will und MacKenzie. Auch hier geht es wieder um eine ehemalige Beziehungsgeschichte. Immerhin wird daraus aber ein guter Einblick in Maggies Charakter hergestellt. Das gelingt bei dem Konflikt zwischen Moderator und Produzentin aber nicht. Jim verhält sich in dieser Situation weitestgehend souverän und überlässt es Maggie, ihren Fehler zu analysieren und damit zu leben. Das wirkt überzeugend.
Am gelungensten ist die Nebenhandlung um Wills Quotengläubigkeit. Er gibt offen zu, dass es für ihn äußerst wichtig ist, von den Menschen gemocht zu werden. Jemand aus der Geschäftsleitung spielt ihm daher regelmäßig die Quoten zu und berät ihn, wie er die Show populärer ausrichten könnte. MacKenzie hat er versprochen, diese Einstellung zu ändern. Doch angesichts des katastrophalen Arizona-Verlaufs entschließt er sich dazu, Sarah Palin in die Show zu holen. MacKenzie hält das für Populismus und stellt daher am Ende der Folge die Vertrauensfrage. Es geht darum, ob Will weiterhin nach Quoten oder nach einer guten Sendung giert. Er entscheidet sich für letzteres, was klar war, da die Serie sonst beendet wäre.
"News Night 2.0" stellt eindrucksvoll die Schwierigkeiten einer guten Nachrichtensendung dar, denn dazu braucht es auch gute Gäste, die nicht immer leicht zu finden sind. Leider wird der Schwerpunkt sehr auf die persönlichen Beziehungen gesetzt. Das hat bei "The West Wing", der ersten Serie von Aaron Sorkin äußerst gut funktioniert. Hier springt aber vor allem bei den beiden Hauptdarstellern der Funke nicht über, MacKenzie wirkt dabei zu intuitiv und zu emotional. Hier besteht ein deutlicher Verbesserungsbedarf. Die gelungeneren Wortspiele zwischen Jim und Maggie lassen jedoch darauf hoffen, dass sich so etwas in den kommenden Episoden auch noch bei den Hauptcharakteren einspielen wird.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Mein Katalonien - Bericht über den Spanischen Bürgerkrieg (von George Orwell)
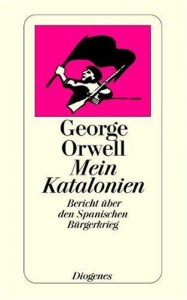 George Orwell beschreibt in dem Buch, wie er sich während des Spanischen Bürgerkrieges von der revolutionären Atmosphäre im republikanischen Katalonien anstecken ließ und der trotzkistischen Miliz beitrat. Das Buch beginnt mit einer begeisterten und schillernden Beschreibung Kataloniens unter der Führung der Arbeiter. Dabei werden Schwachstellen bereits offenbar, doch verblassen sie hinter der Atmosphäre der Gleichheit, die Orwell ausgemacht haben will.
George Orwell beschreibt in dem Buch, wie er sich während des Spanischen Bürgerkrieges von der revolutionären Atmosphäre im republikanischen Katalonien anstecken ließ und der trotzkistischen Miliz beitrat. Das Buch beginnt mit einer begeisterten und schillernden Beschreibung Kataloniens unter der Führung der Arbeiter. Dabei werden Schwachstellen bereits offenbar, doch verblassen sie hinter der Atmosphäre der Gleichheit, die Orwell ausgemacht haben will.Die Begeisterung für diesen Zustand war so stark, dass Orwell begeistert in den Krieg zog. Später macht er jedoch deutlich, dass er auch für eine schlichte, weil kapitalistische Demokratie ins Feld gezogen wäre. Seine Begeisterung wäre zwar begrenzt gewesen, doch der Faschismus musste unbedingt einmal aufgehalten werden. Bekanntlich gelang nicht einmal dieses Ziel.
Orwell unterteilt seine Kapitel strikt in Frontbeschreibungen und Schilderungen der politischen Situation. Damit möchte er es – nach eigener Aussage – dem Leser möglich machen, zwischen dem, was ihn interessiert zu wählen. Es ist aber ganz klar, dass auch die Kampfschilderungen nicht ohne kleine politische Seitenhiebe auskommen.
Was Orwell über die Kampfhandlungen an sich schreibt, ist erschreckend. Es ist nämlich nicht der Schrecken des Krieges, der ihn stört, sondern die Langeweile. Beide Armeen sind während Orwells Frontzeit sehr schlecht ausgerüstet. Kaum ein Schuss trifft und daher nimmt niemand die Kämpfe ernst. Gelegentlich wird zwar jemand getroffen, wirklich irritieren tut das niemanden. Orwells Ton ist dabei selten anklagend, obwohl er jeden Grund dazu hätte. Denn die Ausrüstung seiner Organisation ist genau wie die Ausbildung der Miliz fahrlässig. Mit so einem Rüstzeug kann man niemanden in einen Krieg ziehen lassen. Denn wäre die faschistische Armee nicht ähnlich schlecht ausgestattet gewesen, hätte keiner der trotzkistischen (und zu dem Zeitpunkt auch alle republikanischen) Soldaten keine Chance gehabt. Stattdessen beschreibt Orwell das so, dass es beinahe witzig klingt.
Der Krieg wirkt in Orwells Beschreibung unglaublich banal, beinahe sinnlos. Das ist aber gerade falsch, schließlich ist es ja gerade ein Krieg gewesen, der zwischen einer demokratisch oder kommunistischen und einer faschistischen Ausrichtung des Landes entscheiden sollte. Das macht Orwell immer wieder klar, dennoch sind die Kampfhandlungen, an denen er teilnimmt an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten. Er nimmt an keiner einzigen sauber geplanten Offensive teil. Die einzige länger geplante Aktion, geht aufgrund von Planungsfehlern schrecklich schief.
Aber anstatt das Milizsystem anzuklagen, verteidigt Orwell es. Für ihn muss der Soldat auch in der Armee mit allen gleichgestellt sein. Ein hehrer Ansatz, der natürlich von allen anderen Gruppen nicht geteilt wurde. Damit beschäftigt sich der politische Teil. Den vielen Konflikten der demokratischen, liberalen, sozialistischen, kommunistischen, anarchistischen und trotzkistischen Parteien, die auf Seiten der Republikaner zu Beginn Seite an Seite kämpften, ist nur schwer zu folgen. Deutlich wird hier aber, dass die stalinistisch gelenkte kommunistische Partei rasch die Oberhand gewann. Anstatt aber für eine wirkliche Revolution zu sorgen, behinderte diese Partei – nach Orwells Schilderungen – alle Revolutionsbemühungen. Stattdessen arbeitete sie – nach Vorgabe aus der UdSSR eng mit liberalen Kräften zusammen und machte sogar revolutionäre Entwicklungen rückgängig. Das musste auf radikalere Kräfte provozierend wirken, weswegen es innerhalb der Republikaner zu Kämpfen kommt.
Die Beschreibung dieser Kämpfe, die die zweite Hälfte des Berichts ausmachen, strotzen vor Sinnlosigkeit. Anstatt sich gemeinsam auf das faschistische Ziel zu konzentrieren, musste die Oberhand im eigenen Lager gewonnen werden. Es ist klar, dass die Kommunisten, auf deren Seite der einzige große Waffenlieferant der Republikaner, die UdSSR, stand, gewannen. Die anschließenden Säuberungen verleiden Orwell die Lust am Krieg, er sieht keine Chance mehr auf einen guten Ausgang für die Arbeiter. Nach dem Sieg der Kommunisten ist in seinen Augen die positivste Ausgangsmöglichkeit eine Verhinderung des Faschismus durch eine autoritäre Demokratie. Seine Verwundung kommt im daher gerade recht.
Besonders beachtlich ist in der politischen Beschreibung, dass Orwell stark auf die Propaganda eingeht. Er selbst stellt klar, dass sein Bericht keineswegs objektiv ist und es auch nicht sein kann. Seitenlang zerlegt er – was teilweise etwas langatmig zu lesen ist – Zeitungsartikel aus verschiedenen kommunistischen Zeitungen Spaniens und Großbritanniens. Oft schildert er Ereignisse in Spanien, dann wie sie in der spanischen kommunistischen Presse aufgenommen wurden und letztlich wie die britische sozialistische und kommunistische Presse sie verarbeitet hat. Der Veränderungsprozess ist weitreichend und der Bericht macht damit deutlich, wie bereits während des Spanischen Bürgerkriegs die Weltöffentlichkeit mit Zeitungspropaganda gelenkt wurde, um bestimmte Strömungen, wie zum Beispiel den Trotzkismus, zu diskreditieren und ihrer Unterstützung zu berauben. Das ist eindrucksvoll und ist wohl bereits der erste Grundstein für Orwells „1984“-Dystopie.
Orwells Bericht über den Spanischen Bürgerkrieg ist sehr subjektiv. Bei der Lektüre des teilweise langatmigen Textes wird aber deutlich, wie gruselig die meisten Soldaten im Spanischen Bürgerkrieg ausgerüstet waren, wie sinnlos die meisten republikanischen Konflikte waren und – relativ überraschend – wie bürgerlich, rechts und kapitalfreundlich die stalinistischen Kommunisten agierten. Über all dem schwebt die lenkende Propaganda, die es für den einfachen Soldaten, fast unmöglich gemacht haben muss, die Wahrheit zu erkennen. Stattdessen war er (bzw. seine Organisation) von Lüge und Intrige umgeben und es konnte gut sein, dass er von der Front zurückkehrte und verhaftet wurde – bloß weil er Mitglied der falschen Miliz war. Das wird zwar nicht besonders anklagend, sondern in einem bemüht sachlichen Ton berichtet, ist aber trotzdem erschütternd.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
... ältere Einträge
