
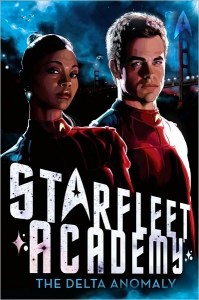 "Die Delta-Anomalie" ist der Beginn einer "Star Trek"-Jugendbuchserie, die in der alternativen Zeitlinie des letzten "Star Trek"-Films spielt. Dementsprechend ist auch der Aufbau des Buches: Wenig Seiten, große Schrift, kurze Sätze. Das sorgt für hohes Lesetempo, die Komplexität der Handlung leidet aber automatisch darunter. Dennoch gelingt es dem Autor, trotz einiger konzeptioneller Schwächen, den ein oder anderen interessanten Aspekt aus der Handlung herauszuarbeiten.
"Die Delta-Anomalie" ist der Beginn einer "Star Trek"-Jugendbuchserie, die in der alternativen Zeitlinie des letzten "Star Trek"-Films spielt. Dementsprechend ist auch der Aufbau des Buches: Wenig Seiten, große Schrift, kurze Sätze. Das sorgt für hohes Lesetempo, die Komplexität der Handlung leidet aber automatisch darunter. Dennoch gelingt es dem Autor, trotz einiger konzeptioneller Schwächen, den ein oder anderen interessanten Aspekt aus der Handlung herauszuarbeiten.Die komplette Rezension ist auf Trekzone nachzulesen:
Starfleet Academy - Die Delta-Anomalie (von Rick Barba)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

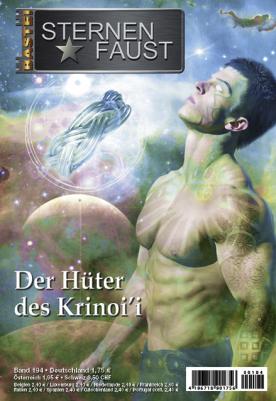 Mit "Der Hüter des Krinoi'i" steigt Mara Laue nach langer Zeit wieder als Autorin in die Serie "Sternenfaust" ein. Mara Laue schrieb einst im Schnitt jeden dritten Roman der Serie und war besonders gut darin, fremde Völker auf engem Raum zu beschreiben. Vielleicht auch um dieses Klischee zu wiederlegen, glänzt der Roman nicht mit einem neuen Volk, sondern mit einem alten und dem Innenleben der Sternenfaust-Besatzung. Denn im Gegensatz zu der etwas konventionellen Haupthandlung wissen die Nebenstränge um Verwandte der Shisheni und desillusionierte und diskriminierte Sternenfaust-Mitglieder wirklich zu überzeugen.
Mit "Der Hüter des Krinoi'i" steigt Mara Laue nach langer Zeit wieder als Autorin in die Serie "Sternenfaust" ein. Mara Laue schrieb einst im Schnitt jeden dritten Roman der Serie und war besonders gut darin, fremde Völker auf engem Raum zu beschreiben. Vielleicht auch um dieses Klischee zu wiederlegen, glänzt der Roman nicht mit einem neuen Volk, sondern mit einem alten und dem Innenleben der Sternenfaust-Besatzung. Denn im Gegensatz zu der etwas konventionellen Haupthandlung wissen die Nebenstränge um Verwandte der Shisheni und desillusionierte und diskriminierte Sternenfaust-Mitglieder wirklich zu überzeugen.Die komplette Rezension ist auf SF-Radio nachzulesen:
Sternenfaust Band 194 - Der Hüter des Krinoi'i (von Mara Laue)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
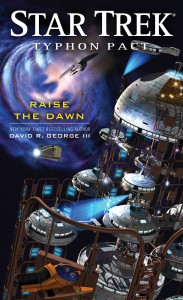 "Raise The Dawn" knüpft nahtlos an den ereignisreichen, inhaltlich aber nicht brillierenden Vorgänger "Plagues Of Night" an. "Deep Space Nine" ist zerstört, die "Typhon Pact"-Geheimdienste setzen ihre Verschwörung zur Erlangung des Slipstream-Antriebes weiterhin fort. An diese Situation, in der ein Krieg zwischen den Kithomer-Verbündeten und dem Typhon Pact unausweichlich wirkt und das stümperhafte vorgehen des romulanischen Geheimdienst zudem das Dominion erregt, gelingt David R. George ein weiterer ereignisreicher Roman, der eingies besser macht, aber noch immer einige inhaltliche Schwächen aufweist.
"Raise The Dawn" knüpft nahtlos an den ereignisreichen, inhaltlich aber nicht brillierenden Vorgänger "Plagues Of Night" an. "Deep Space Nine" ist zerstört, die "Typhon Pact"-Geheimdienste setzen ihre Verschwörung zur Erlangung des Slipstream-Antriebes weiterhin fort. An diese Situation, in der ein Krieg zwischen den Kithomer-Verbündeten und dem Typhon Pact unausweichlich wirkt und das stümperhafte vorgehen des romulanischen Geheimdienst zudem das Dominion erregt, gelingt David R. George ein weiterer ereignisreicher Roman, der eingies besser macht, aber noch immer einige inhaltliche Schwächen aufweist.Die vollständige Rezension ist auf trekzone nachzulesen:
Star Trek Typhon Pact: Raise The Dawn (von David R. George III)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
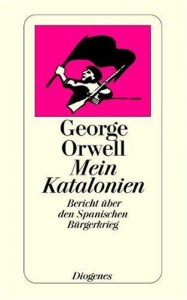 George Orwell beschreibt in dem Buch, wie er sich während des Spanischen Bürgerkrieges von der revolutionären Atmosphäre im republikanischen Katalonien anstecken ließ und der trotzkistischen Miliz beitrat. Das Buch beginnt mit einer begeisterten und schillernden Beschreibung Kataloniens unter der Führung der Arbeiter. Dabei werden Schwachstellen bereits offenbar, doch verblassen sie hinter der Atmosphäre der Gleichheit, die Orwell ausgemacht haben will.
George Orwell beschreibt in dem Buch, wie er sich während des Spanischen Bürgerkrieges von der revolutionären Atmosphäre im republikanischen Katalonien anstecken ließ und der trotzkistischen Miliz beitrat. Das Buch beginnt mit einer begeisterten und schillernden Beschreibung Kataloniens unter der Führung der Arbeiter. Dabei werden Schwachstellen bereits offenbar, doch verblassen sie hinter der Atmosphäre der Gleichheit, die Orwell ausgemacht haben will.Die Begeisterung für diesen Zustand war so stark, dass Orwell begeistert in den Krieg zog. Später macht er jedoch deutlich, dass er auch für eine schlichte, weil kapitalistische Demokratie ins Feld gezogen wäre. Seine Begeisterung wäre zwar begrenzt gewesen, doch der Faschismus musste unbedingt einmal aufgehalten werden. Bekanntlich gelang nicht einmal dieses Ziel.
Orwell unterteilt seine Kapitel strikt in Frontbeschreibungen und Schilderungen der politischen Situation. Damit möchte er es – nach eigener Aussage – dem Leser möglich machen, zwischen dem, was ihn interessiert zu wählen. Es ist aber ganz klar, dass auch die Kampfschilderungen nicht ohne kleine politische Seitenhiebe auskommen.
Was Orwell über die Kampfhandlungen an sich schreibt, ist erschreckend. Es ist nämlich nicht der Schrecken des Krieges, der ihn stört, sondern die Langeweile. Beide Armeen sind während Orwells Frontzeit sehr schlecht ausgerüstet. Kaum ein Schuss trifft und daher nimmt niemand die Kämpfe ernst. Gelegentlich wird zwar jemand getroffen, wirklich irritieren tut das niemanden. Orwells Ton ist dabei selten anklagend, obwohl er jeden Grund dazu hätte. Denn die Ausrüstung seiner Organisation ist genau wie die Ausbildung der Miliz fahrlässig. Mit so einem Rüstzeug kann man niemanden in einen Krieg ziehen lassen. Denn wäre die faschistische Armee nicht ähnlich schlecht ausgestattet gewesen, hätte keiner der trotzkistischen (und zu dem Zeitpunkt auch alle republikanischen) Soldaten keine Chance gehabt. Stattdessen beschreibt Orwell das so, dass es beinahe witzig klingt.
Der Krieg wirkt in Orwells Beschreibung unglaublich banal, beinahe sinnlos. Das ist aber gerade falsch, schließlich ist es ja gerade ein Krieg gewesen, der zwischen einer demokratisch oder kommunistischen und einer faschistischen Ausrichtung des Landes entscheiden sollte. Das macht Orwell immer wieder klar, dennoch sind die Kampfhandlungen, an denen er teilnimmt an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten. Er nimmt an keiner einzigen sauber geplanten Offensive teil. Die einzige länger geplante Aktion, geht aufgrund von Planungsfehlern schrecklich schief.
Aber anstatt das Milizsystem anzuklagen, verteidigt Orwell es. Für ihn muss der Soldat auch in der Armee mit allen gleichgestellt sein. Ein hehrer Ansatz, der natürlich von allen anderen Gruppen nicht geteilt wurde. Damit beschäftigt sich der politische Teil. Den vielen Konflikten der demokratischen, liberalen, sozialistischen, kommunistischen, anarchistischen und trotzkistischen Parteien, die auf Seiten der Republikaner zu Beginn Seite an Seite kämpften, ist nur schwer zu folgen. Deutlich wird hier aber, dass die stalinistisch gelenkte kommunistische Partei rasch die Oberhand gewann. Anstatt aber für eine wirkliche Revolution zu sorgen, behinderte diese Partei – nach Orwells Schilderungen – alle Revolutionsbemühungen. Stattdessen arbeitete sie – nach Vorgabe aus der UdSSR eng mit liberalen Kräften zusammen und machte sogar revolutionäre Entwicklungen rückgängig. Das musste auf radikalere Kräfte provozierend wirken, weswegen es innerhalb der Republikaner zu Kämpfen kommt.
Die Beschreibung dieser Kämpfe, die die zweite Hälfte des Berichts ausmachen, strotzen vor Sinnlosigkeit. Anstatt sich gemeinsam auf das faschistische Ziel zu konzentrieren, musste die Oberhand im eigenen Lager gewonnen werden. Es ist klar, dass die Kommunisten, auf deren Seite der einzige große Waffenlieferant der Republikaner, die UdSSR, stand, gewannen. Die anschließenden Säuberungen verleiden Orwell die Lust am Krieg, er sieht keine Chance mehr auf einen guten Ausgang für die Arbeiter. Nach dem Sieg der Kommunisten ist in seinen Augen die positivste Ausgangsmöglichkeit eine Verhinderung des Faschismus durch eine autoritäre Demokratie. Seine Verwundung kommt im daher gerade recht.
Besonders beachtlich ist in der politischen Beschreibung, dass Orwell stark auf die Propaganda eingeht. Er selbst stellt klar, dass sein Bericht keineswegs objektiv ist und es auch nicht sein kann. Seitenlang zerlegt er – was teilweise etwas langatmig zu lesen ist – Zeitungsartikel aus verschiedenen kommunistischen Zeitungen Spaniens und Großbritanniens. Oft schildert er Ereignisse in Spanien, dann wie sie in der spanischen kommunistischen Presse aufgenommen wurden und letztlich wie die britische sozialistische und kommunistische Presse sie verarbeitet hat. Der Veränderungsprozess ist weitreichend und der Bericht macht damit deutlich, wie bereits während des Spanischen Bürgerkriegs die Weltöffentlichkeit mit Zeitungspropaganda gelenkt wurde, um bestimmte Strömungen, wie zum Beispiel den Trotzkismus, zu diskreditieren und ihrer Unterstützung zu berauben. Das ist eindrucksvoll und ist wohl bereits der erste Grundstein für Orwells „1984“-Dystopie.
Orwells Bericht über den Spanischen Bürgerkrieg ist sehr subjektiv. Bei der Lektüre des teilweise langatmigen Textes wird aber deutlich, wie gruselig die meisten Soldaten im Spanischen Bürgerkrieg ausgerüstet waren, wie sinnlos die meisten republikanischen Konflikte waren und – relativ überraschend – wie bürgerlich, rechts und kapitalfreundlich die stalinistischen Kommunisten agierten. Über all dem schwebt die lenkende Propaganda, die es für den einfachen Soldaten, fast unmöglich gemacht haben muss, die Wahrheit zu erkennen. Stattdessen war er (bzw. seine Organisation) von Lüge und Intrige umgeben und es konnte gut sein, dass er von der Front zurückkehrte und verhaftet wurde – bloß weil er Mitglied der falschen Miliz war. Das wird zwar nicht besonders anklagend, sondern in einem bemüht sachlichen Ton berichtet, ist aber trotzdem erschütternd.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Weihnachten 1812, die französische Armee wurde in Russland vernichtend geschlagen. In der Mark Brandenburg versucht der alte Junker Berndt Vitzewitz eine preußische Armee gegen Napoleon aufzustellen. Noch stößt er damit auf Zurückhaltung und Widerstand. Sein romantischer, unpolitischer Sohn Lewin macht sich zu alledem keine Gedanken. Für ihn und seine Schwester Renate geht es vor dieser dramatischen Kulisse eher darum, die wahre Liebe zu finden. Kritisch wird es für Lewin erst, als sein Vater Erfolg hat und er sich im Landsturm wiederfindet.
Weihnachten 1812, die französische Armee wurde in Russland vernichtend geschlagen. In der Mark Brandenburg versucht der alte Junker Berndt Vitzewitz eine preußische Armee gegen Napoleon aufzustellen. Noch stößt er damit auf Zurückhaltung und Widerstand. Sein romantischer, unpolitischer Sohn Lewin macht sich zu alledem keine Gedanken. Für ihn und seine Schwester Renate geht es vor dieser dramatischen Kulisse eher darum, die wahre Liebe zu finden. Kritisch wird es für Lewin erst, als sein Vater Erfolg hat und er sich im Landsturm wiederfindet.Für seinen ersten großen Roman hat sich Theodor Fontane eine dramatische Kulisse ausgesucht. Preußen ist zwar formal noch selbständig, wird militärisch aber von Frankreich dominierst. Der Leser weiß, dass sich das kurz nach dem gescheiterten Russland-Feldzug Napoleons ändern wird. Der Titel „Vor dem Sturm“ ist aber wörtlich zu nehmen. Berndt Vitzewitz, dem die französische Vorherrschaft seit langem ein Dorn im Auge ist, bemüht sich vor allen anderen darum, einen Landsturm aufzustellen. So schlagen die Dörfer um Vitzewitz bereits zu, als sich alle anderen preußischen Gegenden noch ruhig und loyal präsentieren. Der ganzen Bewegung ist ein Erfolg beschieden. Da Vitzewitz so früh los schlägt, ist der Erfolg von dessen erstem Angriffsplan nicht abzusehbar. Das ist das einzige spannungsbringende Element des Romans.
Denn Theodor Fontan schrieb bekanntlich nicht der Spannung wegen. Die Handlung könnte in wenigen Sätzen zusammengefasst werden. Die dtv-Ausgabe besteht aus etwa 700 Seiten Text mit zusätzlichen 200 Seiten Anmerkungen. Erst nach 600 Seiten hat sich der Landsturm formiert und es kommt zum Überfall auf eine französische Garnison. Bis dahin wird in endlosen Runden über die politische Situation und vor allem über aktuellen Klatsch und Tratsch diskutiert.
Das ist einmal mehr überraschend fesselnd. Fontane charakterisiert eine Vielzahl von Personen, häufig seitenlang. Außerdem beschreibt er den historischen Hintergrund vieler Orte, Dörfer und Schlösser. Auch hierfür gestattet er sich meist ein ganzes Kapitel. Dadurch erschafft er eine sehr lebendige märkische Landschaft in dem Roman, zu der die behäbige Erzählweise wirklich zu passen scheint.
Es ist daher das Beeindruckendste an dem Roman, dass man das Gefühl hat, die Denk- und Handlungsweise einer vor 200 Jahren lebenden Gesellschaft spüren zu können. Natürlich konzentriert sich Fontane dabei auf die Adligen, doch auch Pastoren, Schulzen und Bauern finden in einigen Kapiteln Beachtung. Obwohl viele Charaktere für die eigentliche Handlung nur Nebenrollen sind, wird ihr Hintergrund in etwa so umfangreich ausgebreitet, wie der der Hauptpersonen. Dadurch entsteht ein abgerundetes Bild des gesellschaftlichen Aufbaus zu der Zeit.
Die Liebe spielt selbstverständlich ebenfalls eine Rolle in dem Roman. Hier zeichnet sich bereits ab, dass die „alten“ Werte nicht mehr aufrecht erhalten werden können. Denn während Berndt Vitzewitz mit einem polnischen Adligen bereits Heiratspläne für die gemeinsamen Kinder schmieden, entwickelt sich im Lauf des Romans in dieser Hinsicht alles überraschend anders.
Häufig erschafft Fontane bei seinen Schilderungen eindrucksvolle Bilder. Wenn Lewin nachts durch die Straßen seiner Universitätsstadt wandert, von unerfüllter Liebe getrieben und ihm kommt die geschlagene französische Armee entgegen, die sich durch die eisige Kälte Russlands nach Preußen vorgearbeitet hat, ist das ein starkes Bild, das durch die Sprachgewalt Fontanes sehr berührend ist. Vor allem wenn man bedenkt, dass Lewins Vater bereits daran arbeitet, die leidenden Überlebenden zu vernichten. Diese Doppeldeutigkeit, die sich zu dem sonst zur Schau getragenen Patriotismus gesellt, tut dem Roman gut.
„Vor dem Sturm“ ist ein langer, behäbiger und anstrengender Roman, der nur wenig Handlung bietet. Dafür erlebt der Leser eine eindringliche, wortgewaltige Schilderung der märkischen Adels- und Bauernwelt kurz vor den Befreiungskriegen, mit teilweise beeindruckenden Bildern.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

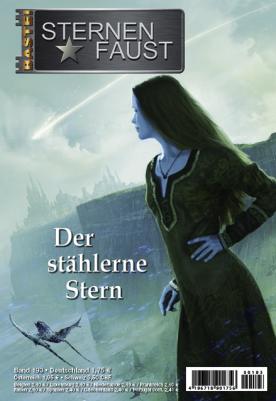 "Der stählerne Stern" ist der zweite durchschnittliche Roman des "Andromeda"-Zyklus. Die Sternenfaust fliegt einen Planeten an, diesmal aber nicht, weil sie dort ein Akoluthorum vermutet, sondern um frische Lebensmittel mitzunehmen und damit die Moral der Crew zu steigern. Doch - oh Zufall - es gibt dort ein Akoluthorum. Der Leser weiß dies leider deutlich vor der Sternenfaust-Besatzung, was die Spannung etwas mindert. Am Ende werden noch einige Tenebrikoner verkloppt und die spannendste Fragestellung des Romans gekonnt ignoriert. Das hätte besser laufen können.
"Der stählerne Stern" ist der zweite durchschnittliche Roman des "Andromeda"-Zyklus. Die Sternenfaust fliegt einen Planeten an, diesmal aber nicht, weil sie dort ein Akoluthorum vermutet, sondern um frische Lebensmittel mitzunehmen und damit die Moral der Crew zu steigern. Doch - oh Zufall - es gibt dort ein Akoluthorum. Der Leser weiß dies leider deutlich vor der Sternenfaust-Besatzung, was die Spannung etwas mindert. Am Ende werden noch einige Tenebrikoner verkloppt und die spannendste Fragestellung des Romans gekonnt ignoriert. Das hätte besser laufen können.Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Sternenfaust Band 193 - Der stählerne Stern (von Guido Seifert)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Die internationale Finanzkrise führt uns seit 2008 vor, welche Auswüchse neoliberale Wirtschaftspolitik treiben kann. Mittlerweile ist es zwar vielen (neoliberalen) Ökonomen gelungen, den Fokus auf die Staatsverschuldungskrise zu lenken. Doch kann dabei nicht ignoriert werden, dass die enormen Auswüchse dieses Problems in erster Linie durch die Rettung der 2008 gescheiterten Banken hervorgerufen wurden.
Die internationale Finanzkrise führt uns seit 2008 vor, welche Auswüchse neoliberale Wirtschaftspolitik treiben kann. Mittlerweile ist es zwar vielen (neoliberalen) Ökonomen gelungen, den Fokus auf die Staatsverschuldungskrise zu lenken. Doch kann dabei nicht ignoriert werden, dass die enormen Auswüchse dieses Problems in erster Linie durch die Rettung der 2008 gescheiterten Banken hervorgerufen wurden.Colin Crouch befasst sich in seinem Buch, was er in Anspielung auf sein bekanntestes Werk mit „Postdemokratie II“ untertitelt, mit der Frage, warum der Neoliberalismus nicht im Rahmen der Finanzkrise 2008 untergegangen ist. Das Fazit ist ernüchternd und wird bereits in der Einleitung benannt: Weil es zur Zeit keine vernünftige, umsetzbare Alternative gibt.
Crouch verwendet den Großteil des Buches darauf, seine Sicht der Entstehungsgeschichte des Neoliberalismus zu schildern. Dabei holt er weit aus, fasst den historischen Konsens der Wirtschaft und der Arbeiterklasse im Zeitalter des Keynsianismus zusammen und beschreibt, wie dieser aufgrund der schwächer werdenden Arbeiterklasse ersetzt werden konnte. Dabei verschweigt Crouch auch kritische Aspekte am Keynsianismus nicht und arbeitet sogar positive Elemente der neoliberalen Theorie heraus.
Seine Grundthese ist jedoch, dass der Neoliberalismus nur wenig mit Liberalismus zu tun hat, da der Konflikt zwischen Markt und Staat lediglich vorgeschoben sei. Während neoliberale Theoretiker immer wieder betonen, sie würden den freien Markt fördern, unterstützen sie in Wirklichkeit lediglich große Konzerne, die den freien Markt und regulierenden Wettbewerb verhindern. Viele Maßnahmen, vor allem Privatisierungen, unterstützten einseitig große Konzerne. Diese gelangten dadurch in Schlüsselpositionen, in denen sie nicht mehr vom Markt verschwinden können, ohne dass dieser zusammenbrechen würde. Das wurde von Neoliberalen willig in Kauf genommen, obwohl es der eigenen Theorie entgegenlief. Da es aber wichtiger erschien, den Staat schnell zu entmachten, schien es legitim.
Um diese These herum, geht Crouch in Kapiteln auf das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Staat, auf die Finanzierung neoliberaler Politik durch privaten Keynsianismus, also die Verschuldung der privaten Haushalte und zuletzt auf die Strategie großer Konzerne sich mittels „Corporate Social Responsibility“-Strategien auch als politische Akteure zu betätigen, ein.
Nach diesen interessanten Erläuterungen beginnt Crouch mit seinen Ratschlägen.Sein Buch, das stellt er von Anfang an fest, richtet sich an diejenigen, die das System pragmatisch verändern wollen. Crouch ist kein Revolutionsromantiker. Das wird vor allem in den Abschnitten deutlich, in dem er (wahre) sozialdemokratische Politik und den keynsianischen Kompromiss beschreibt. Dabei führt er nämlich immer an, dass diese Politik daran zugrunde ging, dass die sie tragende Klasse zerbröckelte. Eine Wende kann also nur gelingen, wenn sie von einer deutlichen gesellschaftlichen Mehrheit getragen wird, die zur Zeit nicht absehbar beziehungsweise organisierbar ist.
Sein Fazit weist in erster Linie darauf hin, wie im neoliberalen System kleine Veränderungen möglich sind. Dabei stimmt positiv, dass Neoliberale in keinem westlichen Land ganz erfolgreich waren und es noch immer Gesellschaftsbereiche gibt, die wirtschaftlichen Einflüssen relativ entzogen sind. Während es in Amerika die Post ist, in Großbritannien (bis jetzt) der öffentliche Gesundheitssektor, ist es hierzulande das staatliche Bildungswesen. Verhindert wurde der Siegeszug dabei dadurch, dass die jeweiligen Sektoren der Bevölkerung zu wichtig waren und/oder sich zivilgesellschaftliche Gruppen für ihren Erhalt ausgesprochen haben. Crouch plädiert dafür, das Dreigespann Staat-Markt-Konzerne durch eine vierte Kraft zu ersetzen. Denn er arbeitet ebenfalls heraus, dass der Staat allein, wie viele Linke fordern, nicht die Lösung sein kann. Als viertes müsste ein aktive, selbstbewusste Zivilgesellschaft, zu der er neben Bürgerinitiativen auch Vereine, Kirchen, Parteien, Berufsverbände und ehrenamtlich aktive Bürger zählt, die Auswüchse der ersten drei Akteure kontrollieren. Das erscheint schwierig, in vielen Fällen unwahrscheinlich. Doch es motiviert angesichts eines ungerechten, in vielen Punkten derzeit aber nicht zu ändernden Systems dazu, wachsam, nachdenklich und aktiv zu bleiben.
Das Buch ist - noch - günstig über die Bundeszentrale für politische Bildung zu beziehen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
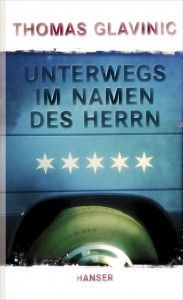 Der österreichische Schriftsteller Thomas Glavinic nimmt mit einem befreundeten Fotografen an einer Wallfahrt nach Medjugorje in Bosnien-Herzogowina teil. Galvinic möchte damit sein Verhältnis zum Glauben testen. Der Test geht schief, Glavinic und sein Freund halten es nur wenige Tage auf der Wallfahrt aus. Mithilfe von Galvinics in der Nähe lebenden Vater flüchten sie und geraten in das Heim eines gastfreundlichen Drogendealers, der auf wilde Feiern besteht.
Der österreichische Schriftsteller Thomas Glavinic nimmt mit einem befreundeten Fotografen an einer Wallfahrt nach Medjugorje in Bosnien-Herzogowina teil. Galvinic möchte damit sein Verhältnis zum Glauben testen. Der Test geht schief, Glavinic und sein Freund halten es nur wenige Tage auf der Wallfahrt aus. Mithilfe von Galvinics in der Nähe lebenden Vater flüchten sie und geraten in das Heim eines gastfreundlichen Drogendealers, der auf wilde Feiern besteht.An vielen Stellen wirkt das Buch bemüht komisch. Die Teilnehmer der Wallfahrt werden größtenteils ins Lächerliche gezogen und wirken wie Karikaturen. Zu keinem Zeitpunkt wird versucht, die Teilnehmer differenziert zu beschreiben. Es besteht natürlich die Möglichkeit, dass bei solchen Wallfahrten ausschließlich Schablonen teilnehmen. Ein Telefonat am Ende des Buches deutet aber auf das Gegenteil hin.
Der zweite Teil ist abgedreht. Zumindest Glavinic beschreibt sich da bereits als gesundheitlich angeschlagen und nimmt Medikamente. Dadurch vernebeln sich seine Sinne. Dennoch wird sehr deutlich, dass er und sein Freund bei einem Drogendealer untergekommen sind, der rasch beleidigt ist, wenn man seine Gastfreundschaft in Frage stellt. Dieser Teil wirkt nicht mehrrealistisch. Hier ist schwierig, dass nicht ganz klar ist, ob es sich nun um Fiktion handelt oder um einen Tatsachenbericht.
Auf jeden Fall gerät die Situation hier außer Kontrolle. Die zwei Reisenden wollen schnell weg, pumpen sich aber mit Alkohol und Tabletten so voll, dass sie kaum mitbekommen, was um sie vorgeht. Dass Glavinic dem ständig Ausschnitte aus religiösen Broschüren gegenüberstellt, macht das Ganze nicht erträglicher.
„Unterwegs im Namen des Herren“ bietet somit zum Start eine klischeehafte Beschreibung einer Wallfahrt und endet in einem mittelschweren Alkohol-, Medikamenten- und Drogenexzess. Das muss man nicht gelesen haben.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

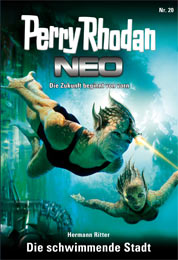 "Die schwimmende Stadt" weist einen faszinierenden Wasserplaneten auf und bietet die Chance, Perry Rhodan einen großen Brocken tragische Schuld anzulasten. Dieses Potential finden die Macher der Serie aber zu gewaltig, daher wird es ignoriert.
"Die schwimmende Stadt" weist einen faszinierenden Wasserplaneten auf und bietet die Chance, Perry Rhodan einen großen Brocken tragische Schuld anzulasten. Dieses Potential finden die Macher der Serie aber zu gewaltig, daher wird es ignoriert.
Stattdessen wird dem Leser die Hälfte des Romans eine Zeitbestimmung präsentiert, deren Antwort er längst kennt. In der zweiten Hälfte versucht Rhodan dann die Geschichte zu verändern und scheitert kläglich. Dabei ist sein Plan unüberlegt und entbehrt jedem Sinn. Aber Rhodan hatte in "Perry Rhodan Neo" bisher eh nur wenig gescheite Einfälle.
Die komplette Rezension zu dem zwanzigsten Roman der Reihe findet man auf SF-Radio:
Perry Rhodan Neo Band 20 - Die schwimmende Stadt (von Hermann Ritter)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
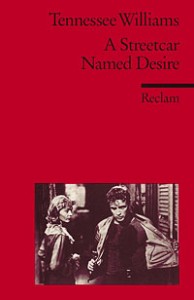 Blanche DuBois ist eine Südstaatlerin, die erleben musste wie ihre gesamte Familie verstarb und die Familienfarm (Belle Reve) aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten verloren ging. Zuflucht sucht sie bei ihrem letzten verbliebenen Familienmitglied: Ihrer Schwester Stella Kowalski. Die hat den polnisch-stämmigen Stanley Kowalski geheiratet. Blanche taucht in feinen Kleidern in dem zwei-Zimmer-Appartement ihrer Schwester in New Orleans auf. Sie gibt sich gehoben und zeigt sich entsetzt über die Zustände, die bei Stella herrschen. Den zur Trunksucht, Machismus und gelegentlich sogar Gewalt neigenden Stanley kann sie nicht leiden. Das macht sie mehr als deutlich, was für Stanley natürlich nicht akzeptabel aus. Je mehr von Blanches Selbstaussagen, begonnen von ihrem Alter, endend bei ihrer angeblich feinen Art, sich als Lüge herausstellen, desto mehr nähert sich das Stück einer Katastrophe. Am Ende ist Blanche nicht mehr in der Lage, die Realität wahrzunehmen und wird in eine Nervenheilanstalt eingewiesen.
Blanche DuBois ist eine Südstaatlerin, die erleben musste wie ihre gesamte Familie verstarb und die Familienfarm (Belle Reve) aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten verloren ging. Zuflucht sucht sie bei ihrem letzten verbliebenen Familienmitglied: Ihrer Schwester Stella Kowalski. Die hat den polnisch-stämmigen Stanley Kowalski geheiratet. Blanche taucht in feinen Kleidern in dem zwei-Zimmer-Appartement ihrer Schwester in New Orleans auf. Sie gibt sich gehoben und zeigt sich entsetzt über die Zustände, die bei Stella herrschen. Den zur Trunksucht, Machismus und gelegentlich sogar Gewalt neigenden Stanley kann sie nicht leiden. Das macht sie mehr als deutlich, was für Stanley natürlich nicht akzeptabel aus. Je mehr von Blanches Selbstaussagen, begonnen von ihrem Alter, endend bei ihrer angeblich feinen Art, sich als Lüge herausstellen, desto mehr nähert sich das Stück einer Katastrophe. Am Ende ist Blanche nicht mehr in der Lage, die Realität wahrzunehmen und wird in eine Nervenheilanstalt eingewiesen.Am auffälligsten an dem Stück ist die relativ ausführliche Beschreibung der Umgebung und der Lebensverhältnisse. Blanche macht immer wieder deutlich, dass sie den erlebten Lebensstil ablehnt und nicht führen könnte. Für sich wünscht sie sich etwas anderes. Aus ihren Augen erlebt der Leser, wie die beiden Frauen des Hauses (Stella und die Hauseigentümerin Eunice) regelmäßig von ihren Männern geschlagen werden. Anstatt dies als Grund für ein Beziehungsende anzusehen, kehren die Frauen immer wieder zu ihren Gatten zurück. Blanche empfindet das als schrecklich und kann das Verhalten nicht verstehen.
Der Leser ist damit hin- und hergerissen. Einerseits ist Blanches offen zur Schau gestellter Snobismus ekelhaft. Andererseits benennt sie richtig Probleme, vor denen die anderen Frauen die Augen verschließen, beziehungsweise, die diese aus Liebe ignorieren. Zudem scheint Blanche wenig für das Konzept eines alles dominierenden Mannes übrig zu haben. Genau das vertritt Stanley mit seiner übertrieben zur Schau gestellten Männlichkeit aber. Daher ist es kein Wunder, dass Blanche sich gerade zu dem nachdenklichsten, reflektiertesten Mann aus Stanleys Freundeskreis hingezogen fühlt.
Im Laufe des Stücks verliert der Leser aber seinen glauben an Blanche. In New Orleans scheint sie nur eine Fassade auszuleben, die bisher ihr Traum gewesen ist. Es kommen immer mehr Details ans Licht, die zeigen, dass Blanche bisher ein ganz anderes Leben führte. Damit verstößt sie Mitch, von dem sie sich eine Hochzeit und damit Stabilität erhofft hat. Anstatt ihre Lügen zuzugeben, flüchtet Blanche aber in stärker zur Schau gestellten Snobismus und weitere Traumwelten. So ist sie fest davon überzeugt, ein texanischer Millionär werde ihr schon helfen.
Stanley wird dadurch immer wütender und vergreift sich zuletzt gar an ihr. Bereits der Dramentext lässt die Dynamik und das Tempo erahnen, das das Stück gen Ende entfalten kann. Stanleys Entscheidung, Blanche in eine Nervenheilanstalt zu überweisen, wird von Stella mitgetragen. Es ist für sie die einzige Chance, in ihr altes Leben zurückzukehren. Denn mit Blanches Auftritt wurde auch sie skeptisch gegenüber Stanleys Verhalten, zeigte auch sie arrogante Züge. Insofern kann das Paar nun - übrigens mit Kind - zur alten, teilweise durchaus kritischen Normalität zurückkehren.
Neben dieser oberflächlichen Geschichte stecken weitere bedeutende Themen in der Handlung. Der alleinstehende Mitch muss sich um seine kranke Mutter kümmern. Beispielhaft zeigt das Stück wie so ein Verhalten in "männlichen" Runden aufgefasst wird. Blanche wird immer wieder als latent Trunksüchtig dargestellt - was allerdings auf viele Charaktere des Stückes zutreffen könnte. Außerdem hat Blanche in ihrer Jugend große Schuld auf sich geladen, als sie bei ihrem ersten Ehemann homosexuelle Neigungen feststellte und ihm mitteilte sie fände das abstoßend. Damit trieb sie ihn in den Selbstmord. Viele ihrer Psychosen scheinen von diesem Fehler entstanden zu sein.
In "A Streetcar Named Desire" treffen sich ein schlichter Macho und eine lügende Snobistin auf engstem Raum. Das führt zu einer für den Leser angenehmen Dynamik und zur Katastrophe. Dass sich in diesem Konflikt zweier kritikwürdiger Menschen letztlich der Macho durchsetzen kann, ist einerseits der Tatsache geschuldet, dass Blanche es sich mit allen Protagonisten verscherzt hat. Andererseits dürfte es leider in solchen Konflikten die Regel sein.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
