Damit Deutschland vorankommt (von Hubertus Heil und Armin Steinbach)
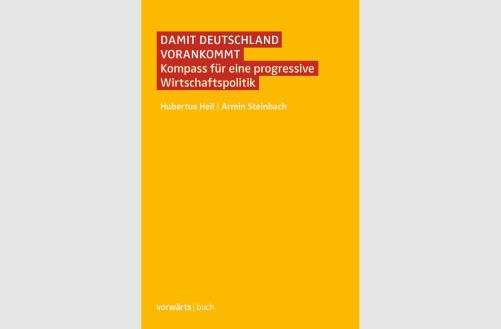
Einen "Kompass für eine progressive Wirtschaftspolitik" wollen die beiden Autoren mit dem etwa 160 Seiten starken Büchlein vorlegen. Daher ist das Buch klar strukturiert und folgt durchgehend der Kompass-Metaphorik. Zunächst legen die Autoren dar, warum es nötig ist, die Wirtschaftspolitik neu auszurichten, dann beschreiben sie fünf "Segel", die man ausrichten müsse.
Dass sich die Wirtschaft in einem Wandel befindet, dürfte zur Zeit klar sein. Ständig wird von der Eurokrise geredet, da ist klar, dass etwas passieren muss. Um so überraschter ist man zunächst, dass sich die Einleitung kaum um die Finanzkrise dreht. Stattdessen werden die Veränderungen in der Bevölkerungszusammensetzung (demographischer Wandel), die immer noch fortschreitende Globalisierung, der verstärkte Bedarf nach Fachkräften sowie die Ressourcenknappheit und die Probleme des Ressourcenverbauchs genannt. Das wirkt erst einmal wie Realitätsverweigerung. Nach der Lektüre der Einleitung ist man jedoch angenehm überrascht. Zwar wird viel Bekanntes wiederholt, doch da sich die Wirtschaftsberichtserstattung wie die Wirtschaftspolitik derzeit einzig darauf konzentriert, die Finanzkrise zu begleiten, ist das eine angenehme Abwechslung.
Außerdem setzen die Autoren damit auch ein Zeichen. Die Finanzmärkte gehören für sie nur indirekt zu einer progressiven Wirtschaftspolitik. Hier ist die Wirtschaft durch Betriebe repräsentiert die etwas erschaffen oder eine reale Dienstleistung anbieten. Dies - verbunden mit einer soliden Haushaltspolitik - sorgt für gesundes Wachstum. Die Finanzmärkte, das wird in einem der folgenden "Segel" erläutert, müssten dabei reguliert werden, um diese Entwicklung nicht zu stören. Somit erteilen die Autoren langjährigen Anhängern eine reinen Finanzmarktwirtschaftspolitik eine klare Absage.
Die fünf Handlungsfelder sind aus der Sicht der Autoren die Strukturpolitik, die Förderung von Investitionen und Binnenachfrage, die Qualifizierung von Arbeitnehmern sowie die Aufwertung der Arbeit, eine "kluge" Staatsfinanzierung sowie zuletzt eine Intensivierung der europäischen Integration als Antwort auf die Krise.
Dabei spricht aus allen Ansätzen der Gestaltungswille. Politik soll und darf nicht nur zuschauen. Stattdessen müssen aktiv Strukturen geschaffen werden. Das kann bekanntlich ordentlich schief gehen. Die Politik hat in der Wirtschaftspolitik desöfteren Millionen versenkt. Daher ist es gut, dass die Autoren auch immer wieder darauf hinweisen, dass politische Steuerung Grenzen hat. So entsteht der Eindruck eines durchdachten Mittelweges zwischen Marktüberlassung und staatlicher Steuerung.
Das Buch bietet tatsächlich einen Kompass für eine mögliche Wirtschaftspolitik. Das ist gleichzeitig aber auch die einzige Schwäche des Buches. An vielen Stellen muss es vage bleiben. Das ist keine Schande, schließlich sind auch Wahlprogramme grundsätzlich vage gehalten. Leider liest es sich an vielen Stellen jedoch wie ein Partei- bzw. ein Wahlprogramm. Es vieles grundsätzlich geklärt. Das hat jedoch den Vorteil, dass die Darstellung an vielen Stellen auch einen Überblick über die derzeitige Lage bietet. Das Buch bennent eine Vielzahl von Problemen, die vermutlich nicht einmal in zwei Legislaturperioden angegangen werden könnten. Daher weht mit den vorgeschlagenen Ausrichtungen "Segel" auch ein leicht utopischer Wind mit. Andererseits ist dies auch eine Grundbotschaft des Buches: Es ist viel zu tun, aber das bedeutet, dass auf jeden Fall etwas getan werden muss.
Das Buch verfällt an einigen Stellen in Allgemeinplätze und ist oft recht vage gehalten. Dabei formuliert es zumeist Positionen, die im "mitte-linken" Bereich wohl konsensfähig sind - von durchaus sinnigen Steuerhöhungen bis hin zu dem Versuch, im "internationalen Wettbewerb um Fachkräfte" mitzumischen (das konnten sich die Autoren leider nicht verkneifen). Beachtlich ist, dass die Diskussion hier nicht mit der Währungs- und Finanzkrise startet. Dadurch wird das Buch zu einer lohnenswerten Lektüre, die aufzeigt, was jetzt abseits der vielen Krisengipfel in Deutschland getan werden könnte - wenn wir denn eine andere Regierung hätten.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Die dunklen Zwillinge

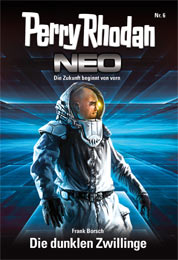 Der sechste Roman der "Perry Rhodan"-Neuerzählung setzt den Stillstand aus dem vorherigen Roman fort. Perry Rhodan ist aufgrund fehlender Auftritte endgültig höchstens als Statist zu bezeichnen, die Handlungsfortschritte der 160 Seiten sind marginal. Das ist enttäuschend, denn die Serie ist überraschend gut gestartet.
Der sechste Roman der "Perry Rhodan"-Neuerzählung setzt den Stillstand aus dem vorherigen Roman fort. Perry Rhodan ist aufgrund fehlender Auftritte endgültig höchstens als Statist zu bezeichnen, die Handlungsfortschritte der 160 Seiten sind marginal. Das ist enttäuschend, denn die Serie ist überraschend gut gestartet.Nun scheinen sich die Autoren lediglich an der Erstauflage zu orientieren, die in der Regel ebenfalls nur mäßige Handlungsfortschritte aufweisen kann. Dem Roman ist immerhin zugute zu halten, dass die Charaktere relativ authentisch wirken. Da der größte Teil des Romans aber wie im vorherigen fünften Band Rückblenden sind, hilft das wenig.
Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Perry Rhodan Neo 6 - Die dunklen Zwillinge (von Frank Borsch)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: What Judgments Come (von Dayton Ward & Kevin Dilmore)
 "What Judgments Come" ist der vorletzte Roman der Star Trek Romanserie "Vanguard". Doch anstatt die Haupthandlung um das mysteriöse Volk in der Taurus Region voranzutreiben und mehr Informationen über das merkwürdige Meta-Genom zu enthüllen, beschäftigt sich der Roman zum größten Teil mit dem Schicksal Diego Reyes. Der ehemalige Kommandant der Station ist von der Sternenflotte verurteilt und befindet sich derzeit als Asylant und Gefangener auf dem Schiff der Orioner, das an der Station angedockt ist.
"What Judgments Come" ist der vorletzte Roman der Star Trek Romanserie "Vanguard". Doch anstatt die Haupthandlung um das mysteriöse Volk in der Taurus Region voranzutreiben und mehr Informationen über das merkwürdige Meta-Genom zu enthüllen, beschäftigt sich der Roman zum größten Teil mit dem Schicksal Diego Reyes. Der ehemalige Kommandant der Station ist von der Sternenflotte verurteilt und befindet sich derzeit als Asylant und Gefangener auf dem Schiff der Orioner, das an der Station angedockt ist.Das liest sich gut und ist durchaus unterhaltsam. Es ist aber auch ärgerlich, denn die äußerst gut gestartete Reihe hängt seit einigen Romanen etwas fest und kann die Haupthandlung nicht vorantreiben. Dieser Roman ändert diesen Trend nicht.
Die komplette Rezension findet man auf Trekzone:
Star Trek Vanguard: What Judgments Come (von Dayton Ward & Kevin Dilmore)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Neinsagerland (von Rainer Knauber)
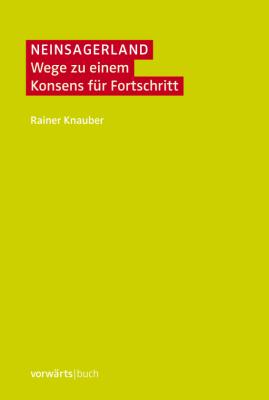 "Wege zu einem Konsens für Fortschritt" ist der Untertitel dieses Werkes, das sich vor allem mit der scheinbar neuen Erscheinung des "Wutbürgers" beschäftigt. Doch anstatt wirklich neue Wege aufzuzeigen, greift der Autor gerade einmal zu zwei Mitteln: Er appelliert an eine vermeintliche Vernunft und setzt auf handlungsfähige Politik mit bestenfalls überregionalen Volksentscheiden. Das ist verbunden mit einer äußerst undifferenzierten Herangehensweise an die Thematik, die es gar nicht zulässt, dass praktische Lösungen gefunden werden.
"Wege zu einem Konsens für Fortschritt" ist der Untertitel dieses Werkes, das sich vor allem mit der scheinbar neuen Erscheinung des "Wutbürgers" beschäftigt. Doch anstatt wirklich neue Wege aufzuzeigen, greift der Autor gerade einmal zu zwei Mitteln: Er appelliert an eine vermeintliche Vernunft und setzt auf handlungsfähige Politik mit bestenfalls überregionalen Volksentscheiden. Das ist verbunden mit einer äußerst undifferenzierten Herangehensweise an die Thematik, die es gar nicht zulässt, dass praktische Lösungen gefunden werden.Es gibt Bürgerinititativen gegen viele Dinge. Die meisten lehnen Infrastrukturprojekte ab. Dabei gibt es große Bewegungen wie die um Stuttgart 21 aber auch viele kleine Bewegungen, die mal eine Stromtrasse mal eine Umgehungsstraße verhindern wollen. Sie alle eint, dass sie etwas ablehnen. Damit liefern sie die Munition für den Titel dieses Buch: "Neinsagerland". Sie ermöglichen aber auch, dass die Partei von der sie am häufigsten unterstützt werden, mit dem Attribut "Die Dagegen Partei" bezeichnet werden kann. Häufig finden sich in diesen Bürgerinitiativen Menschen, die die Zeit großer staatlicher (aber auch privater) Bauprojekte beendet sehen wollen.
Knauber vertritt die gegenteilige Position. Deutschlands Wohlstand ruhe auf der Leistungskraft der Industrie. Damit die weiter produzieren kann, bedürfe es einer funktionierenden Infrastruktur. Um diese in Zeiten der Energiewende zu erhalten beziehungsweise rasch auszubauen braucht es möglichst schnelle Prozesse. Hier verhinderten aber eine unüberschaubare Anzahl von "Neinsager"-Bürgerinitativen, dass der Fortschritt vorangehen könne. Knauber argumentiert dabei genau so einseitig wie seine Gegner. Denn während die einen keinerlei Sinn in Bauprojekten sehen, sieht Knauber keinen Sinn in der Kritik daran. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit gegenseitigen Argumenten geschieht auch in diesem Buch nicht.
Knauber beschreibt in dem ersten Teil mit dem Titel "Ortstermin im Neinsagerland" welche Blüten die Protestkultur im Land bereits erreicht hat. Dabei wären viele Beobachtungen sehr interessant, wenn sie nicht so einseitig formuliert wurden. Selbst der Journalismus muss Kritik einstecken, da er protestierenden Bürgern Platz einräumt und somit einer Minderheit zu viel Raum gibt. Das sei früher anders gewesen. Diese Kritik ist hanebüchen und deplaziert, schließlich sind gerade die neuen Kommunikationsmöglichkeiten aller Bürger (!) ein demokratischer Vorteil.
Auch das Argument, dass Umweltorganisationen oft mehr Mittel zur Hand haben, als die Bauunternehmen zieht nicht. Denn die meisten Umweltorganisationen sind zwar mittlerweile wie Unternehmen aufgebaut. Dennoch können sie nicht in jede Bürgerinitative gleich viel Geld reinstecken. Auch Umweltorganisationen orientieren sich daran, wo sie Mitglieder einwerben können. Das sind bei einem kleinen Projekt dementsprechend weniger. Da Knaubers häufig wiederholtes Argument, Umweltorganisationen hätten meist mehr Mittel zur Hand als die Unternehmen, nicht belegt wird, ist es nicht besonders glaubwürdig.
Im zweiten Teil beschreibt Knauber dann, warum Fortschritt auch heute noch wichtig für Deutschlands Wohlstand ist. Seine These ist dabei, dass wir heute zu verwöhnt sind, um Infrastrukturmaßnahmen noch schätzen zu können. Daher bedürfe es - und das legt er im dritten Teil dar - einer neuen Vertrauenskultur. Diese müsse vor allem neue Werte schaffen, aber auch Politiker hervorbringen, die Projekte wieder aktiv vertreten. Dann könne man - im Zusammenspiel mit verbesserten Kommunikationsverfahren bei den Projekten und im Notfall überregionaler Volksentscheide - erreichen, dass das "Gemeinwohl" wieder im Mittelpunkt stehe und der "Fortschritt" voran komme. Interessant dabei ist, dass Infrastrukturmaßnahmen fast ungefragt dem Gemeinwohl dienen und Fortschritt darstellen.
Insofern zieht sich auch in der zweiten Hälfte des Buches eine undifferenzierte Sicht auf Infrastrukturmaßnahmen. Knauber arbeitet für ein Energieunternehemen, daher sieht er auch jede Investition in Energie bzw. ihre Transportwege als grundsätzlich positiv. Das ist kein Wunder, aber eine winzige Grundlage für ein Buch wie dieses.
Positiv zu vermerken ist in erster Linie, dass Knauber darauf hinweist, dass Projekte nicht an Minderheiten scheitern dürfen. Natürlich muss ein Dorf beteiligt werden, wenn eine Energietrasse in der Nähe gebaut wird. Aber dieses Dorf darf nicht Ursache dafür sein, dass in ganzen Landesteilen kein Strom ankommt. Das Beispiel Stuttgart 21 - Knauber konnte den Volksentscheid leider nicht mehr in das Buch einarbeiten - zeigt, dass überregionale Abstimmungen durchaus andere Mehrheiten als angenommen zutage bringen können.
Das Beispiel zeigt aber auch, dass die These des "Neinsagerlands" selbst zu hinterfragen ist. Knauber geht von dieser These wie selbstverständlich aus. Dafür bringt er eine Reihe von Beispielen an, die durch die Berichterstattung in den Medien verstärkt werden. Die Abstimmung zum Bahnhofprojekt in Stuttgart zeigt aber, dass mit der richtigen (und aufwendigen) Kommunikation durchaus Mehrheiten für Infrastrukturprojekte zu gewinnen sind. Sogar in Stuttgart stimmten die Mehrheit der Wähler dem Projekt zu. Daher ist auch Knaubers Hinweis auf das Abstimmungssystem in der Schweiz interessant. Dort ist nämlich noch kein Volksentscheid auf Bundesebene erfolgreich gewesen, der gegen die Interessen der Wirtschaft gerichtet ist. Auch aus diesem Grund sind Volksabstimmungen kritisch zu sehen. Denn auch wenn Knauber behauptet Umweltorganisationen hätten die höheren Budgets, bei Großprojekten sieht das anders aus. Und Wahlkampf braucht in erster Linie nun einmal Geld.
Knauber legt mit "Neinsagerland" also ein populistisches Werk vor, dass die Grundthese unkritisch anhand einiger Beispiele dramatisiert. Dabei ist das Buch an den besten Stellen ein eindringliches Plädoyer für einen starken Industriestandort Deutschland mit einer gemäßigten politischen Kultur, die zum Konsens fähig ist und am Gemeinwohl orientiert ist. An den schlimmsten Stellen hetzt das Buch gegen alle großen und kleinen Initiativen, die es wagen, ein Bauprojekt zu verzögern.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Die Pest in Sydney

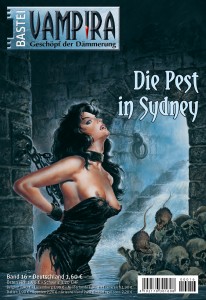 Nach dem letzten "Traumheft" kehrt die Handlung der Serie nun in die Realität zurück. Die Apokalypse ist noch nicht ganz verhindert. Denn ein tasmanischer Teufel ist noch mit dem Bösen infiziert und bringt die Pest nach Sydney.
Nach dem letzten "Traumheft" kehrt die Handlung der Serie nun in die Realität zurück. Die Apokalypse ist noch nicht ganz verhindert. Denn ein tasmanischer Teufel ist noch mit dem Bösen infiziert und bringt die Pest nach Sydney.Der Titel verrät eigentlich schon die größte Überraschung des Romans. Als die Akteure die Krankheit im Roman benennen können, weiß der Leser das längst. Dennoch ist der Beginn des Romans recht gelungen. Er im Verlauf wird die Handlung schwächer, da sich eine einfach, überstürzte Lösung des Problemes abzeichnet.
Die ganze Rezension findet man bei SF-Radio:
Vampira Band 16 - Die Pest in Sydney (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Der dunkle Thron (von Rebecca Gablé)
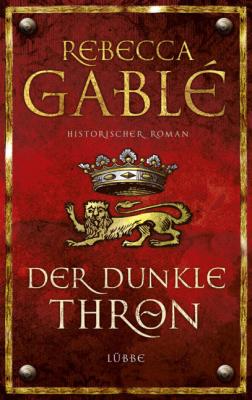 "Der dunkle Thron" führt die Warringham-Saga fort. Wie immer spielt der Roman einige Jahrzehnte nach dem letzten. Dadurch benötigt der Leser keine Vorkenntnisse aus den vorherigen Romanen. Diesmal liegen zwischen den Akteuren aus "Das Spiel der Könige" sogar zwei Generationen. Diesmal muss der junge Nick Warringham die Heruntergekommene Grafschaft Warringham übernehmen, als sein Vater im Auftrag Henry VIII. zu Tode gefoltert wird. Doch der unberechenbare König ist nicht Nicks einziges Problem. Das Gut bringt kaum noch Profite, die Zeit des Adels ist vorbei und seine Stiefmutter hat ein Anrecht darauf, in Warringham wohnen zu bleiben. Ihr Ziel ist es, Nick vom Gut zu verdrängen und ihren Bruder als neuen Herrscher einzusetzen. Als wären diese Probleme nicht bereits genug, ist Nick auch noch überzeugter Katholik. Das sorgt für einen weiteren Konflikt mit dem König und dafür, dass Nick dessen erstgeborene Tochter Marie unterstützt.
"Der dunkle Thron" führt die Warringham-Saga fort. Wie immer spielt der Roman einige Jahrzehnte nach dem letzten. Dadurch benötigt der Leser keine Vorkenntnisse aus den vorherigen Romanen. Diesmal liegen zwischen den Akteuren aus "Das Spiel der Könige" sogar zwei Generationen. Diesmal muss der junge Nick Warringham die Heruntergekommene Grafschaft Warringham übernehmen, als sein Vater im Auftrag Henry VIII. zu Tode gefoltert wird. Doch der unberechenbare König ist nicht Nicks einziges Problem. Das Gut bringt kaum noch Profite, die Zeit des Adels ist vorbei und seine Stiefmutter hat ein Anrecht darauf, in Warringham wohnen zu bleiben. Ihr Ziel ist es, Nick vom Gut zu verdrängen und ihren Bruder als neuen Herrscher einzusetzen. Als wären diese Probleme nicht bereits genug, ist Nick auch noch überzeugter Katholik. Das sorgt für einen weiteren Konflikt mit dem König und dafür, dass Nick dessen erstgeborene Tochter Marie unterstützt.Rebecca Gablé beschreibt im Nachwort selbst, dass es für sie eine Herausforderung war, sich in das England der Rennaissance einzuarbeiten. Für den Leser ist es jedoch ein Gewinn, dass sie das gewagt hat und von ihrer Ankündigung, nach den Rosenkriegen könne sie die Geschichte nicht mehr weitererzählen, weil das Mittelalter zu Ende ist, abgewichen ist. Denn der Roman ist - wie alle ihre Romane - fesselnd geschrieben. Allerdings ist der Epochenwechsel auch für den Leser eine herbe Umstellung.
Gablés Romane handelten im Kern immer um unterlegene Ritter, die in der Geschichte ihren Platz suchten und sich dabei äußerst gut schlugen. Meist waren sie zudem moralisch integer und hatten im Laufe des Romans neben der Haupthandlung auch noch Probleme auf ihrem Gut zu lesen und eine Liebesbeziehung zu ordnen. All diese Zutaten gibt es auch im neuen Roman. Diesmal sind die Vorzeichen jedoch ganz anders.
Denn Ritter haben längst nichts mehr zu sagen. Wer braucht Schwerter, wenn er Schießpulver haben kann? Daher kommt es im Roman zu keiner einzigen beschreibenen Schlacht. Der Held, Nick, ist zwar kein Pazifist, glaubt aber bereits daran, dass es gerechte und ungerechte Kriege gibt. Und da in dem Roman kein gerechter Krieg vorkommt, nimmt er auch an keinem Krieg teil.
Die Ritter haben nicht nur ihre militärische, sondern auch ihre gesellschaftliche Stellung verloren. Längst ist es reichen Kaufleuten möglich, sich in den Adel einzukaufen. Der traditionelle Adel wiederum verarmt, da die Landwirtschaft kaum noch Profit abwirft. Der nahende Kapitalismus zeichnet sich durch das "Eingemeinden" von Weideflächen bereits ab. Nick ist einer der letzten Vertreter des "alten" Adels. Dadurch kann er sich manchmal retten, wirkt aber auch wie ein Unikat.
Nick ist jedoch bei weitem nicht so integer wie frühere Charaktere. Während die durchaus Probleme mit ihren Frauen hatten, erzeugt Nick das Problem in weiten Teilen selbst. Denn obwohl er humanistisch gebildet ist, behandelt er seine Mätresse außergewöhnlich schlecht. Durch eine Undercover-Mission ist er gezwungen, seine Mätresse Polly zu heiraten. Aber anstatt zu erkennen, dass dies seine eigene Schuld ist, verübelt er dies seiner Frau. Dabei ist es schade, dass Gablés Charaktere außerordentlich undifferenziert mit sich selbst umgehen. Schon immer stand die Geschichte im Vordergrund, die durch relativ starre Figuren getragen wurde. Hier wäre es schön, wenn Nick einen deutlicheren Lernprozess im Verlauf des Romans erleben wurde. Der Lernprozess beschränkt sich jedoch lediglich darauf, dass er den gemeinsamen Sohn anerkennt und nicht den Sohn mit seiner zweiten, adligen Frau als Erben einsetzt. Das ist etwas wenig.
Der Roman ist extrem brutal und dennoch sterben bedeutend weniger Personen als in vorherigen Romanen. Denn während früher hundertfach Bauern und Ritter auf dem Schlachtfeld anonym ihr Leben ließen, ist die häufigste Todesursache in "Der dunkle Thron" die Exekution. Während der übelsten Phasen von Henrys Herrschaft werden reihenweise Adlige exekutiert, während Nick alles aus dem Tower beobachten muss. Die Hinrichtungen werden im Verlauf des Romans jedoch zur Normalität, da die Grausamkeit nicht steigt. Das ist vermutlich gewollt. Denn zu Beginn ist es noch ein Skandal, dass eine Königin und Adlige zum Schaffot geführt werden. Zum Ende von Henrys Regentschaft ist das beinahe ein alltägliches Ereignis.
Sowieso schwingt immer wieder etwas Bedauern über den Verlust des "geordneten" Mittelalters wieder. Die Verhältnisse sind äußerst unübersichtlich und die "Sitten" verfallen zunehmend. Der König kann zunehmend das Gewaltmonopol für sich beanspruchen und hält somit mehr Macht in den Händen. Die Sicherheit, dass langfristig alles so bleibt wie es ist, wird durch zunehmende Unsicherheit in allen Bereichen ersetzt. Insofern ist "Der dunkle Thron" eine gelungene Beschreibung des damaligen "Zeitgeistes".
Der Roman hält sich natürlich wieder eng an historische Ereignisse, die durch die Warringhams ergänzt werden. Dadurch erfährt man durch die spannende Lektüre wieder viel über einen vermeintlich bekannten Teil der englischen Geschichte.
"Der dunkle Thron" ist anders als seine mittelalterlichen Vorgänger. Kämpfe spielen kaum noch eine Rolle, denn gegenüber der Macht des Königs ist jeder Widerstand zwecklos. Stattdessen ist jetzt Geschick, Bildung und Intrigenfähigkeit nötig, um in einer unsichereren Welt zu überleben. Dabei ist mit Nick Warringham endlich ein Charakter Held der Geschichte, der nicht herzensgut ist. Im Gegenteil, seine erste Frau behandelt er schlecht, für den Katholizismus ignoriert er auch mal seinen Moralkodex. Wenn die Charaktere des Romans jetzt noch größere Lernprozesse durchlaufen würden, wäre die Geschichte noch etwas besser. Das ist jedoch kaum nötig, denn "Der dunkle Thron" unterhält auch so bestens und ist eine spannende und gleichzeitig lehrreiche Lektüre.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Vertraue nie einem Genetic

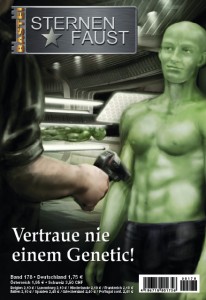 Die Sternenfaust bringt eine Wissenschaftlerin der Genetics zurück auf ihre Heimatwelt. Auf dem Weg treffen sie auf abtrünnige Genetics und finden heraus, dass sich ein Spion der Gemini auf der Sternenfaust befindet. Jeder und jede ist verdächtig.
Die Sternenfaust bringt eine Wissenschaftlerin der Genetics zurück auf ihre Heimatwelt. Auf dem Weg treffen sie auf abtrünnige Genetics und finden heraus, dass sich ein Spion der Gemini auf der Sternenfaust befindet. Jeder und jede ist verdächtig.
Der aktuelle "Sternenfaust"-Roman spielt ausschließlich auf dem Schiff und ist sehr gelungen. Die Geschichte ist schnell und spannend. Und endlich steht die Sternenfaust mal wieder ganz im Mittelpunkt der Geschichte.
Die ganze Rezension findet man wie immer bei SF-Radio:
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Schule der Mutanten


Der fünfte Roman der "Perry Rhodan Neo"-Reihe unterhält gut wie eh und je. Doch langsam fällt auf, dass die Haupthandlung nicht vorankommt. Jeder Roman beginnt damit, dass Perry Rhodan aussichtslos unter einem Schutzschirm in der Wüste Gobi sitzt und er endet auch damit. Das hemmt mittlerweile den Spaß an der Serie ein wenig.
Die komplette Rezension findet man wie immer auf SF-Radio:
Perry Rhodan Neo 5 - Schule der Mutanten (von Michael Marcus Thurner)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Ich, Creanna

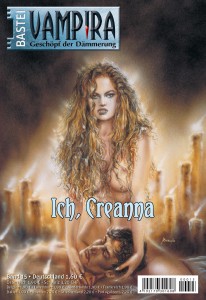
"Ich, Creanna" erzählt durch einen erzählerischen Trick die Lebensgeschichte von Liliths Mutter, Creanna. Das ist nicht besonders spannend, denn Creannas Charakter unterscheidet sich nur unwesentlich von Liliths. Obwohl der Roman flüssend und an einigen Stellen beinahe spannend geschrieben ist, erfährt der Leser nur wenig Neues. Das meiste konnte man sich bereits aus vorherigen Romanen zusammenreimen. Einzig und allein das Verhalten von Creannas Mutter, Liliths Großmutter ist relativ interessant, denn über die Person weiß man bisher wenig. Da sie sich jedoch sehr mysteriös und geheimnisvoll verhält, erfährt man auch dadurch nichts Neues. Also handelt es sich um einen netten Roman mit wenig Relevanz für die Handlung der Serie.
Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Vampira Band 15 - Ich, Creanna (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Ellerts Visionen

 Der vierte "Perry Rhodan Neo"-Roman fühlt sich wie ein Lückenfüller an. In fünf Teilen werden die Erlebnisse von fünf Protagonisten angerissen, immer an der spannendsten Stelle gibt es jedoch einen Cliffhanger, keine Handlung wird zu einem wirklichen Ende geführt. Als Lückenfüller ist der Roman gut gemacht und durchaus unterhaltsam. Der nächste Roman wird die Story jedoch endlich voranbringen müssen und die vielen, in diesem Roman aufgeworfenen Fragen, auflösen.
Der vierte "Perry Rhodan Neo"-Roman fühlt sich wie ein Lückenfüller an. In fünf Teilen werden die Erlebnisse von fünf Protagonisten angerissen, immer an der spannendsten Stelle gibt es jedoch einen Cliffhanger, keine Handlung wird zu einem wirklichen Ende geführt. Als Lückenfüller ist der Roman gut gemacht und durchaus unterhaltsam. Der nächste Roman wird die Story jedoch endlich voranbringen müssen und die vielen, in diesem Roman aufgeworfenen Fragen, auflösen.Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Perry Rhodan Neo - Ellerts Visionen (von Wim Vandemaan)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
... ältere Einträge
