 "Les Raisins de la galère" ist ein französischer Roman, der etwas schwieriger zu lesen ist, als die bisherigen französischen Bücher, die auf dieser Seite vorgestellt wurden. Das liegt vor allem an den vielen umgangssprachlichen Begriffen sowie der Vokabelvielfalt, die in dem Roman verwendet werden.
"Les Raisins de la galère" ist ein französischer Roman, der etwas schwieriger zu lesen ist, als die bisherigen französischen Bücher, die auf dieser Seite vorgestellt wurden. Das liegt vor allem an den vielen umgangssprachlichen Begriffen sowie der Vokabelvielfalt, die in dem Roman verwendet werden.In dem Roman schildert Nadia, die Tochter eines algerischen Einwanderers, ihr bisheriges Leben in einer Pariser Vorstadt. Sie muss schon früh erfahren, dass sie in der französischen Mehrheitsgesellschaft als Algerierin einen schweren Stand hat und dass sie als Frau in der eigenen Familie beziehungsweise unter anderen Muslimen einen schweren Stand hat. Ersteres erfährt sie als der kommunistische Bürgermeister die Familie enteignet, um Platz für einen Supermarkt zu schaffen. Die Entschädigung ist lächerlich gering, sodass das mühevoll aufgebaute Haus des Vaters durch eine simple Mietwohnung ausgetauscht werden muss. Nadias Vater verliert dadurch einen Großteil seines Lebensmut. Zweites stellt sie zum ersten Mal fest, als die Mutter sich entschieden dagegen wehrt, dass ihre Tochter Mechanikerin werden möchte.
Nadia schildert zunächst anekdotenhaft Situationen, die einem die Zustände in dem Viertel verdeutlichen. Sie ist umgeben von Rassismus, Kriminalität und Drogen. Daher muss sie miterleben, wie viele ihrer Freunde sozial immer weiter absteigen und gleichzeitig auch noch ausgegrenzt werden. Schon früh stört sie sich daran, was sie von anderen Menschen im Viertel unterscheidet. Sie geht gegen Missstände vor. Bald ist sie daher in vielfacher Sicht isoliert. Muslimische Männer fürchten sich geradezu vor ihr, während sie bei Franzosen eher als nervig wirkt.
Halt gibt ihr zunächst der Vater, später ihr Freund. Durch mehrere Studiengänge eignet sie sich immer mehr Wissen an, um gegen Missstände vorzugehen und kandidiert zuletzt für die Grünen unter Tolerierung durch die Kommunisten für das Parlament. Im Wahlkampf muss sie sich noch einmal mit den beiden oben angerissenen Problemen auseinandersetzen und versucht gleichzeitig, möglichst vielen "Einwanderkindern" zu helfen. Dabei gelingen ihr ein paar Sachen, dass meiste scheitert jedoch an den Verhältnissen.
Gerade der Schluss des Romans, in dem laut Kommentar "großartige Bilder" vorkommen, ist sprachlich schwieriger als der Anfang. Nadia erreicht einen relativ abgeklärten Zustand, in dem es ihr kaum noch etwas ausmacht, dass sie von den Grünen nur als Scheinkandidatin missbraucht wurde. Für sie ist einfach wichtig, auf Probleme aufmerksam zu machen. Ihre eigene Position ist ihr dabei egal. Trotzdem ist der Anfang beeindruckender, vermittelt er doch, ein realistisches Bild von den Zuständen in einem Pariser Vorort der 80er und 90er Jahre zu zeichnen. Die Schilderung macht deutlich, wie wenig man sich auch in Frankreich darum gekümmert hat, Einwanderern das Gefühl zu geben, willkommen zu sein.
"Les Raisins de la galère" ist teilweise sprachlich anstrengend. Dafür ist jedoch gerade die erste Hälfte des Romans recht beeindruckend.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
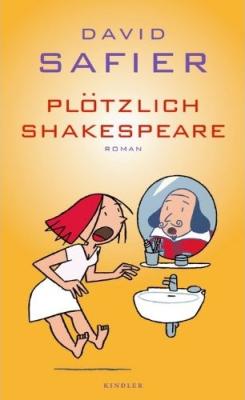 Rosa ist unglücklich. Sie ist eine durchschnittliche, pummelige Frau und ihr Ex-Freund, den sie immer noch liebt, heiratet. Das macht sie sehr unglücklich, denkt sie doch, sie und er wären füreinander geschaffen. Sie interveniert daher und muss eine Zurückweisung einstecken. Während ihrer darauf folgenden Depression trifft sie auch einen Wahrsager, der sie in einen anderen Körper versetzt, damit sie dort die wahre Liebe kennen lernt. Sie erwacht kurz darauf in dem Körper von William Shakespeare auf...
Rosa ist unglücklich. Sie ist eine durchschnittliche, pummelige Frau und ihr Ex-Freund, den sie immer noch liebt, heiratet. Das macht sie sehr unglücklich, denkt sie doch, sie und er wären füreinander geschaffen. Sie interveniert daher und muss eine Zurückweisung einstecken. Während ihrer darauf folgenden Depression trifft sie auch einen Wahrsager, der sie in einen anderen Körper versetzt, damit sie dort die wahre Liebe kennen lernt. Sie erwacht kurz darauf in dem Körper von William Shakespeare auf...Auch David Safiers vorherige Bücher hatten schon etwas von kitschigen Frauenromanen. In seinem dritten Roman übertreibt er es aber damit. Wieder einmal ist die Hauptfigur weiblich, von durchschnittlicher Figur aber mit einer überguten Seele. Eigentlich hätte man alle bisherigen Frauen aus Safiers Romanen bis auf winzige Nuancen auch miteinander vertauschen können.
Während die anderen Romane aber immerhin leidlich komisch waren, ist das bei "Plötzlich Shakespeare" nicht mehr der Fall. Zunächst gerät Rosa in Shakespeares Zeit. Das wirkt seltenst authentisch. Safier gibt offen zu, dass er historische Begebenheiten wild mixt. Dabei kommt jedoch nichts wirklich witziges heraus. Stattdessen wird der Leser mit Standardwitzen, allerlei sexuellen Anspielungen und vielen peinlichen Situationen gelangweilt.
Der Aufenthalt im England des 16. Jahrhunderts dauert viel zu lang, der Aufenthalt in der heutigen Zeit ist dann wieder zu kurz. Rosa bekommt gerade einmal genügend Platz, um sich noch einmal so richtig zu blamieren. Danach kehrt sie wieder in Shakespeares Zeit zurück, um herauszufinden, was wahre Liebe bedeutet. Das Fazit, dass man erst geliebt werden kann, wenn man mit sich selbst im Reinen ist, ist zwar sinnig, wird aber auf sehr kitschige Art und Weise erreicht.
Man muss dem Buch aber immerhin zu Gute halten, dass das Fazit im Raum stehen bleibt. Rosa findet nicht noch auf den letzten Seiten ihren Traummann, auch wenn man sich vorstellen kann, wer das sein könnte. Dennoch hinterlässt "Plötzlich Shakespeare" einen sehr zwiespältigen Eindruck. Die Hautpfigur ist langweilig, der Witz kaum vorhanden und die Handlung nicht besonders originell. Dieser Roman von Safier kann nicht überzeugen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Rosenstolz -- Wir sind am Leben - MyVideo
Heute erscheint nach drei Jahren Pause das neue Rosenstolz Album "Wir sind am Leben". Die gleichnamige Single ist bereits seit zwei Wochen draußen, das Lied selbst wird schon seit mehreren Wochen im Radio gespielt. Stand das Vorgängeralbum "Die Suche geht weiter" im Zeichen der Reflektion über Vergangenes und den hoffnungsvollen Blick auf die Zukunft, wurde das neue Lied vor allem unter dem Blickwinkel von Peter Plates Burn-Out-Syndrom betrachtet.
Diese Betrachtung mag gar nicht mal so weit hergeholt wirken. Denn obwohl das Lied ruhig anfängt, wirkt der Rhythmus spätestens ab dem ersten Refrain fröhlich und bei den ersten Höhrgängen sogar etwas zu knallig. Die Dynamik des Liedes wirkt zunächst etwas Rosenstolz untypisch, da AnNas Stimme hinter den Klängen beinahe etwas zurückbleibt. Das anfänglich deutlich hörbare und immer mal wiederkehrende Klavierspiel wirkt da eher "rosenstolztypisch". Dafür macht das Lied trotz eines eher nachdenklichen Themas gute Laune.
Der Text wirkt zunächst verdammt platt und enttäuschend. AnNa haucht die ersten Passagen eher, ihre Stimme wirkt bei weitem nicht so kraftvoll wie in früheren Liedern. Von den acht Zeilen des Refrains ist die Hälfte die ewige Wiederholung des Satzes "Du bist am Leben". Das wir wird - ähnlich wie bei "Ich bin Ich (Wir sind wir)" - erst ganz zum Schluss eingeführt. Im Gegensatz zu der ersten Single-Auskoppelung von 2006 steht das "wir" hier jedoch ganz im Titel, weswegen die größere Betonung des "wirs" gelungener gewesen wäre.
Außerdem sorgt dei zuvor schon beschriebene, teilweise krachige Hintergrundmusik, in der das Klavierspiel fortgesetzt wird und ein aufdringliches Schlagzeug hinzukommt, dass man der Inhalt zweitrangig wirkt. Das ist erst enttäuschend und bei mehrmaligem Hören schade. Denn der Text hat durchaus Beachtung verdient.
Die ersten zwei Strophen dienen als Aufrüttelung und bestehen hauptsächlich aus Fragen. Hast Du alles probiert? [...] Wenn nicht fang an. Hier wird in erster Linie auf mögliche Versäumnisse hingewiesen und das gleichzeitig mit der Aufforderung verbunden, diese möglichst rasch zu beseitigen. Dabei zielen die Fragen nicht auf konkrete Dinge oder Handlungen ab, sondern eher auf generelle Zustände. Hat man "probiert", "versucht", "getan", "gelebt" und "gedreht" was man wollte beziehungsweise wie man wollte. Diese Fragen sind gar nicht mal so einfach zu beantworten und sicherlich hat nicht jeder sich mit jeder auseinandergesetzt. Daher fungiert die dritte Strophe als Aufforderung zur Zielbestimmung. Eine Reihe von "W"-Fragen fügt sich zu einer Strophe zusammen, die eine Reihe von wichtigen Lebensfragen abdeckt. Auch hier geht es darum, dass sich der Hörer nach den Fragen, ob man genug getan hat, darüber im Klaren wird, was er eigentlich tun will. Der erste Teil vor dem Refrain fordert den Hörer auf, sich damit auseinanderzusetzen, was man im Leben erreichen möchte, wie man sein Leben lebt und ob man diesen Zielen tatsächlich folgt.
Der Refrain folgt dann einem anderen Schema. Hier wird nicht dazu angeregt, den eigenen Lebensstil zu hinterfragen, sondern es wird allgemein ermutigt. Keiner wird Dich zerstören, folgt dabei der ultimativen Bestätigung des Lebens, dem Herzschlag. Solange "Feuer" sprich Elan und "Liebe" vorhanden seien, sei das Herz dann auch über die biologische Funktion hinaus am Leben. Das ist nett, aber wie bereits erwähnt, etwas zu stark auf eine Zeile (Du bist am Leben) fixiert.
Der zweite Teil beschäftigt sich in drei Strophen dann mit den Grenzen der eigenen Ziele. Sie drehen sich um "glauben", Betrug und natürlichem Widerstand. Jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Das wird hier hinterfragt. An was willst Du glauben, oder glaubst Du an Dich, verrät dabei genau so eine kritische Einstellung gegenüber Glaubensmodellen, die über den Glauben an Selbstverwirklichung hinausgehen, wie die spätere Zeile Und für wen wirst Du beten, weißt Du wirklich warum. Keinen Glauben einfach hinnehmen, sondern auch einmal zu hinterfragen, ist die Aufforderung dieser Zeilen. Dabei ist auch der Glauben an die eigenen Fähigkeiten nicht zu unterschätzen.
Auch das Thema des Betruges dreht sich nicht nur um das "betrogen werden". Wie oft belügst Du Dich, weißt auch darauf hin, dass es durchaus beliebt ist, sich selbst etwas vorzumachen. Oft merkt man gar nicht, in welchen Situationen man sich selbst etwas vormacht.
Es hilft nun aber nichts, alles erreichen zu wollen. Jede Zielsetzung bedarf auch einer vorherigen Überprüfung, was überhaupt machbar ist. Wie viel Tür'n wirst Du öffnen, welches Schloss knackst Du nie, drückt genau das aus. Denn es hilft auch, wenn man sich bewusst ist, welche Schlösser einem verschlossen bleiben beziehungsweise vor was man "in die Knie" geht. Die letzte Strophe des zweiten Teils konzentriert sich dann darauf, an welchen Dingen man "weint" beziehungsweise "stumm" bleibt. Hierein fällt auch die oben genannten "beten"-Zeilen. Sie wird abgeschlossen mit der Aufforderung darüber nachzudenken, mit wem man eigentlich lebt. Bei wem will man "schlafen", vor wem "rennt" man weg, für eine Lebsensführung ist es auch wichtig, sich mit seinen Mitmenschen zu arrangieren.
Insgesamt, das wird glaube ich aus den obigen Ausführungen sehr deutlich, bestehen die Strophen vor allem aus Fragen, die zum Nachdenken auffordern. Das wird leider nicht durch die Melodie unterstützt. Die Fragen wirken beim Hören des Liedes kaum wie Fragen. Vielleicht ist das aber auch ein Vorteil, schließlich will man sich nicht häufiger ein Lied anhören, das sich wie eine Ansammlung von Aufforderungen anhört.
So ist das Lied gut anzuhören. Es besitzt zudem die typische "Rosenstolz"-Eigenschaft, dass es mit jedem Mal hören etwas besser wird. Denn erst dann fällt einem der Text so auf, dass man auch darüber nachzudenken anfängt. Die Instrumentalik sorgt dafür, dass das eher reflektierende Thema in ein aufbrechendes, fröhliches Lied verwandelt wird. Dieser Widerspruch wirkt aber nicht besonders merkwürdig. Stattdessen sorgt die Unterschiedlichkeit dafür, dass man das Lied auch gerne hört.
Nach mehrfachem Hören in den vergangenen Wochen wirkt das Lied auf mich jetzt beinahe sehr gut. Es kommt nicht an viele sehr gute Rosenstolz-Lieder heran. Doch der interessante Unterschied zwischen Text und Melodie, der teilweise sehr gelungene Text und das nachdenkliche und doch den Höhrer fordernde Thema überzeugen durchaus.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

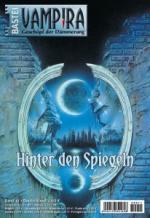 "Hinter den Spiegeln" setzt nahtlos an dem Vorgängerroman an. Obwohl die Handlung um Lilith nicht komplett mitreißen kann, ist das Heft überzeugend. Denn die beiden Nebenhandlungen, die erzählt werden, sind spannend und gelungen. Außerdem erfährt Lilith in diesem Roman ein wenig über ihre Herkunft und es werden zwei frühere Handlungen wieder aufgegriffen, was gut für die Kontinuität ist.
"Hinter den Spiegeln" setzt nahtlos an dem Vorgängerroman an. Obwohl die Handlung um Lilith nicht komplett mitreißen kann, ist das Heft überzeugend. Denn die beiden Nebenhandlungen, die erzählt werden, sind spannend und gelungen. Außerdem erfährt Lilith in diesem Roman ein wenig über ihre Herkunft und es werden zwei frühere Handlungen wieder aufgegriffen, was gut für die Kontinuität ist.Die komplette Rezension ist bei SF-Radio zu lesen:
Vampira Band 11 - Hinter den Spiegeln (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

 Der "große Leere"-Zyklus befindet sich im zweiten von drei Romanen des Finales. Die Ereignisse überschlagen sich. Im Sol-System duellieren sich zwei übermächtige Rassen mit Millionen von Raumschiffen, dabei sterben Milliarden von Menschen. Diese Gigantomanie ist neu in der Serie. Außerdem gelingt es dem Roman nicht, den notwendigen "Schrecken" zu erzeugen, die der Verlust so vieler Leben eigentlich hervorrufen müsste.
Der "große Leere"-Zyklus befindet sich im zweiten von drei Romanen des Finales. Die Ereignisse überschlagen sich. Im Sol-System duellieren sich zwei übermächtige Rassen mit Millionen von Raumschiffen, dabei sterben Milliarden von Menschen. Diese Gigantomanie ist neu in der Serie. Außerdem gelingt es dem Roman nicht, den notwendigen "Schrecken" zu erzeugen, die der Verlust so vieler Leben eigentlich hervorrufen müsste.Trotz der gewissen Distanz ist der Roman aber flüssig und spannend zu lesen. An welchen Schwächen der zweite Teil des Finales dennoch krankt, erfährt man in der ganzen Rezension auf SF-Radio:
Sternenfaust Band 173 - Invasionsstufe Drei (von Thomas Höhl)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Parteibindungen sind in Berlin gering. CDU und SPD erreichten zuletzt 1990 eine Zweidrittelmehrheit aller Wählerstimmen. Bei der Bundestagswahl 2009 gab es in Berlin sogar vier etwa gleich große Parteien: Die CDU holte 23, SPD und Linke 20 und die Grünen 17 Prozent. Dabei gab es zum Teil heftige Verschiebungen im Vergleich zu früheren Wahlen, die ebenfalls auf eine eher lose Parteibindung hindeuten.
Das ist nicht schlecht. Schließlich können so die Inhalte eine Rolle spielen. Alle Parteien stehen unter einem viel größeren Druck, ihre Politik zu erklären und sich im Wettkampf durchzusetzen. Das schlichte Vertrauen auf die eigenen Stammwähler hilft in so einem Fall nicht mehr.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
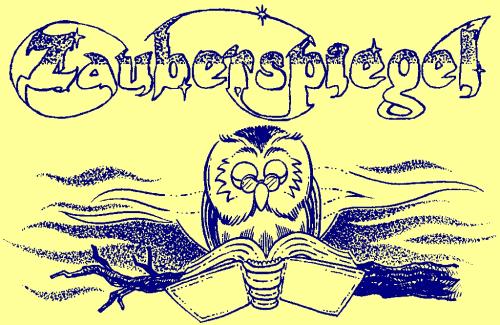
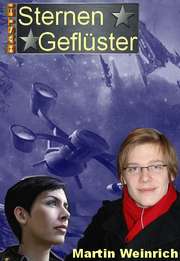 Das Finale des "großen Leere"-Zyklus hat vor kurzem mit dem Roman "Das Ende einer Ära" begonnen. Zwei weitere Teile werden sich dem noch anschließen. Die Titel verkünden alle Großes. Nach dem Ende einer Ära soll es mit einer "Invasionsstufe Drei" und der titelgebenden "Großen Leere" weitergehen.
Das Finale des "großen Leere"-Zyklus hat vor kurzem mit dem Roman "Das Ende einer Ära" begonnen. Zwei weitere Teile werden sich dem noch anschließen. Die Titel verkünden alle Großes. Nach dem Ende einer Ära soll es mit einer "Invasionsstufe Drei" und der titelgebenden "Großen Leere" weitergehen.In anderen Serien führt das häufig zu enttäuschten Erwartungen. Im letzten Zyklus war das bei "Sternenfaust" jedoch anders. Und auch diesmal gibt es gute Chancen, dass das Finale nicht enttäuschen wird. Die aktuelle "Sternenfaustkolumne" beschäftigt sich damit, warum dies so ist.
So viel Finale war nie
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Der Maschinist Etienne ist während einer Wirtschaftskrise in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich auf Arbeitssuche. Nach mehreren Tagen ohne Arbeit erhält er durch Zufall eine Stelle in dem Bergarbeiterschacht von Montsou. Schnell bemerkt er, wie schlecht es den Arbeitern geht. Sie arbeiten viel, riskieren Gesundheit und Leben und verdienen dennoch nicht genug zum Leben. Etienne versucht möglicht viele Kumpel zu überreden, der Internationalen beizutreten. Doch kaum jemand will auf ihn hören. Lediglich die Einrichtung einer Streikkasse überzeugt die Bergarbeiter. Kurz nach deren Einrichtung senkt die Gesellschaft indirekt den Lohn. Daraufhin ruft Etienne die Bergarbeiter zum Streik auf. Sie folgen ihm, doch seine Methoden und auch die Verhältnisse machen es nicht möglich, dass der Streik für die Arbeiter zu gewinnen ist.
Der Maschinist Etienne ist während einer Wirtschaftskrise in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Frankreich auf Arbeitssuche. Nach mehreren Tagen ohne Arbeit erhält er durch Zufall eine Stelle in dem Bergarbeiterschacht von Montsou. Schnell bemerkt er, wie schlecht es den Arbeitern geht. Sie arbeiten viel, riskieren Gesundheit und Leben und verdienen dennoch nicht genug zum Leben. Etienne versucht möglicht viele Kumpel zu überreden, der Internationalen beizutreten. Doch kaum jemand will auf ihn hören. Lediglich die Einrichtung einer Streikkasse überzeugt die Bergarbeiter. Kurz nach deren Einrichtung senkt die Gesellschaft indirekt den Lohn. Daraufhin ruft Etienne die Bergarbeiter zum Streik auf. Sie folgen ihm, doch seine Methoden und auch die Verhältnisse machen es nicht möglich, dass der Streik für die Arbeiter zu gewinnen ist.Germinal beginnt langsam. Detailreich beschreibt Zola die Arbeiter der Dörfer. Zwischendurch wendet er sich immer auch mal ihren Chefs zu. Zum Beispiel lebt nur etwas entfernt von den ärmlichen Arbeiterdörfern eine Familie, die einzig und allein davon lebt, dass ein Vorfahre in die anliegende Miene investiert hat. Von der Rente, die die Aktien abwerten, kann die Familie bestens leben. Diese Gegenüberstellung von Arbeitern und Kapitalisten ist sehr gelungen. Denn aus Zolas Perspektive ist relativ klar, dass die Arbeiter in ihren Wünschen Recht haben. Er macht aber auch deutlich, dass beide Seiten innerhalb ihrer Vorstellungskraft und Wahrnehmung logisch handeln und eigentlich nicht anders handeln können.
Dennoch kritisiert er die kapitalistische Seite in dem Text deutlich. Vor allem der Verwalter der Mienen wird von Zola gerade dadurch, dass er ihn als logisch denkenden Menschen schildert, stark kritisiert. Denn während auf Arbeiter geschossen wird, beneidet er sie, dass ihr Leben doch so einfach ist.
Beachtlich ist aber auch, wie lebendig das Arbeiterdorf in Zolas Schilderung wirkt. Auch heute noch kann man sich durch seine Beschreibungen gut vorstellen, wie es in dem Dorf aussieht. Man merkt, dass Zola über einen längeren Zeitraum selbst unter Bergarbeitern gelebt hat. Die Charaktere im Dorf sind zwar schlicht, aber es gelingt Zola dennoch fast komplizierte Beziehungen zwischen ihnen entstehen zu lassen.
Interessant ist aber auch der Verlauf des Streikes. Er trifft die Gesellschaft hart, die Streikenden aber noch härter. Dennoch ist schnell absehbar, dass es von seiten der Minengesellschaft keine Einlenkung geben wird. Die vorherrschende Wirtschaftskrise wird durch den Streik noch verstärkt, im Umland gehen immer mehr Firmen pleite. Die Not der Arbeiter wird immer größer und daher muss es zwangsläufig zu einer Eskalation des Streikes kommen. Die Rhetorik wird immer aggressiver, Etienne immer radikaler und so kommt es automatisch zu gewalttätigen Ausschreitungen, obwohl der Streik mit heren Zielen begann.
Trotz der großen, politischen Ereignisse schildert der Roman dennoch private Dramen. So verliebt sich Etienne in Catherine, die jedoch aufgrund der Verhältnisse mit einem anderen Mann, den sie nicht liebt, zusammen ist. Anhand der Schilderung der beiden Charaktere zeigt Zola wie Beziehungen in entmenschlichten, durch Not geprägten Gemeinschaft der Bergleute entstehen.
„Germinal“ ist ein sehr realistisch wirkender Roman, der den großen politischen Konflikt seiner Zeit nachzeichnet und dabei trotzdem privat und bewegend bleibt. Insgesamt ist der Roman eine aufwühlende und ungemein spannende Lektüre.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
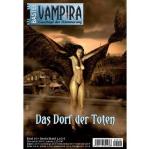 Lilith ist immer noch auf der Suche nach dem Lilienkelch. Diesmal führt die Reise sie von Sydney nach England. Doch zunächst muss sie einen verschollenen Ort auf alten Landkarten finden. Dabei bereiten ihr diesmal keine Vampire Probleme, die scheinen sie vergessen zu haben. Stattdessen sieht sie sich einem überraschendem Drang zum Selbstmord gegenübergestellt.
Zum ersten Mal hat Lilith keinen Feind. Denn "Das Dorf der Toten" ist ein reiner Rätsel-Roman, der noch durch eine Geschichte aus der Vergangenheit abgerundet wird. Das ist auch ohne direkte Bedrohung recht spannend und unterhaltsam. Insgesamt ist der Roman eine schöne Abwechslung zu den bisherigen.
Lilith ist immer noch auf der Suche nach dem Lilienkelch. Diesmal führt die Reise sie von Sydney nach England. Doch zunächst muss sie einen verschollenen Ort auf alten Landkarten finden. Dabei bereiten ihr diesmal keine Vampire Probleme, die scheinen sie vergessen zu haben. Stattdessen sieht sie sich einem überraschendem Drang zum Selbstmord gegenübergestellt.
Zum ersten Mal hat Lilith keinen Feind. Denn "Das Dorf der Toten" ist ein reiner Rätsel-Roman, der noch durch eine Geschichte aus der Vergangenheit abgerundet wird. Das ist auch ohne direkte Bedrohung recht spannend und unterhaltsam. Insgesamt ist der Roman eine schöne Abwechslung zu den bisherigen.Vampira Band 10 - Das Dorf der Toten (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
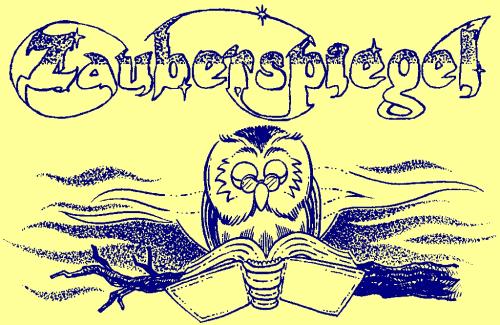
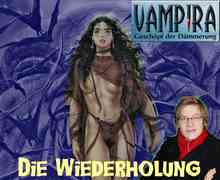 Das Heftromanserien lange überleben ist heute keineswegs gewiss. Dass die Neuauflage einer Serie lange überlegt, wirkt äußerst unwahrscheinlich. Dennoch wurde nach den ersten Verkaufszahlen verkündet, dass Vampira vorerst weiterlaufen wird. Das ist gut und überraschend. Denn für Vampira wurde kaum Werbung gemacht. Selbst auf der Verlagshomepage findet man kaum Informationen.
Das Heftromanserien lange überleben ist heute keineswegs gewiss. Dass die Neuauflage einer Serie lange überlegt, wirkt äußerst unwahrscheinlich. Dennoch wurde nach den ersten Verkaufszahlen verkündet, dass Vampira vorerst weiterlaufen wird. Das ist gut und überraschend. Denn für Vampira wurde kaum Werbung gemacht. Selbst auf der Verlagshomepage findet man kaum Informationen.Nun ist die Serie erst neun Bände alt. Dennoch sollte es nun darum gehen, den Charaktern mehr Glaubwürdigkeit zu verleihen, damit sich die Leser auch mit der Serie identifizieren können. Darum geht es in der mittlerweile schon über eine Woche alten Vampira-Kolumne:
Weiter geht's!
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
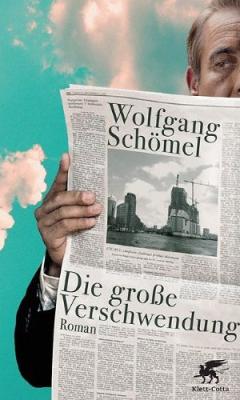 Dr. Georg Glabrecht ist ein “vergleichsweise kleines Arschloch”. Für die Grünen ist er Bausenator in Bremen und schwimmt ganz oben auf der Welle der “Leuchturmprojekte”. In diesem Sinn lässt er eine maritime Oper mithilfe eines zwielichtigen norwegischen Investors bauen und wird kurz danach selbst von den Verlockungen zwielichtiger Deals gelockt. Nebenbei ist sein Privatleben jedoch völlig im argen, die Beziehung mit seiner Frau liegt in Trümmern. Da kommt die junge und attraktive Mitarbeiterin seines Investors natürlich sehr gelegen.
Dr. Georg Glabrecht ist ein “vergleichsweise kleines Arschloch”. Für die Grünen ist er Bausenator in Bremen und schwimmt ganz oben auf der Welle der “Leuchturmprojekte”. In diesem Sinn lässt er eine maritime Oper mithilfe eines zwielichtigen norwegischen Investors bauen und wird kurz danach selbst von den Verlockungen zwielichtiger Deals gelockt. Nebenbei ist sein Privatleben jedoch völlig im argen, die Beziehung mit seiner Frau liegt in Trümmern. Da kommt die junge und attraktive Mitarbeiterin seines Investors natürlich sehr gelegen.“Die große Verschwörung” will eine Mischung aus politische Gesellschaftssatire und persönlichem Drama sein. Dem Roman gelingt allerdings keines von beidem.
Der Anfang ist ganz amüsant. Schömel beschreibt die politische Arbeit Glabrechts. Der hat eine unglaubliche Distanz zu seiner eigenen Tätigkeit und karrikiert sich eigentlich selbst. Er glaubt als Mitglied der Grünen an gar nichts von dem, was er macht, tut es aber, weil es halt alle machen. Es entsteht der Eindruck, dass alle Akteure auf einer Trendwelle surfen, von der sie bereits wissen, dass sie ins Verderben führt. Der Verlag hat passend dazu noch die Hamburger Elbphilharmonie auf das Cover gedruckt, was natürlich sofort für Parallelen sorgt.
Doch der Stoff für eine politische Satire ist sehr begrenzt. Schon nach kürzester Zeit wendet sich der Autor den privaten Beziehungen seiner Hauptfigur zu. So wird eine zerrüttete Ehe zwischen dem grünen Grabecht und einer TAZ-Journalistin geschildert und im Laufe des Romans natürlich die Affäre zu der jungen Mitarbeiterin aus Norwegen.
Das alles ist sehr Klischee beladen, wird oft extrem derb geschrieben und ist insgesamt weder witzig noch spannend. Stattdessen ist der Verlauf extrem vorhersehbar und Grabecht macht sich mehrmals zum Affen. Die einzige Aussage dieser langen Passagen ist eigentlich, dass Grabecht überhaupt keine Kontrolle mehr über sein Leben hat.
Zum Schluss versucht der Roman noch mal etwas politisch zu werden. Die rot-grüne Koalition in Bremen wird für ihre Fehler abgewählt. Doch das ist so knapp geschrieben, dass es den Roman auch nicht mehr rettet, zumal der Satire-Versuch hier endgültig aufgegeben wird.
Grabecht steht zum Schluss vor einem persönlichen und politischen Scherbenhaufen, den er aufgrund seiner Handlungen letztendlich aber auch verdient hat. Mitleid regt sich mit ihm kaum, zu distanziert war er zuvor, als dass man sich mit ihm identifizieren könnte. Zurück bleibt ein Roman, der ohne Botschaft daher kommt und weder eine gelungene Satire noch eine gelungen Charakterstudie ist.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren


"Das Ende einer Ära" ist der erste Teil eines Dreiteilers, der den Zyklus abschließen soll. Für einen ersten Teil geschieht hier eigentlich relativ viel, zumindest muss ein ganzes System von den Solaren Welten aufgegeben werden. Dennoch erfährt man - wie es sich wiederum für einen ersten Teil gehört - wenig Neues und es wird mehr geredet.
Leider werden mal wieder zwei neue Charaktere eingeführt, die sofort wieder "entsorgt" werden. Doch dem steht eine Sekte gegenüber, die mit einigen bereits bekannten Figuren überrascht.
Die komplette Rezension findet man wie immer auf SF-Radio:
Sternenfaust Band 172 - Das Ende einer Ära (von Thomas Höhl)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
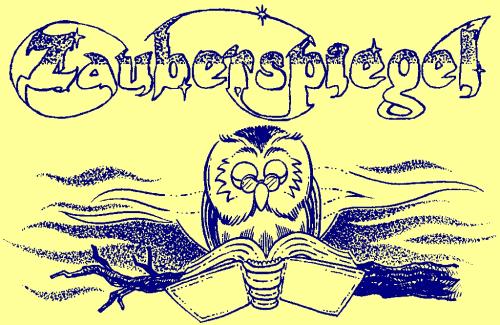
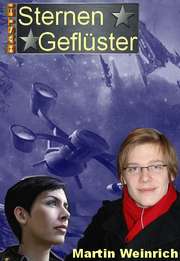 Charakterarbeit sieht bei "Sternenfaust" meist so aus, dass eine Person einen großen Auftritt in einem Roman erhält. Dadurch wird dem Charakter dann eine neue Hintergrundfacette hinzugefügt.
Charakterarbeit sieht bei "Sternenfaust" meist so aus, dass eine Person einen großen Auftritt in einem Roman erhält. Dadurch wird dem Charakter dann eine neue Hintergrundfacette hinzugefügt.Dadurch gerät jedoch die "alltägliche" Charakterbildung etwas in den Hintergrund. Denn ein Brückenoffizier wirkt auf den Leser nicht nur deswegen, weil er zum Beispiel eine tragische Kindheit hatte. In Erinnerung bleibt auch, wie sich die Person bei ihrer Arbeit verhält und wie sie zu anderen Personen in der Serie steht.
Daher ist die Frage, ob man nicht zum Ende des Zyklus, wo man sowieso nicht mehr viel Zeit für "Charakterhefte" hat, von dem Prinzip des Hintergrunds abrückt und versucht, mehr Beziehungsgeflechte zu kreieren.
Dies ist das Thema der mittlerweile schon mehr als eine Woche alten "Sternenfaust"-Kolumne:
Hintergrund oder Beziehungsgeflecht
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
In den vergangenen zwei Wochen scheint die SPD genau dies mal wieder zu versuchen. Diesmal benutzt man aber eine eher unangemessene Wortwahl. Die SPD hat ein neues Steuerkonzept vorgelegt, dass die Staatseinnahmen verbessern soll und somit mehr Ressourcen für die Bildung und die Entschuldung frei stellen soll. Eigentlich eine gute Idee. Nur wird das Projekt "national" und "sozial-patriotisch" beworben.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

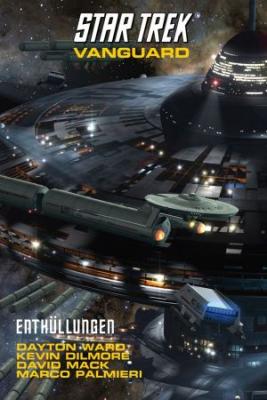
"Enthüllungen" ist eine Kurzgeschichtensammlung. Die Geschichten spielen zu verschiedenen Zeiten der "Star Trek"-Miniserie. Der deutsche Titel und noch etwas mehr der englische Titel ("declassified") versprechen neue Erkenntnisse zu den Ereignissen der Serie. Diese sucht man allerdings vergeblich.
Stattdessen werden einem drei mäßige, teils sehr vorhersehbare Geschichten und eine sehr gelungene, für die aber ein falscher Aufbau gewählt wurde, präsentiert. Letztendlich hätte man auf die Kurzgeschichten verzichten sollen und gleich die Geschichte um die Raumstation in der Taurus-Region weiterzählen sollen.
Die komplette Rezension ist bei Trekzone zu finden:
Star Trek Vanguard 6 - Enthüllungen (von Dayton Ward, Kevin Dillmore, Marco Palmieri und David Mack)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Bild: momsu / Pixelio
Die Gedankenecke geht in die zweite Sommerpause für dieses Jahr. Bis zum 10. September wird hier erst einmal nichts geschehen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Eine junge muslimische Frau wird ermordet. Sie hat sich wenige Tage zuvor ihr Jungfernhäutchen wieder herstellen lassen, um „rein“ in die für das Wochenende geplante Hochzeit zu gehen. Die Familie ist entsetzt, ihr Verlobter wusste von dem Eingriff natürlich nichts, hält ihn aber für unnötig. Den Ermittlern fehlt jede Spur. Kurz darauf wird eine weitere Muslimin getötet, diesmal wird sie kurz vorher sogar noch vergewaltigt. Das Opfer hat sich ihr Jungefernhäutchen bei dem selben Arzt wiederherstellen lassen wie das erste Opfer. Außerdem hat sie ihr Brautkleid in demselben Geschäft gekauft. Die Ermittler haben also schon zwei Spuren...
Eine junge muslimische Frau wird ermordet. Sie hat sich wenige Tage zuvor ihr Jungfernhäutchen wieder herstellen lassen, um „rein“ in die für das Wochenende geplante Hochzeit zu gehen. Die Familie ist entsetzt, ihr Verlobter wusste von dem Eingriff natürlich nichts, hält ihn aber für unnötig. Den Ermittlern fehlt jede Spur. Kurz darauf wird eine weitere Muslimin getötet, diesmal wird sie kurz vorher sogar noch vergewaltigt. Das Opfer hat sich ihr Jungefernhäutchen bei dem selben Arzt wiederherstellen lassen wie das erste Opfer. Außerdem hat sie ihr Brautkleid in demselben Geschäft gekauft. Die Ermittler haben also schon zwei Spuren...Dieser Radiotatort erzählt eigentlich eine spannende und gut konstruierte Geschichte, leidet jedoch an zwei starken Schwächen.
Die Geschichte ist gut inszeniert und wir differenziert dargestellt. Einer der Ermittler ist zwar in Deutschland geboren, fühlt sich auch in Deutschland, hat aber einen Migrationshintergrund. Er wird von seinen Kollegen sofort als „Experte“ für den Fall gehandelt, obwohl er von muslimischen Riten und Ehrenmorden überhaupt gar keine Ahnung hat. Die Ignoranz der angeblichen Leitkultur, die sofort alles verallgemeinert ist recht gelungen.
Außerdem baut dieser Radiotatort viel Spannung auf. Mal wieder ist kein Ermittler in direkter Gefahr. Da jedoch nie eine Beweisspur wirklich erfolgversprechend wirkt, rätselt man permanent mit.
Dem Tatort fehlen jedoch die zehn bis fünfzehn Minuten, die zum Beispiel der Berliner Tatort mehr hatte. Denn die Ermittler haben kaum eigene Auftritte. Ein Stotterer darf ein wenig über seine gescheiterten Beziehungen berichten und bei dem Hauptermittler wird HIV diagnostiziert. Eigentlich ist das schon viel Beziehungsgefüge für ein 45-minütiges Höhrspiel. Doch beide Handlungsstränge werden nicht zu einem vernünftigen Ende geführt. Stattdessen hängen zum Schluss beide ein wenig in der Luft, was ärgerlicher ist als wenn man gleich darauf verzichtet hätte.
Und zum Schluss ist die Auflösung einfach zu zufällig. In ihrer Hilflosigkeit wenden sich die Polizisten an einen ehemaligen Polizisten, der jetzt auf einer Hochzeitsmeile einen Laden betreibt. Von ihm, der ebenfalls einen Migrationshintergrund aufweist, erhoffen sich die Ermittler Insider-Informationen über die Szene. Das ist sehr stereotyp, schließlich wird hier genau so verallgemeinert wie bei dem vorhin angesprochenen Ermittler. Und dann ist dieser ehemalige Polizist überraschenderweise auch noch der Täter. Das ist etwas überkonstruiert und schadet dem Tatort.
„Ehrbare Töchter“ geht differenziert an ein heikles Thema heran, scheitert aber an der zu kurzem Zeit, die dem Hörspiel gewährt wurde und kann die aufgebaute Spannung zudem zum Schluss nicht vernünftig auflösen.
Das Hörspiel ist noch bis zum 11. September hier "downloadbar".
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
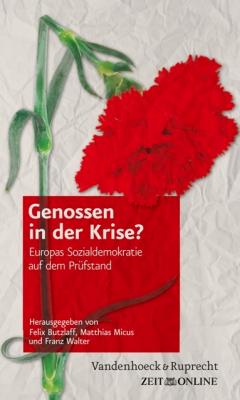 Das maßgeblich von Mitarbeitern des Göttinger Instituts für Politikforschung herausgegebene Werk "Genossen in der Krise" analysiert in 15 Beiträge die Lage sozialdemokratischer Parteien in eben so vielen Ländern. Das bietet einen sehr guten Einblick in die Mentalität der Parteien und einen guten Einblick in die Geschichte der Arbeiterbewegung in den einzelnen Ländern. Die Beiträge kranken nur ein wenig daran, dass sie teilweise schon wieder überholt sind und dass die Politik der Sozialdemokraten bei der Krisenanalyse fast komplett ignoriert wird.
Das maßgeblich von Mitarbeitern des Göttinger Instituts für Politikforschung herausgegebene Werk "Genossen in der Krise" analysiert in 15 Beiträge die Lage sozialdemokratischer Parteien in eben so vielen Ländern. Das bietet einen sehr guten Einblick in die Mentalität der Parteien und einen guten Einblick in die Geschichte der Arbeiterbewegung in den einzelnen Ländern. Die Beiträge kranken nur ein wenig daran, dass sie teilweise schon wieder überholt sind und dass die Politik der Sozialdemokraten bei der Krisenanalyse fast komplett ignoriert wird.Die einzelnen Beiträge konzentrieren sich dabei in erster Linie auf europäische Länder, das deutet der Untertitel "Europas Sozialdemokratie auf dem Prüfstand" schon an. Trotzdem werden außerhalb Europas die Situation der "Labour"-Parteien in Neuseeland und Australien betrachtet. Es ist jedoch nicht ganz klar, warum zum Beispiel die gerade abgewählten Sozialdemokraten in Portugal oder die Sozialdemokraten in Belgien und Griechenland keine eigenen Beiträge bekommen haben. Die Lösung ist vermutlich, dass man den Rahmen des Buches nicht sprengen wollte.
Für jeden Beitrag wird eigentlich angenommen, dass sich die Sozialdemokratie in dem Land in einer Krise befindet. Zwar dürfte das immer wieder genannte Phänomen "Mitgliederschwund" auch auf die meisten anderen Parteien zutreffen, aber bei allen Beiträgen wird auch deutlich, dass den Sozialdemokraten europaweit ein Ziel beziehungsweise eine Vision fehlt. Während das für konservative Parteien in der Regel kein Problem ist, weil ihre Wähler das nicht erwarten, ist das für Sozialdemokraten, die ihre Anhängerschaft in der Regel dadurch motivieren, ihnen eine Verbesserung der Zustände zu bieten, kritisch.
Die einzelnen Beiträge beschäftigen sich viel und ausführlich mit der Mentalität der jeweiligen Parteien. Bei den schweizer Sozialdemokraten, die von 40% der Großverdiener gewählt werden aber kaum von Arbeitern, sorgt das sogar für den Titel des Beitrags ("Cupli Genossen"). In der Regel wird die Mentalität auch über den Zeitraum der letzten 30, 40 Jahre betrachtet. Dabei kann man für fast jede sozialdemokratische Partei in Westeuropa feststellen, dass sie sich in der Zeit akademisiert hat und von ihrer früheren Zielgruppe entfernt hat. Teilweise empfinden einige Teile der Parteien ihrer früheren Herkunft gegenüber sogar so etwas wie Verachtung.
Natürlich konzentriert man sich nicht nur auf die Mentalität, sondern auch auf die erfolgreichen Zeiten der sozialdemokratischen Parteien. Auch dafür muss man (manchmal weit) in die Vergangenheit zurückblicken. Das ist meist der interessanteste Teil der Beiträge. Schließlich weiß man, welche Partei wann in Deutschland regiert hat. Man weiß das vielleicht auch noch für große Nachbarn, aber bei vielen kleineren Ländern wird die Regierungsgeschichte in Deutschland seltenst vermittelt. Dadurch werden die Beiträge neben den interessanten Krisenanalysen auch zu einer guten Geschichtsaufrischung.
Das Buch ist im Juli 2011 erschienen, ist also gerade einmal etwas mehr als einen Monat alt. Dennoch ist es an verschiedenen Stellen schon überholt. Es wirkt merkwürdig, dass die Stärke der spanischen Sozialdemokratie in ihren lokalen Hochburgen liegt. Die hat sie Ende Mai aber fast alle verloren. Auch der Beitrag zur SPD, der sich in erster Linie mit dem Parteireformprozess beschäftigt und ebenfalls Anfang des Jahres geschrieben wurde, ist schon etwas überholt. Das unterstreicht aber nur die ebenfalls aufgestellte These, dass bei der Sozialdemokratie nichts festgeschrieben ist und allen Prozessen viel Dynamik inne ist.
Was die Beiträge aber alle versäumen, ist eine Bewertung der sozialdemokratischen Politik. In der Regel wird die Krise der Parteien vorrausgesetzt, weil sie alle unter mäßigen bis schlechten Wahlergebnissen, Mitgliederschwund und Ideenlosigkeit aufgrund von Pragmatismus leiden. Dabei wird gut analysiert, warum die Mitglieder von der Parteiführung oft wenig begeistert sind und wie die Parteispitzen dem Pragmatismus fröhnen. Aber es wird nur selten darauf eingegangen, was die Regierungszeit bewirkt. Denn liegt die Krise "nur" daran, dass die Parteien sich von ihren Wurzeln entfernt haben oder auch daran, dass man miserable Regierungsarbeit geleistet hat, die das Land in eine Wirtschaftskrise gestürzt hat? Denn die derzeitige Finanzkrise hätte wohl auch nicht von weniger neoliberalen Sozialdemokraten verhindert werden können, die jetzt aber deswegen in Spanien, Griechenland und Portugal unter Beschuss stehen.
Den Beiträgen wird zum Schluss durch ein Fazit, das den Titel "Spätsommer der Sozialdemokratie" trägt, ein Rahmen gegeben. Es fasst die Probleme der sozialdemokratischen Parteien europaweit zusammen. Der interessanteste Teil findet sich gleich zu Beginn des Textes. Darin wird nämlich erklärt, dass die Sozialdemokraten ihre ursprüngliche Zielgruppe durch ihre Regierungen in den 70er-Jahren gespalten haben. Aus den ehemals "sozial blockierten" wurden Insider und Outsider. Den Insidern ging es durch sozialdemokratsiche Reformen rasch besser und sie konnten aufsteigen (was teilweise wiederum mit einer Entfernung von der Sozialdemokratie einherging), während die Outsider weiterhin keinen Zugang zu Aufstiegsmöglichkeiten hatten, resignierten und sich nicht mehr an der Politik beteiligen. So hat das Ziel von Sozialdemokraten, nämlich mehr Aufstiegsmöglichkeiten zu schaffen, dazu geführt, dass diejenigen die es geschafft haben, sich abwenden und die, bei denen sozialdemokratische Politik versagt hat, resignieren. Das ist eine interessante Beobachtung.
Im Folgenden geht das Fazit, dann auf die sich schon in den vorherigen Beiträgen abzeichnenden Probleme ein. Die geistige Entfernung von den Arbeitern, die Vergreisung und Akademisierung der Mitglieder und fehlender Nachwuchs werden betrachtet. Es folgt ein Abriss möglicher Reformbemühungen, von denen allein keine zu einer Besserung beiträgt. Zurück bleibt ein sehr unklares Bild über die Zukunft. Es werden zwar Ansätze angerisse, zum Beispiel wird darüber nachgedacht, sich eventuelle vom Volksparteienmodell zu verabschieden, um sichbesser auf bestimmte Zielgruppen zu konzentrieren, wirklich bahnbrechende Lösungen finden sich aber nicht. Das Fazit ist letztendlich, dass ein Wiederaufstieg sozialdemokratischer Parteien wohl am Besten durch einen Mix von guter Arbeit auf kommunaler Ebene, wo man noch etwas Macht in den Händen hält, und einer guten Einbindung und Beteiligung der Mitglieder möglich ist. Dabei hängt jeder Reformversuch jedoch von den Akteuren ab, die ihn zulassen. Denn zum Beispiel machen Vorwahlen, bei denen die Parteispitze die Kandidaten schon im Vorraus ausgeküngelt hat, nur wenig Sinn. Und natürlich braucht die Sozialdemokratie wieder so etwas wie eine "Erzählung", eine Art "dritter Weg", der diesmal inhaltlich nicht nur eine Anbiederung an "die Mitte" ist, sondern auch das eigene Kernklientel mitnimmt.
"Genossen in der Krise" ist eine Sammlung von 15 sehr interessanten Beiträgen, die einem einen Einblick in die Mentalität und die Probleme der europäischen sozialdemokratischen Parteien geben. Konkrete Lösungsvorschläge bietet das Buch wenige und es ignoriert auch ein wenig die Taten der Parteien in der Regierung. Dennoch sensibilisiert es dadurch, dass es die parteiinternen und Zielgruppenfehler analysiert, für mögliche Gründe des Niedergangs. Außerdem beschreiben alle Beiträge natürlich auch die Problemlösungsversuche der 15 Parteien. Darunter lassen sich auch einige durchaus interessante Methoden feststellen. Dies und die Einblicke in die jüngere Geschichte der Sozialdemokratie in Europa machen das Buch zu einer interessanten Lektüre.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
