
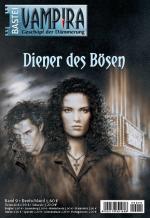 Nach der gescheiterten Mission in Indien kehrt Lilith nach Sydney zurück. Dort hat sich die örtliche Vampir-Sippe zwar zurückgezogen, aber die Diener-Kreatur Leroy Harps zieht noch munter durch London und mordet Frauen. Es dauert allerdings eine ganze Weile, bis Lilith ihm auf die Spur kommt. In der Zwischenzeit werden eine Reihe von Aknüpfungspunkten für zukünftige Geschichten gelegt.
Nach der gescheiterten Mission in Indien kehrt Lilith nach Sydney zurück. Dort hat sich die örtliche Vampir-Sippe zwar zurückgezogen, aber die Diener-Kreatur Leroy Harps zieht noch munter durch London und mordet Frauen. Es dauert allerdings eine ganze Weile, bis Lilith ihm auf die Spur kommt. In der Zwischenzeit werden eine Reihe von Aknüpfungspunkten für zukünftige Geschichten gelegt.Das liest sich zwar gut, ist aber nicht besonders spannend. Denn wenn Lilith bisher von der Vampir-Sippe nicht besiegt werden konnte, dann wird eine einfach Diener-Kreatur das auch nicht schaffen.
Die ganze Rezension findet man wie immer bei SF-Radio:
Vampira Band 9 - Diener des Bösen (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

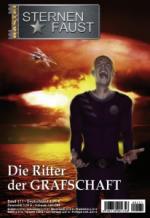 Jemand greift die Ritter der Grafschaft an. Das sorgt für einen spannenden und temporeichen Roman, denn auch der Leser weiß wenig bis gar nichts über die mysteriöse Vereinigung. Dadurch unterhält der Roman gut, enttäuscht jedoch an den Stellen, an denen antworten oder eine Verschwörung erhofft waren.
Jemand greift die Ritter der Grafschaft an. Das sorgt für einen spannenden und temporeichen Roman, denn auch der Leser weiß wenig bis gar nichts über die mysteriöse Vereinigung. Dadurch unterhält der Roman gut, enttäuscht jedoch an den Stellen, an denen antworten oder eine Verschwörung erhofft waren.Dafür liest sich der Roman gut und bietet gute Anknüpfungspunkte für weitere geschichten. Die komplette Rezension findet man wie immer auf SF-Radio:
Sternenfaust Band 171 - Die Ritter der Grafschaft (von Andreas Suchanek)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Man sah eine "Götterdämmerung" in Tripolis nahen. Da fragt man sich doch, welchem Gott dämmerts jetzt? Diese Wortwahl ist aber immer noch besser als ein Video auf der Homepage, das mit "Endspiel für den Dauer-Despoten" betitelt ist. Zusammen mit der noch perverseren Überschrift "Tyrannosaurus Ex" wird sehr deutlich, was für ein Bild vom Bürgerkrieg in Lybien die "Spiegel Online"-Redakteure pflegen. Der Krieg ist für sie anscheinend mehr wie ein "Comupter"-Spiel, er gleicht einem "Ego Shooter", in dem man erst ein paar Städte erobern muss, um dann ins Endspiel zu gelangen.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Sicherlich, DIE LINKE ist mit Kuba eng verbunden. Es gibt die "AG Cuba Si beim Parteivorstand der Partei DIE LINKE". Wirklich überraschend kommt diese Einstellung also nicht. Und natürlich darf ein parlamentarischer Fraktionsgeschäftsführer der CSU gerne darauf hinweisen.
Aber warum sollte nun gerade deswegen DIE LINKE vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Das Argument: Es gibt undemokratische Tendenzen in der Partei. Als Beweis gilt der genannte Brief. Das ist etwas kurz gegriffen, denn selbst die Bundesrepublik hoffiert bekanntlich Diktatoren.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
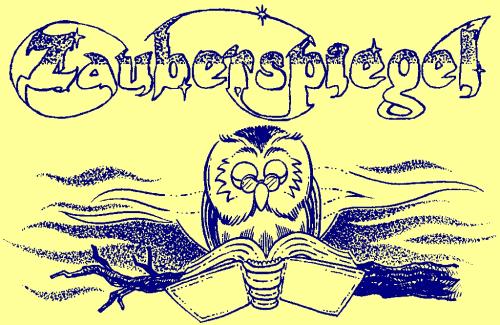
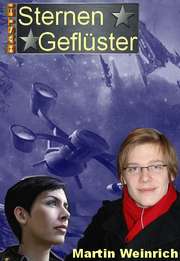 Nachdem in letzter Zeit die Serienhandlun, die eine Reihe von Geheimnissen der Serie aufgeklärt hat, für Kolumnenstoff sorgte, ist es diesmal eine Diskussion aus dem "Bastei"-Forum.
Nachdem in letzter Zeit die Serienhandlun, die eine Reihe von Geheimnissen der Serie aufgeklärt hat, für Kolumnenstoff sorgte, ist es diesmal eine Diskussion aus dem "Bastei"-Forum.Denn dort wurde bei der Titelvorschau nachgefragt, warum einige Autoren in nächster Zeit nicht mehr für die Serie schreiben. Der Exposé-Autor hat sich richtigerweise dafür entschlossen, dass nicht zu enthüllen.
Die Kolumne dreht sich daher darum, was das dennoch für Auswirkungen für den regelmäßigen Leser (bzw. Fan) hat.
Juchu und Mist - Auch Heftromanautoren sind keine Maschinen
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
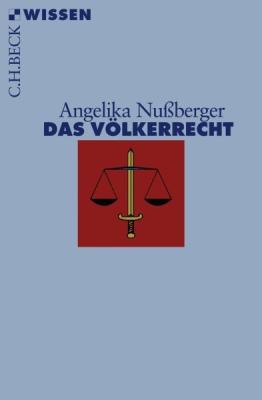 Das Völkerrecht dürfte aus deutscher Sicht relativ ungewohnt sein. Hier sind wir daran gewöhnt, dass das, wonach geurteilt wird, auch irgendwo steht. Das Recht also irgendwo unter einem Titel verschriftlicht ist. Das ist im Völkerrecht nur bedingt der Fall.
Das Völkerrecht dürfte aus deutscher Sicht relativ ungewohnt sein. Hier sind wir daran gewöhnt, dass das, wonach geurteilt wird, auch irgendwo steht. Das Recht also irgendwo unter einem Titel verschriftlicht ist. Das ist im Völkerrecht nur bedingt der Fall.Der kleine Büchlein von Angelika Nußberger klärt daher erst einmal auf, welche Quellen im Völkerrecht zählen, wie sie entstanden sind und auf welche Akteure sie anspielen. Das geschieht in einfacher und verständlicher Sprache. Auch lateinische Grundsätze des Rechts werden angenehm erklärt.
Danach werden fünf Themenfelder angerissen. Die Frage, wann ein Krieg völkerrechtlich in Ordnung ist, steht dabei verständlicherweise an erster Stelle. Es folgt die Frage, wie Völkerrecht eigentlich durchgesetzt werden kann, wie sich der Menschenrechtsschutz entwickelt hat, wie die Verantwortung einzelner vor dem Völkerrecht aussieht und zuletzt in welchem Umfang der Schutz der Umwelt völkerrechtlich abgesichert ist.
Dabei führt die Autorin immer wieder Beispiele an. Gerade das Kapitel über die Gerichte wie den Internationalen Gerichtshof enden mit einer Reihe von Beispielsfällen, sodass man sich gut vorstellen kann, was die Gerichte eigentlich machen.
Die Autorin weist immer auch auf die Schattenseiten einer Institution hin. So haben zum Beispiel die USA bis heute nicht den internationalen Strafgerichtshof anerkannt, wodurch das Verklagen amerikanischer Staatsbürger nicht möglich ist. Gleichzeitig entzieht die Weigerung einer der mächtigsten Nationen der Welt, den Hof anzuerkennen, demselben natürlich viel Autorität.
Das eher schwache, weil zu ausgewogene Schlusskapitel über die Zukunft des Völkerrechts, lädt dann noch einmal kurz zum Schmuzeln ein. Denn "wären im Jahr 2004 die Europäer zur Wahl zwischen den Kandidaten George Bush und Al Gore aufgerufen gewesen, so wäre wohl Al Gore als Präsident ins Weiße Haus eingezogen." Das mag zwar stimmen, aber auch die Amerikaner hatten diese Wahl 2004 nicht. Dieser kleine Sonderbarkeit täuscht aber nicht darüber hinweg, dass gerade die ersten drei Kapitel (Quellen, Akteure, Krieg und Frieden) sehr lehrreich und dennoch leicht zu verstehen sind.
Das Buch gibt es gerade zum halben Preis bei der bpb.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Dr. Franklin hat eine Haube zugeschickt bekommen, trägt sie und wird kurz danach von einem Mob mit Steinen beworfen. Der Grund ist simpel: Die Haube beinhaltet Metallstreifen, die Franklin vor gedankenlesenden Mutanten beschützen. Die sind aber dafür ausgewählt worden, die Gesellschaft vor "Illoyalen" zu schützen. Wenn sie keine Gedanken lesen können, können sie dies nicht mehr tun. Da sie nicht wissen, wer die Hauben verschickt, sind sie gerade verdammt nervös und nehmen jeden Empfänger von Hauben fest...
Dr. Franklin hat eine Haube zugeschickt bekommen, trägt sie und wird kurz danach von einem Mob mit Steinen beworfen. Der Grund ist simpel: Die Haube beinhaltet Metallstreifen, die Franklin vor gedankenlesenden Mutanten beschützen. Die sind aber dafür ausgewählt worden, die Gesellschaft vor "Illoyalen" zu schützen. Wenn sie keine Gedanken lesen können, können sie dies nicht mehr tun. Da sie nicht wissen, wer die Hauben verschickt, sind sie gerade verdammt nervös und nehmen jeden Empfänger von Hauben fest...Zunächst hat man keine Ahnung, worum es in der Kurzgeschichte eigentlich geht. Wegen einer Hutbedeckung wird man von einem Mob verfolgt? In einem für Dick typischen Gespräch zwischen drei "Offiziellen" werden dann aber die meisten Fragen geklärt. Offensichtlich dreht sich die Geschichte um eine totalitäre Gesellschaft, die Abweichler nicht toleriert.
Auf nur wenigen Seiten erzählt Dick dann eine Actiongeschichte. Franklin soll verhaftet werden, wir aber zuvor vom Hutmacher entführt. Der enthüllt Frankling, dass die Telepathen planen, die Menschheit zu kontrollieren. Das soll ihnen über ein Gesetz gelingen, das ein Freund von Franklin gerade vorbereitet. Gemeinsam macht man sich auf den Weg zu dem Senator, nur um herauszufinden, dass er ebenfalls ein Telepat ist.
Obwohl schon alles verloren scheint, gewinnen "die Guten" zum Schluss doch. Denn die Telepathen sind mit einem Psycho-Trick zu besiegen. Die Unverwundbarkeit und Überlegenheit wandelt sich in wenigen Momenten in ihre größte Schwäche. Denn die Telepathen halten untereinander ständig Kontakt und bringen sich auf einmal alle selbst um. Dadurch skizziert die Kurzgeschichte nicht nur eine nüchterne, totalitäre Gesellschaft, sondern verdeutlicht auch wie schnell der Überlegene wieder der Unterlegene werden kann.
“Der Haubenmachert”,21 Seiten, 1955, von Philip K. Dick, aus der Anthologie “Variante zwei”.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
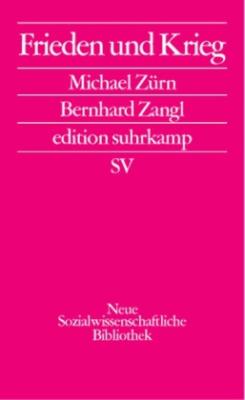 Die Autoren vertreten die These, dass sich die internationale Politik und vor allem die internationale Sicherheitspolitik in einem Wandel von der nationalen zur post-nationalen Konstellation befindet. Die bisherigen, großen Theorien der internationalen Beziehungen gehen jedoch hauptsächlich von der nationalen Konstellation aus und bauen auch darauf auf. Daher sei es notwendig, sich Gedanken über die Fortschreibung dieser Theorien beziehungsweise die Erstellung einer neuen zu machen.
Die Autoren vertreten die These, dass sich die internationale Politik und vor allem die internationale Sicherheitspolitik in einem Wandel von der nationalen zur post-nationalen Konstellation befindet. Die bisherigen, großen Theorien der internationalen Beziehungen gehen jedoch hauptsächlich von der nationalen Konstellation aus und bauen auch darauf auf. Daher sei es notwendig, sich Gedanken über die Fortschreibung dieser Theorien beziehungsweise die Erstellung einer neuen zu machen.Die beiden Autoren gliedern das Buch in zwei Teile.
Im ersten werden lehrbuchartig die Theorien der internationalen Beziehungen des Realismus, Idealismus, Neorealismus, Liberalismus und Marxismus, Neoinstitutionalismus und Sozialkonstruktivismus erklärt.
Nach einer Einführung und der Erklärung des Realismus und Idealismus, ist jedes Kapitel gleich aufgebaut. Zunächst beschreiben die Autoren wie die Theorie den Ost-West-Konflikt erklärt, dann erklären sie die Haupthypothesen der Theorien und beschreiben dann die geschichtliche Epoche beziehungsweise die Entwicklungen, die von dieser Theorie am Besten erklärt werden.
Diese einheitliche Aufbau und vor allem das (fast schon praktische) Erklären jeder Theorie anhand eines Epochenbeispiels erleichtert den Zugang zu den Theorien. Der erste Teil eignet sich daher auch recht gut zur Einführung in die beziehungsweise zum Auffrischen der Theorien.
Der zweite Teil führt dann die Theorie des Wandels von der nationalen zur postnationalen Konstellationen. Dabei beschreiben die Autoren wie sich vier Grundlagen des Nationalstaates wandeln. Aus nationalen Problemlagen werden zunehmen transnationale Prolbemlagen, aus nationalem Regieren wird zunehmend internationales Regieren und aus nationalen Legitimationsprozessen werden sowohl internationale, transnationale als auch nationale Legitimationsprozesse. Lediglich die Ressourcen würden weiterhin beim Nationalstaat verbleiben.
Für jede dieser Entwicklung gibt es ein Kapitel, in dem die Autoren zunächst ihre Hypothesen für den Wandel vorstellen und sie dann an praktischen Beispielen belegen. Zum Schluss kommen sie dann zu einer Liste von Prämissen und Hypothesen, die bei einer "neuen" Theorie postnationaler Politik aus ihrer Sicht beachtet werden sollten.
Auch im zweiten Teil ist es von Vorteil, dass sie ihre Auslegungen immer mit teils sehr ausführlichen Beispielen belegen. Andererseits wird der Teil dadurch ein wenig zum Überblickswerk über jüngere Konfliktgeschichte. Die aufgestellten Hypothesen sind zwar verständlich, aber in einigen Punkten knapp, nur an Einzelbeispielen und wenig generalisiert erläutert.
Insgesamt ist das Buch jedoch ein angenehmes Überblickwerk über die wichtigsten Theorien der internationalen Beziehungen, den Entwicklungen der Sicherheitspolitik seit den 90er Jahren sowie ihrer Probleme in einer immer globalisierteren Welt mit immer neuen Sicherheitsherausforderungen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
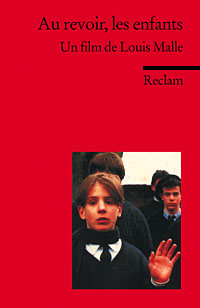 Au revoir les Enfants“ ist etwas komplizierter als die bisherigen französischen Texte, die ich hier vorgestellt habe. Das liegt jedoch in erster Linie daran, dass es sich hierbei um einen Filmtext handelt.
Au revoir les Enfants“ ist etwas komplizierter als die bisherigen französischen Texte, die ich hier vorgestellt habe. Das liegt jedoch in erster Linie daran, dass es sich hierbei um einen Filmtext handelt.Drei jüdische Kinder werden 1944 in ein christliches Internat gebracht, um sie dort zu beschützen. Zwischen dem Juden Bonnett und dem Franzosen Julien entwickelt sich nach anfänglichen Schwierigkeiten eine Freundschaft. Doch die grobe Behandlung eines kriminellen Bediensteten durch die Priester des Internats führt letztendlich zu dem Verrat der Internatsgemeinschaft, zur Entdeckung der Widerstandszelle und zu der Deportation der Juden.
Die oberflächliche Handlung ist leicht verständlich. Der Text ist in die Filmszenen unterteilt, somit sind die Textabschnitte jeweils sehr kurz. Der Film kommt auch mit relativ wenig Dialog aus, sodass man sich jedoch viel hinzudenken muss. Vieles wird einem dann doch erst nach der Lektüre des Nachwortes klar. Das sind einmal Anspielungen auf französische Eigenheiten und Mentalitäten, wie zum Beispiel Andeutungen auf die Resistance oder auf das Verhältnis zwischen Juden und Franzosen.
Außerdem wird die Stimmung des Filmes nicht unbedingt durch den Text wiedergegeben. Das Nachwort spricht von einer beengenden Stimmung, die der Text so nicht erschafft. Natürlich ließt sich das Drehbuch etwas beklemmend, da der Titel schon auf eine Entdeckung hindeutet. Aber die Angst, die Bonnet regelmäßig empfindet, spürt man nicht. Sie wird zwar erwähnt, wirkt aber eher steril. Das dürfte im Film deutlich besser wirken.
Die Tragik ist, dass der Verrat vermeidbar gewesen wäre. Denn nicht nur der Bedienstete, auch die Schüler machen sich einiger Vergehen schuldig. Sie werden jedoch nur sehr unterschiedlich behandelt. Der Verrat wird also durch eine Ungerechtigkeit ausgelöst. Das macht es nicht besser und im Text wirkt der Verrat auch schlimm. Das Nachwort macht aber deutlich, dass der Film durchaus Verständnis für den Verrat aufbauen möchte, da der Bedienstete die ganze Zeit schon als minderwertig betrachtet wurde-
Die Lektüre liest sich über die meiste Zeit ganz nett, ist an einigen Stellen aber etwas langweilig. Wahrscheinlich wäre es besser, einfach den Film zu gucken, anstatt das Drehbuch zu lesen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
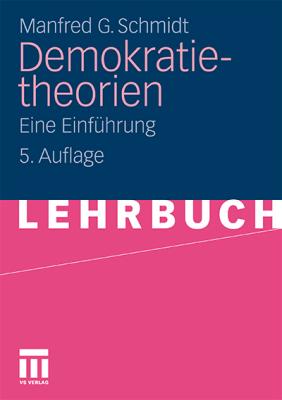 Demokratien unterscheiden sich in der Praxis. Die DDR trug das Wort im Titel und wird heute als undemokratisch angesehen. Aber auch in der Theorie gibt es unterschiedliche Auslegungen, unterschiedliche Modelle der Demokratie. Manfred G. Schmidt stellt in dem Buch "Demokratietheorien - Eine Einführung" eine beträchtliche Anzahl von Demokratietheorien und -modelle vor.
Demokratien unterscheiden sich in der Praxis. Die DDR trug das Wort im Titel und wird heute als undemokratisch angesehen. Aber auch in der Theorie gibt es unterschiedliche Auslegungen, unterschiedliche Modelle der Demokratie. Manfred G. Schmidt stellt in dem Buch "Demokratietheorien - Eine Einführung" eine beträchtliche Anzahl von Demokratietheorien und -modelle vor.Er teilt das Buch dabei in vier Teile.
Im ersten Teil werden die von ihm als "klassisch" bezeichneten Demokratietheorien von Aristoteles über Rousseau bis Marx vorgestellt. Es folgen die "mordenen" Demokratietheorien von der Führerdemokratie Max Webers über die "soziale Demokratie" bis hin zur komplexen Demokratietheorie. Aber auch in diesem Teil nimmt sich Schmidt meist ein bis drei Denker, die eine Demokratie erstellt haben und beschreibt und bewertet die Demokratietheorie.
Die ersten beiden Teile des Buches bestechen vor allem durch einen ähnlichen Aufbau. Jedes Kapitel beschreibt zunächst die Grundlage der Theorie, stürzt sich dann auf die Besonderheiten und wägt zum Schluss positive und negative Seiten ab. Dabei zieht Schmidt die verschiedensten Unterstützer, Kritiker und Denker eine Theorie heran, was zu einem immerhin 70-seitigen Literaturverzeichnis führt. Der klare, strukturierte Aufbau erleichtert allerdings mit der Zeit auch den Zugang zu den Theorien, da man die Fragestellungen, die an jede Theorie gelegt werden, schon kennt.
Der dritte Teil wendet sich dann der vergleichendne Demokratieforschung zu. Hier geht es um den Vergleich der parlamentarischen und präsidentiellen Demokratie, der Direktdemokratie oder den Theorien zu Übergängen vom autokratischen zum demokratischen Staat. Diese Kapitel sind immer noch ähnlich aufgebaut, in dem zum Schluss immer die Vor- und Nachteile eines Systemes, Modells oder einer Theorie abgewägt werden. Der letzte Teil befasst sich dann mit den Stärken und Schwächen der Demokratien und macht vor allem deutlich, dass die Demokratie nicht alle Probleme lösen kann und auch nicht nur Vorteile bietet.
Das Buch besticht vor allem dadurch, dass es viele Theorien vorstellt, klar aufgebaut ist und viele Meinunen hinzuzieht. Der Umfang des Buches ist mit 575 recht groß, was Platz für viel Material bietet, sodass es auch zu nicht "populär" bekannten Theorien kommt. Es ist klar aufgebaut, sodass man jedes Kapitel für sich verstehen kann. Vorkenntnisse über die Theorien werden in den ersten beiden Teilen kaum gebraucht. Auch in den vergleichenden und bewertenden Teilen wird vieles, wie zum Beispiel die Typen des parlamentarischen Systems erklärt. Allerdings braucht es hier teilweise Vorwissen zum Beispiel über die EU oder darüber, wie in England gewählt wird. Vor allem zieht Schmidt aber zu jeder Theorien sowohl lobende als auch ablehnende Stimmen hinzu, wodurch man zumindest das Gefühl hat, dass zu jedem Ansatz ein ausgewogenes Bild präsentiert wurde.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Als Sozialdemokrat könnte man sich in Schleswig-Holstein gerade sehr freuen. Der Spitzenkandidat Christian von Boetticher muss abtreten. Das wirft einen schwarzen Schatten auf die CDU und der Nachfolger ist noch sogar noch blasser als der blasse von Boetticher. Doch nach der fast schon demütigen Ansprache von Boettichers muss man eigentlich denken, dass der Skandal an ganz anderer Stelle liegt. Eigentlich handelt es sich nämlich um zwei Skandale: Der erste ist von Boettichers Bereitschaft alles der Macht zu opfern und das andere ist der Umgang der CDU mit ihrem Spitzenkandidaten.
Als Sozialdemokrat könnte man sich in Schleswig-Holstein gerade sehr freuen. Der Spitzenkandidat Christian von Boetticher muss abtreten. Das wirft einen schwarzen Schatten auf die CDU und der Nachfolger ist noch sogar noch blasser als der blasse von Boetticher. Doch nach der fast schon demütigen Ansprache von Boettichers muss man eigentlich denken, dass der Skandal an ganz anderer Stelle liegt. Eigentlich handelt es sich nämlich um zwei Skandale: Der erste ist von Boettichers Bereitschaft alles der Macht zu opfern und das andere ist der Umgang der CDU mit ihrem Spitzenkandidaten.Christian von Boetticher hatte ein Verhältnis (noch ist nicht bewiesen, dass es eine Affäre war) mit einer Minerjährigen. Gut, das ist rechtlich legal und wenn es sich tatsächlich um Liebe handelte moralisch eigentlich auch legitim. Von Boetticher und auch seine damalige Geliebte sprechen nun davon, dass es sich "einfach" nur um Liebe handelte. Aber wenn es sich wirklich um Liebe handelte, ist der eigentliche Skandal, dass von Boetticher das Verhältnis zugunsten der Macht geopfert hat, nennt das Verhältnis sogar einen "politischen Fehler". Möchte man wirklich Politiker haben, denen die Macht wichtiger ist als die Liebe ist? Eigentlich nicht, aber von Boetticher scheint genau so ein Typ gewesen zu sein.
Wirklich heftig ist aber der Umgang der CDU mit ihrem Spitzenkandidat. Möchte man wirklich glauben, dass man von Boetticher nur "geschasst" hat, weil er ein Verhältnis mit einer 16-jährigen gehabt hat? Andere Politiker haben da noch ganz andere Sachen überlebt. Zumal es doch darum gehen sollte, welche Politik von Boetticher macht. Da war er bisher blasse, wurde von der CDU aber immer in höchsten Tönen gelobt. Und auch heute überschlagen sich die Christdemokraten noch mit Lob für die politische Arbeit von Boettichers. Dennoch lässt man ihn "bloß" wegen der Affäre wie eine heiße Kartoffel fallen. Das ist verdammt schlechter Stil.
Es zeigt auch, dass die Nord-CDU bei weitem nicht so liberal ist, wie sie sich manchmal geben möchte. Hier regieren noch abstrakte "Werte", die gerne dazu genutzt werden, politische Konkurrenten auszustechen. Aufstieg scheint zudem hauptsächlich durch Patronage machbar. Denn während Ministerpräsident Carstensen Boetticher heftig unterstützte, scheint der Rest der Partei ihn eigentlich gar nicht gewollt zu haben.
Letztendlich ist es sehr bedauerlich, wie sehr das Privatleben eines Politikers jetzt in die Öffentlichkeit gezerrt wurde. Eigentlich hätte man von Boetticher wegen Ideenlosigkeit von dem Amt des Spitzenkandidaten der CDU entfernen sollen. Die CDU in Schleswig-Holstein hat jetzt gezeigt, dass ihr politische Positionen egal sind. Sie setzt eher auf eine "Amerikanisierung" der Politik, in dem sie das Private in den Mittelpunkt rückt und ihren (nun ehemaligen) Spitzenkandidaten zu einer demütigen Rücktrittsszene zwingt.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
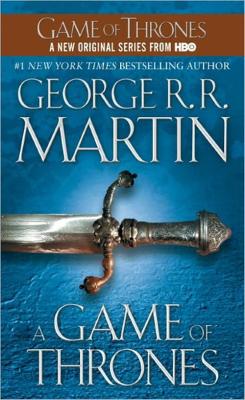 Eddard Stark ist der Lord des nördlichen Teil der sieben Königreiche. Sein Gebiet grenzt nördlich an einen kilometerlangen Wall, der das "zivilisierte" Königreich vor den Gefahren des Norden schützen soll.
Eddard Stark ist der Lord des nördlichen Teil der sieben Königreiche. Sein Gebiet grenzt nördlich an einen kilometerlangen Wall, der das "zivilisierte" Königreich vor den Gefahren des Norden schützen soll.Vor Jahren hat Stark mitgeholfen den grausamen König abzusetzen und einen anderen einzusetzen. Dieser König Robert reist nun zu seiner Burg nach Winterfell. Er möchte, dass Stark seine erste Hand wird und mit ihm in den Süden zieht. Eddard ist geneigt abzulehnen, denn er sieht seinen Platz im Norden. Doch die Witwe der vorherigen Hand sendet ihm eine Nachricht, aus der hervorgeht, dass Eddards Vorgänger ermordet wurde. Denn die Familie von Roberts Frau, die Lannisters, haben ihre eigenen Pläne mit dem Thron. Eddard zieht also in den Süden als erste Hand des Königs und begibt sich somit in einen Sumpf aus Intrigen und Verrat.
Derweil sind auf der anderen Seite der großen See die letzten Nachkommen des vorherigen Königs dabei, eine Rückeroberung der sieben Königreiche zu planen.
Und der Wall nach Norden ist mit viel zu wenig Männern besetzt, die zudem alle nicht auf der Höhe ihrer Kräfte sind.
"A Game Of Thrones" ist der erste Teil der Serie "Das Lied von Eis und Feuer". Auf Deutsch erschien der Roman in zwei Teilen mit den Titeln "Die Herren von Winterfell" und "Das Erbe von Winterfell".
Der Roman überrascht zunächst mit einem gleichsam realistischen und fantastischen Rahmen. Denn die Welt erinnert stark an des Mittelalter. Burgen, Ritterkodex und Waffen haben nichts fantastisches an sich. Die Ärzte sind zwar Magier, verwenden aber Kräuter und keine Zaubersprüche. Als das wirkt sehr realistisch. Auf der anderen Seite gibt es einen kilometerlangen Wall, der vor 8 000 Jahren gebaut wurde. Wie viele Fantasy-Welten scheint es also auch in dieser kaum Fortschritt zu geben. Außerdem wird immer wieder von magischen und gefährlichen Wesen hinter dem Wall geredet, von denen das Intro zu dem Buch einen kleinen Vorgeschmack gibt. Handfeste Beweise dafür erhält man jedoch nie. Daher ist das fantastische als Schatten immer vorhanden, wird aber in diesem Roman noch nicht greifbar.
Jedes Kapitel wird immer aus der Sicht eines Charakters geschrieben. Und davon gibt es viele. Das ist auch der einzig negative Punkt an diesem Buch, dass Martin es mit der Charakteranzahl beinahe ein wenig übertrieben hat. Denn während die Charaktere am Anfang noch alle in Winterfell sind und somit die selbe Geschichte erzählen, verstreuen sie sich im Laufe des Romans über das gesamte Königreich und erzählen eine Vielzahl von Handlungssträngen. Davon sind die meisten sehr gelungen, sodass man sehr unwillig ist, das Kapitel zu wechseln. Auf sonderbare Weise hemmt das teilweise den Lesefluss.
Außerdem merkt man dem Roman an, dass er der Auftakt zu einer Serie ist. Denn er kommt sehr langsam in Fahrt. Das ist nicht besonders schlimm, denn Martin kann dadurch zum Schluss Ereignisse vor einer sehr gut aufgebauten Kulisse erzählen. Doch im Mittelteil des Romans gibt es eine Entführungsgeschichte, in der ausnahmsweise mal die Guten einen Bösen entführen. Diese zieht sich etwas in die Länge und überzeugt nicht ganz.
Ansonsten ist der Roman aber hervorragend. Die Intrige ist klug aufgebaut, zumal es sich nicht nur um eine handelt. Denn es stellt sich heraus, dass viele Seiten ein Interesse am Thron haben. So gibt es am Ende des Romans drei Könige, eine Königin und einen rechtmäßigen Königskandidaten. Angereizt wird das "Spiel der Throne" noch durch ein paar Inzestgeschichten und dadurch, dass offensichtlich die Lannisters selbst nicht den ganzen Überblick haben.
Denn einige Kapitel werden auch aus der Perspektive des schwächsten Lannistermitglieds erzählt. Dadurch wird zum Ende deutlich, dass sie auch nicht mehr alle Machtverhältnisse überblicken können. "A Game Of Thrones" erzählt also, wie eine Intrige dazu führt, dass viel mehr davon geschmiedet werden und ein Königreich in viele kleine zerfällt. Ein Bürgerkrieg in den folgenden Bänden ist vorprogrammiert.
Neben den bisher klug gesponnenen Intrigen überzeugen aber auch die Charaktere und der Ton des Romanes. Die Charaktere erscheinen zunächst wie die typischen Typen aus Fantasy-Roman. Es gibt den edlen Lord, es gibt den verschlagenen, klugen Lord und es gibt den trunksüchtigen König. Doch im Gegensatz zu vielen anderen solcher Romane bemüht sich Martin darum, seinen Charakteren noch ein paar Schattierungen zu verleiehen. So sind die Lannister nicht komplett böse und die Starks treffen auch die eine oder andere ungerechte oder leichtfertige Entscheidung. Das macht den Roman spannender, weil die Charaktere nicht immer berechenbar agieren.
Die Stimmung ist recht düster. Obwohl es keinen großen, gefährlichen Gegner wie zum Beispiel im "Herrn der Ringe" gibt, ist die Stimmung permanent gedrückt. Das beginnt mit der winterlichen Stimmung im Norden und wird mit in den Süden getragen. Martin nimmt auch wenig Rücksicht auf seine Charaktere. So stirbt in diesem Roman zum Beispiel die vermeintliche Hauptperson Eddard Stark auf tragische Weise. Stark ist der typisierteste der Charaktere, weil er permanent an seiner Ehre festhält und sich immer nur korrekt verhält. Das einzige Fehlverhalten von ihm ist die Entsendung seines Bastards in den Norden. Aber auch das ist innerhalb seines Ehrenkodex fast eine Heldentat. Er wird des Verrats bezichtigt und gefangen genommen. Er ist aber natürlich im Recht. Ihm wird jedoch angedroht, dass nicht nur ihm, sondern auch seiner Tochter etwas angetan wird, wenn er seinen Verrat nicht zugibt. Gibt er ihn jedoch zu, würden sie beide verschont werden. Nach heftigem Ringen wendet er sich zum ersten Mal von seinem Konzept der Ehre ab und lügt. Daraufhin wird er dennoch hingerichtet. Das alles beschreibt Martin in einem knappen Kapitel, was die Stimmung natürlich noch einmal dunkeler werden lässt.
In diesem Jahr lief auch eine US-Fernsehserie mit demselben Titel. Daher gibt es zur Zeit die ersten vier Bände der Reihe auf Englisch in einem Schuber für gerade einmal 18€. Nach der Lektüre des ersten Romans scheint das ein gutes Angebot zu sein. Denn "A Game Of Thrones" ist zwar manchmal anstrengend zu lesen. Das liegt jedoch lediglich daran, dass Martin eine Vielzahl guter Charaktere verwendet und sich Mühe bei dem Aufbau "seiner" Welt, der sieben Königreiche, gibt. Gerade die Fülle an Charakteren nützt der zweiten Hälfte des Romans jedoch ungemein. Dabei wird auf 800 Seiten insgesamt eine sehr realistische, mittelalterliche und spannende Geschichte um Verrat, Intrige und Ehre erzählt, die zudem noch zwei zukünftig bedeutenden Nebenhandlungen (im Norden und auf der anderen Seite der See) verspricht.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 In Berlin reagiert eine schwarz-gelbe Chaoskoalition, die kaum etwas zustande bekommt. Und wenn sie mal etwas beschließt, dann ist es meist ungerecht. Daher passt der Ansatz des Buches „Gerecht denken – lokal handeln“ gut in die derzeitige politische Situation in Deutschland. Der Untertitel „Kommunalpolitik als Gegenmacht“ macht deutlich, auf welche Ebene man zur Zeit noch am stärksten hoffen kann. Außerdem wäre auch die Grundidee, die Kommunalpolitik zum Ansatzpunkt einer gerechten Politik zu machen, gut. Denn sie ist von den Themen tatsächlich oft näher am Bürger, als der Mehrheit in Deutschland bewusst ist.
In Berlin reagiert eine schwarz-gelbe Chaoskoalition, die kaum etwas zustande bekommt. Und wenn sie mal etwas beschließt, dann ist es meist ungerecht. Daher passt der Ansatz des Buches „Gerecht denken – lokal handeln“ gut in die derzeitige politische Situation in Deutschland. Der Untertitel „Kommunalpolitik als Gegenmacht“ macht deutlich, auf welche Ebene man zur Zeit noch am stärksten hoffen kann. Außerdem wäre auch die Grundidee, die Kommunalpolitik zum Ansatzpunkt einer gerechten Politik zu machen, gut. Denn sie ist von den Themen tatsächlich oft näher am Bürger, als der Mehrheit in Deutschland bewusst ist.Daher versammelt Thorsten Schäfer-Gümbel in dem Sammelband aus dem Vorwärts-Verlag 17 Beiträge, die sich mit den Handlungsfeldern und den Möglichkeiten der Kommunalpolitik auseinandersetzen. Darunter finden sich viele gute Beiträge. Das Problem ist allerdings, dass ein wenig der rote Faden fehlt und dass die Anwendungsmöglichkeiten begrenzt sind.
Denn die Beiträge variieren hinsichtlich des Ansatzpunktes. Es ist schön, dass Olaf Scholz schildert, wie die landespolitische Diskussion zur Bildungsreform in Hamburg ablief. Für die meisten Kommunen in Deutschland ist das aber völlig irrelevant, denn die Bildungspolitik macht nun einmal das Land.
Auf der anderen Seite gibt es aber eine Reihe interessanter Denkanstöße und sogar ein paar praxis-orientierte Beispiele.
So beschreibt Hermann Scheer zum Beispiel wie erneuerbare Energieförderung auch eine gute Wirtschaftsförderung sein kann, Dietlind Grabe-Bolz zeichnet ein sehr differenziertes Bild von Bürgerbeteiligung und Thorsten Schäfer-Gümbel regt mit einem Beitrag zum Nachdenken über die digitale Spaltung an und dass sie am besten auf lokale Ebene gelöst werden kann. Viele weitere Betirage erklären, warum Probleme am besten oder besonders gut auf der lokalen Ebene gelöst werden kann und regen an, über die Möglichkeiten der Kommunalpolitik nachzudenken.
Heinz Hilgers beschreibt in einem der wenigen sehr praxis-orientierten Beiträge wie das Dormhagener Modell zur Bekämpfung von Kinderarmut aufgebaut ist.
Diese interessante Vielfalt sorgt leider auch dafür, dass dem Buch ein wenig der rote Faden fehlt. Wie kann die „Gegenmacht“ denn nun erreicht werden, wie können die guten Anregungen und Denkanstöße in die Praxis umgesetzt werden? Letzteres kann man natürlich nicht generell festlegen. Aber dafür könnte man Praxis-Anregungen geben. Und letztendlich fehlt ein generelles Fazit, das die Handlungsfelder zusammenfasst und beschreibt, wo Kommunen schon aktiv werden können und wo noch Gesetze und Zuständigkeiten geändert werden müssen.
Außerdem stellt sich die Frage, wer alles umsetzen kann. Denn letztendlich wird Kommunalpolitik aus einem Zusammenspiel von ehrenamtlichen Politikern und der Verwaltung gemacht. Die Stadtfraktion, in der ich bisher mitgearbeitet habe, war sehr fähig. Dennoch denke ich, dass es für sie schwierig gewesen wäre, diese Denkanstöße in praktische Politik umzusetzen. Die vielen guten Ansätze in diesem Sammelband schreien also danach, dass Thorsten Schäfer-Gümbel demnächst noch ein anschließendes Praxisbuch nachlegt.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Der Bauunternehmer Siegmar Reimann plant in Berlin-Kreuzberg ein großes Wohnungsprojekt, das sein Unternehmen aus der Krise führen soll. Er will die ehemalige Hausbesetzerszene zerschlagen und das Viertel bereit für zahlungskräftigere Bürger machen. Doch ein Subunternehmer, über den er die Inhaber der Gebäude in der Tokioer Straße zum Verkauf überedet, versucht ihn zu erpressen. In der Nacht darauf geht Reimanns Mercedes in Flammen auf. Im Kofferraum findet man eine Leiche. Wer ist die Leiche? Wer hat den Wagen angezündet? Sind es die ehemaligen Hausbesetzer, ein Theaterschauspieler, Reimann selbst oder etwa jemand ganz anderes?
Der Bauunternehmer Siegmar Reimann plant in Berlin-Kreuzberg ein großes Wohnungsprojekt, das sein Unternehmen aus der Krise führen soll. Er will die ehemalige Hausbesetzerszene zerschlagen und das Viertel bereit für zahlungskräftigere Bürger machen. Doch ein Subunternehmer, über den er die Inhaber der Gebäude in der Tokioer Straße zum Verkauf überedet, versucht ihn zu erpressen. In der Nacht darauf geht Reimanns Mercedes in Flammen auf. Im Kofferraum findet man eine Leiche. Wer ist die Leiche? Wer hat den Wagen angezündet? Sind es die ehemaligen Hausbesetzer, ein Theaterschauspieler, Reimann selbst oder etwa jemand ganz anderes?Der Verdacht wird gleich zu Beginn auf Reimann gelenkt. Denn der Radiotatort beginnt mit dem Erpressungsversuch des Subunternehmers. Während die Polizei also noch rätselt, wer die Leiche sein könnte, hat der Hörer längst eine Ahnung. Das sorgt leider dafür, dass in der ersten Hälfte des Falls keine wirkliche Spannung aufkommen will.
Das ist aber zunächst gar nicht so schlimm. Denn der Tatort zeichnet ein intensives Bild des "Szene"-Bezirks Kreuzberg. Es werden Gegensätze, soziale Problemlagen und eben Szeneorte skizziert. Das gelingt in vielen, kurzen Szenen. Während sich die ehemaligen Hausbesetzer in einer permanenten Dagegen-Position festgefahren haben, ziehen um sie herum immer mehr Reiche ein und gentrifizieren den Bezirk. Der Tatort lässt dabei sowohl Nutznießer der Gentrifizierung, die sich noch mehr reiche Menschen für ihre Cafés wünschen und die Verlierer, die in ärmere Randbezirke Berlins ziehen müssen, dar. Dieses ausgewogen wirkende Bild von Berlin Kreuzberg trägt den ersten Teil.
Nach einem kurzen Hänger nach der Hälfte der Hörspielzeit, zieht die Handlung an. Die Hauptkommissarin bekommt immer mehr Hinweise, ihr Helfer wird sogar entführt. Letztendlich entpuppt sich jedoc der Anfangsverdacht als wahr und der Immobilienhai Reimann steckte hinter der Verbrenunng der Autos und somit auch dem Mord an der Leiche, die tatsächlich die des Subunternehmers ist. Dabei macht sich jedoch auch ein ehemaliger Hausbesetzer - wenn auch ohne all zu böse Absichten - mitschuldig. Es ist schade, dass sein Schicksal zum Ende des Krimis unerwähnt bleibt.
Neben dem Fall, der zwar vorhersehbar ist, aber ein interessantes Bild von Kreuzberg zeichnet, bestechen bei diesem Tatort wieder die Figuren. Scheinbar hat man ihnen in vorherigen Folgen schon einen gewissen Hintergrund mit ein paar Figuren aufgebaut. Das kommt dieser Folge zugute. Denn so dreht sich nicht alles nur um den Fall, sondern auch ein wenig um das Privatleben der Ermittler. Und das ist es ja schließlich, was eine Serie zu einer Serie macht.
"13" ist ein zwar vorhersehbar, aber doch sympathischer Krimi. Obwohl die Spannung zum Ende anzieht, bleibt nicht der Fall, sondern das dargestellte Kreuzberg-Bild in Erinnerung.
Das Hörspiel ist noch bis zum 15. August auf der Seite des Radiotatorts "downloadbar".
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
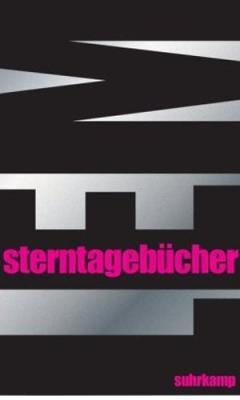 Das Buch beginnt mit einem sehr gelungen Vorwort, das der Lektüre einen leichten Start verpasst. Der fiktive Professor Taratonga lässt sich darüber über die bisherigen Forschungen zu dem Buchtext aus und wehrt sich unter anderem gegen die Vorwürfe einige „Spinner“, dass die Sterntagebücher und die Erinnerungen nicht von Ion Tichy sondern von einem „Lem“ geschrieben sei. Da aber niemand sagen könne, was „Lem“ sei, wäre das gar nicht möglich.
Das Buch beginnt mit einem sehr gelungen Vorwort, das der Lektüre einen leichten Start verpasst. Der fiktive Professor Taratonga lässt sich darüber über die bisherigen Forschungen zu dem Buchtext aus und wehrt sich unter anderem gegen die Vorwürfe einige „Spinner“, dass die Sterntagebücher und die Erinnerungen nicht von Ion Tichy sondern von einem „Lem“ geschrieben sei. Da aber niemand sagen könne, was „Lem“ sei, wäre das gar nicht möglich.
Der restliche Text teilt sich dann in zwei Teile. Es gibt die Sternentagebücher und die Erinnerungen des Ion Tichy. Die Kapitel der Sternentagebücher tragen jeweils die Nummer der jeweiligen Reise. Sie beginnen mit der achten Reise, danach wird jedoch nicht jede weitere Reise erzählt, sondern einige werden übersprungen. Die Erinnerungen tragen zunächst einfach römische Nummern (und fangen sogar bei eins an) und haben später Titel.
Die Sternentagebücher sind sehr gelungen. Bei jeder einzelnen Reise handelt es sich um eine Kurzgeschichte. Sie enthalten allerdings durchaus mal Rückblicke auf vorherige Abenteuer oder Erklärungen zum Gesamtaufbau (es wird zum Beispiel durchaus erklärt, warum die Sternentagebücher mit der Nummer acht anfangen). Dabei wird an vielen Stellen deutlich, dass Tichy sich vieles ausdenkt. Denn allein die Reisedauern sind so lange, dass auch ein Hinweis auf Zeitreisen und damit verbundene Verjüngung nicht genügen dürfte.
Die Kurzgeschichten zeichnen sich durch eine große Themenvielfalt aus. Es geht um Zeit und Zeitverlauf, Genetik, Wissenschaft, Gesellschaftssysteme und viele weitere Themen. Lediglich die Problematik von Kriegen wird kaum angesprochen, was den Roman in angenehmer Weise von anderen „Science-Fiction“-Romanen abhebt.
Die meisten Kurzgeschichten sind prägnant kurz, in einigen Sätzen schreiend witzig und dennoch nachdenklich. Allerdings gibt es auch eine Reihe von langen Kurzgeschichten, die recht philosophisch wirken an einigen Stellen aber schon fast ins Laborieren abdriften.
Die Geschichten sind in den Momenten besonders stark, wenn Alltägliches in eine abstruse, technisierte Weltraumzukunftswelt übertragen wird und dabei zusätzlich wichtige Themen behandelt. Dabei ist es beachtlich, dass vieles aus dem Alltag gegriffen wirkt, obwohl der Text aus den 60er Jahren steckt. So wirken zwar viele technische Dinge etwas albern, vor allem die vielen atombetriebenen Geräte, aber viele Verhaltensweisen und Rituale, die Tichy in seiner Rakete betreibt (Abwachen, Dachboden aufräumen) könnten auch in einem normalen Haus vorkommen.
Schwächer sind dann die Erinnerungen Ion Tichies. Hier spielt kaum eine Geschichte mehr im Weltraum und es scheint als entwickele Lem eine Art Professoren-Fetisch. Denn hier geht es um die Entwicklungen und Ideen einiger Professoren, die Tichy entweder aufsuchen oder die er trifft. Das ist zwar ganz nett, langweilt an einigen Stellen aber auch Denn nicht immer tragen die Erfindungen, die Ideen und die Skurilität der Professoren eine ganze Kurzgeschichte.
Gerade im Vergleich zu den Sterntagebücher wirken die Erinnerungen etwas schwach, sodass man sich durch die zweite Hälfte des Buches in Erinnerung an die gelungenen Reisen aus der ersten Hälfte eher quält. Zwar gibt es auch Higlights wie eine große Waschmaschineneproblemaitk, aber viele Professorengeschichten sind doch etwas abstrakt und oft ist die Erkenntnis, die beim Lesen gewonnen werden soll im Gegensatz zu den Sterntagebüchern viel zu stark betohnt. Doch dann wird man durch die letzte Geschichte entschädigt. In der trifft Tichy auf einen Planeten, der im Norden von einem riesigen Drachen bewohnt wird. Das gesamte Gesellschaftssystem des Planeten ist darauf aufgebaut, diesen Drachen am Leben zu erhalten. Tichy kann das nicht verstehen, schließlich könnten sich die Bewohner doch auch selbst helfen. Da muss man ungewollt daran denken, dass seit 2008 alle Anstrengungen unternommen werden, unser Finanzmarktsystem zu retten. Dabei könnte man doch auch den Bewohnern der Erde helfen.
Insgesamt bieten die „Sterntagebücher“ jedoch eine äußerst gelungene Mischung aus gelungenen Tehmen, Witz und Nachdenklichkeit. Den zweiten Teil, die Erinnerungen, kann man jedoch durchaus überspringen, wenn man nicht an fiktiven, technischen Neuerungen aus der 60er-Jahre Perspektive interessiert ist.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
