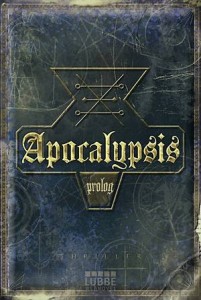 Das E-Book und andere digitale Verwertungsformen verunsichern die Verlage weltweit. Der Luebbe-Verlag in Deutschland versucht deswegen ein altes Konzept in das digitale Zeitalter zu retten. Der Bastei-Verlag, ein Bestandteil von Luebbe, wurde einst durch Heftromane erfolgreich. Dabei handelte es sich um Roman, die in Heftform herausgegeben wurden, zwischen 50 und 70 Seiten umfassten und Serien- beziehungsweise Zyklenartig aufgebaut waren. Heftromane gibt es immer noch, sie werden nur von kaum jemanden mehr gelesen. Waren sie einst die kurze Unterhaltung mit schlechtem Image für zwischendurch, mussten sie schnell diversen Fernsehserien weichen. Als Lesen dann immer uncooler wurde, verloren sie jugendliche Leser und fristen heute ein Schattendasein.
Das E-Book und andere digitale Verwertungsformen verunsichern die Verlage weltweit. Der Luebbe-Verlag in Deutschland versucht deswegen ein altes Konzept in das digitale Zeitalter zu retten. Der Bastei-Verlag, ein Bestandteil von Luebbe, wurde einst durch Heftromane erfolgreich. Dabei handelte es sich um Roman, die in Heftform herausgegeben wurden, zwischen 50 und 70 Seiten umfassten und Serien- beziehungsweise Zyklenartig aufgebaut waren. Heftromane gibt es immer noch, sie werden nur von kaum jemanden mehr gelesen. Waren sie einst die kurze Unterhaltung mit schlechtem Image für zwischendurch, mussten sie schnell diversen Fernsehserien weichen. Als Lesen dann immer uncooler wurde, verloren sie jugendliche Leser und fristen heute ein Schattendasein.
Das könnte sich nun ändern. Denn Luebbe bietet mit "Apocalypsis" seit einer Woche den ersten "Webnovel" an, der auffällig viele Ähnlichkeiten mit früheren Heftromanen hat.
Das Konzept
Der Autor Michael Giordano schreibt die Geschichte "Apocalypsis". Einmal in der Woche erscheint eine neue, etwa 40-seitige Episode. Die einzelnen Episoden werden als E-Book in diversen Formaten, als Hörbuch und für Smartphones auch als Mischung aus beidem angeboten. Zwölf Episoden bilden eine Staffel, die später auch gedruckt erscheint.
Eine ganz normale Text-Version im E-Book-Reader-Format epub kostet dabei 1,49€, Hörbücher können bis zu 1,99€ kosten. Den Prolog gibt es zum Reinschnuppern kostenlos.
Die Geschichte
Natürlich ist noch nicht ganz klar, worum es geht, lediglich der Rahmen ist nach dem Erscheinen des Prologs und der ersten Episode bekannt.
"Apocalypsis" erzählt von einer Verschwörung, die rund um den Vatikan und die katholische Kirche stattfindet. Der Papst ist zurückgetreten und der Journalist Peter Adams versucht herauszufinden, warum. Gleichzeitig geschehen merkwürdige Morde im Umfeld des Papstes und Peter Adams hat die Version, dass der Vatikan während der Papstwahl vernichtet wird.
Erzählstil
Der Erzählstil lehnt sich stark an Heftromane an. Die Story ist gradlinig und schnell erzählt. Gerade der Prolog weist ein irrwitziges Tempo auf und auf den 40 Seiten geschieht sehr viel. Die erste Episode nimmt zwar etwas Tempo aus der Geschichte, kann dem Leser aber dennoch ein ordentliches Erzähltempo bieten.
Im Gegensatz zu einem Heftroman, der oft eine abgeschlossene Geschichte erzählt, die dann mit anderen Romanen ein Gesamtbild ergibt, handelt es sich bei "Apocalypsis" jedoch wirklich um Episoden. Daher kann man nicht davon sprechen, dass Geschichten pro Ausgabe erzählt werden. Das liegt an dem geringen Seitenumfang.
Denn man kann nicht davon sprechen, dass die 4o-Seiten wirklich 40 gedruckten Seiten entsprechen. Während auf den ca. 60 Seiten eines Heftromans mit zwei Spalten pro Seite und relativ kleiner Schrift gearbeitet wird, hat man hier natürlich einen Fließtext und außerdem eher große Schrift. Dadurch ist man in kürzester Zeit mit dem Text durch und hat das Gefühl, eher einen Appetithappen vorgesetzt zu haben, als eine Geschichte.
Der Preis
Daher ist es auch fraglich, wie viele Leute wirklich auf Dauer bereit sind, den Preis von 1,49€ pro Episode zu bezahlen. Denn bei zwölf Episoden kommt man so auf 17,88€, wofür man auch schon so manches Hardcover-Buch bekommen kann. Zwar ist es über den geringen Seitenumfang möglich, mit relativ wenig Zeitaufwand am Ball zu bleiben. Andererseits wäre es unter diesen Umständen vielleicht sinnvoll gewesen, den Preis unter die psychologische 1€-Grenze zu drücken und den Preis der meisten Lieder zu fordern - nämlich 99 Cent.
Altbackene Story?
Nach der Ankündigung der Geschichte wurde schnell geunkt, dass man nur auf den "Dan Brown"-Zug aufspringen möchte und einen billigen Abklatsch produziert. Der Prolog und die erste Episode zeigen bis jetzt jedoch, dass das nicht wahr ist.
Natürlich ist der Kirchenthriller erst durch Dan Brown populär geworden. Aber Apocalypsis hat durchaus eigene Aspekte. Schon jetzt sind die Fronten sowohl klarer als auch vielschichtiger als zu Beginn mancher Brown-Romane. Denn es ist klar, dass die Geschichte sich um die Kirche handelt und viele Akteure sind schon bekannt. Andererseits ist nicht klar, wer hinter welchem Vorfall steckt. Hat der zurückgetretene Papst seinen Privatsekretär ermorden lassen? Oder war es sein Stellvertreter und ärgster Rivale? Oder war es eine dritte Kraft? Von dieser Art Fragen gibt es noch eine Reihe mehr. Selbst wenn es sich bei "Apocalypsis" also nur um einen Abklatsch handelt, wäre es also ein Guter.
Und zuletzt geht es in dieser Geschichte auch um deutlich mehr. Das Problem ist nicht, dass ein größenwahnsinniger Priester Papst werden möchte und es geht auch nicht um ein Artefakt. Stattdessen steht der Untergang der Welt auf dem Spiel. Diese Übetreibung ist durchaus typisch für heftromanähnliche Erzählformen und unterscheidet die Serie etwas von Brown.
Allerdings hat die Story einen ganz, ganz großen Störfaktor. Sie ist nämlich zeitlich determiniert. Zu Beginn vieler Kapitel steht das genaue Datum und das ist das Jahr 2011. Das wirkt einfach albern. Zwar hat man mehrfach das Gefühl, der zurückgetretene Papst (der ebenfalls aus Deutschland kommt) soll bewusst als Anti-Ratzinger dagestellt werden, um zu zeigen, was alles nach dem Tod von Johannes Paul dem II. hätte passieren können. Doch selbst wenn das die Absicht ist, ärgert das nichts an der Tatsache, dass die Jahresangabe extrem irritierend ist.
Fazit
Der Prolog und die erste Episode haben ihre Aufgabe eigentlich gut erfüllt. Es wird eine nicht unbedingt revolutionär neue und anspruchsvolle, aber dafür unterhaltsame und spannende Geschichte erzählt, von denen jeder Abschnitt mit einem gelungenen Cliffhangar endet. Allerdings muss man ehrlich sagen, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt. Für 1,49 bekommt man bei Itunes auch Serienfolgen, die selbst langsame Leser etwas länger unterhalten dürften. Es wäre schade, wenn der Testballon gerade an diesem überhöhten Preis scheitern würde. Ich werde noch ein- bis zwei weitere Episoden verfolgen. Aber für 17,88 für geschätzte 300 Seiten (in Druckform umgerechnet) erwarte ich doch mehr, als einfach nur ganz gut unterhalten zu werden.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

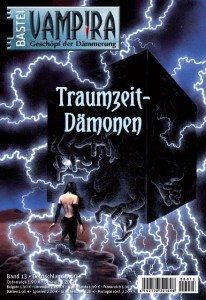 "Traumzeit-Dämonen" bereitet Lilith und den Leser auf den anstehenden Roman "Apokalypse" vor. Dabei werden drei kleine Geschichten erzählt, wodurch das Heft recht kurzweilig wirkt.
"Traumzeit-Dämonen" bereitet Lilith und den Leser auf den anstehenden Roman "Apokalypse" vor. Dabei werden drei kleine Geschichten erzählt, wodurch das Heft recht kurzweilig wirkt.Letztendlich passiert auf den 64 Seiten jedoch kaum etwas, außer mehrere Hinweise auf eine Bedrohung zu streuen und diese zum Schluss zusammenzuführen. Das ist ganz nett, aufgrund der abstrakten Gefahr fiebert man der "Apokalypse" jedoch weniger entgegen als wahrscheinlich gewünscht.
Vampira Band 13 - Traumzeit-Dämonen (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Derweil sind die anderen Kinder von der neuen App zunächst begeistert. Nach und nach wird jedoch jeder einmal ein Opfer der App, sodass sich Widerstand zu regen beginnt. Doch der Verursacher der "leaks" ist schwerer zu fangen, als zunächst angenommen. Es handelt sich nämlich um eine Ratte...
"Bass to Mouth" ist in erster Linie eine Anspielung auf Wikileaks. Die Ratte trägt diesen Namen und veröffentlicht permanent geheime Dinge, die eigentlich niemand wissen sollte. Damit sorgt sie für viel Belustigung, bei den Betroffenen jedoch für großen Schaden. Das scheint die Sichtweise der "South Park"-Macher auf das Phänomen des letzten Winters zu sein. Denn während alle ihren Spaß an den abgefangenen Diplomatennoten hatten, war das für die amerikanische Außenpolitik ein echtes Desaster, das in kritischen Fällen sogar reale Unglücke produzieren könnte.
Interessanter ist dabei eigentlich, dass die Episode auch das Thema "Privatssphäre" aufgreift. Es stört in der Schule niemanden, dass die Privatssphäre anderer Kinder verletzt wird, bis zu dem Moment wo die eigene Privatssphäre verletzt wird. Dann ist es aber immer schon zu spät, etwas zu tun. Daher ist die Folge auch ein Mahnung, vorsichtiger mit diesem Thema umzugehen.
Die Idee mit der Ratte ist jedoch schwach. Zwar wird sie in eine frühere Handlung eingebettet, insgesamt überzeugt dieses Konzept jedoch nicht. Dafür sind die Verfolgungen des Tiers zu ähnlich und das Konzept von auftauchenden Geistern ist bereits aus früheren Folgen bekannt.
Gelungener ist hingegen die Handlung um Cartman. Er verhandelt wie ein Gangsterboss. Das ist ganz putzig und unterhaltsam. Wirklich witzig ist auch dieser Handlungsstrang nicht.
Bis auf den Aspekt der Privatssphäre hätte man sich diese Folge auch sparen können. Sie kommt nicht an den gelungenen Vorgänger um aus Amerika auswandernde Mexikaner heran.
Die komplette Episode kann man sich wie immer bei South Park auf der Homepage der Serie angucken.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
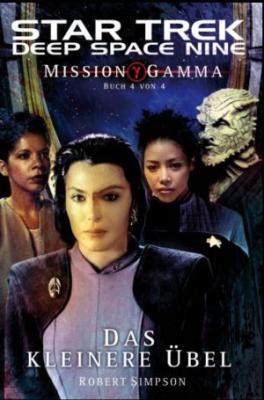 Mit "Das kleinere Übel" geht der "Mission Gamma"-Minizyklus zu Ende. Der Roman kann auf drei gelungene Vorgänger zurückblicken und schließt die Reise der "Defiant" in den Gamma-Quadranten mit der bisher besten und kürzesten Geschichte ab. Dennoch bleibt die sich mittlerweile über drei Bände aufbauende Handlung im Alpha-Quadranten deutlich spannender.
Mit "Das kleinere Übel" geht der "Mission Gamma"-Minizyklus zu Ende. Der Roman kann auf drei gelungene Vorgänger zurückblicken und schließt die Reise der "Defiant" in den Gamma-Quadranten mit der bisher besten und kürzesten Geschichte ab. Dennoch bleibt die sich mittlerweile über drei Bände aufbauende Handlung im Alpha-Quadranten deutlich spannender.In "Das kleinere Übel" laufen viele Fäden zusammen, die Story ist dicht erzählt und dennoch bleibt Platz für Auftritte der meisten Charaktere. Das ist kurzweilig und gut.
Star Trek - Deep Space Nine: Mission Gamma 4 - Das kleinere Übel (von Robert Simpson)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

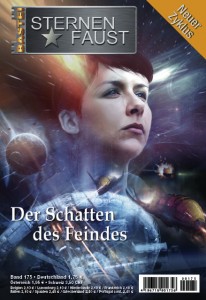 "Der Schatten des Feindes" startet einen neuen "Sternenfaust"-Zyklus. Nach dem aufwühlenden Finale befindet sich die Hauptakteurin Dana Frost nun wieder 16 Jahre in der Serienvergangenheit. Drei Jahre zuvor ist der Sternenfaust-II-Zwischenfall viel glimpflicher abgelaufen. Kein "Sternenfaust"-Mitglied kam dabei zu Schaden. Seitdem hatten die Solaren Welten drei Jahre Ruhe, was sich mit diesem Roman freilich ändert.
"Der Schatten des Feindes" startet einen neuen "Sternenfaust"-Zyklus. Nach dem aufwühlenden Finale befindet sich die Hauptakteurin Dana Frost nun wieder 16 Jahre in der Serienvergangenheit. Drei Jahre zuvor ist der Sternenfaust-II-Zwischenfall viel glimpflicher abgelaufen. Kein "Sternenfaust"-Mitglied kam dabei zu Schaden. Seitdem hatten die Solaren Welten drei Jahre Ruhe, was sich mit diesem Roman freilich ändert.Der Roman ist sehr gelungen, da er das damalige Serien-Feeling schnell wieder aufkommen lässt. Das ist gut. Vor allem die Brückenbesatzung der Sternenfaust-II wirkt sehr lebendig. Hinzu kommt noch, dass man scheinbar gewillt ist an alte Wirtschaftsthrillerhandlungen anzuknüpfen. Zumindest wird mit "Der Schatten des Feindes" ein weiterer gieriger und böser Konzern vorgestellt.
Die komplette Rezension findet man wie immer auf SF-Radio:
Sternenfaust Band 175 - Der Schatten des Feindes (von Thomas Höhl und Andreas Suchanek)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Der Artikel ist also mal wieder ein typischer Artikel des eher populistischen Meinungsressort der Welt. Ein Satz fällt in dem Kommentar jedoch auf:
"Mit dem Schwächeln der FDP haben sie [die Vermögenden und Wohlhabenden] ihre entschlossenste Schutzmacht verloren."mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

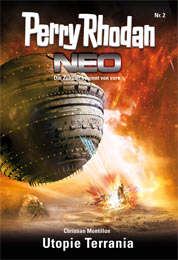 "Utopie Terrania" setzt die Geschichte aus dem ersten Teil nahtlos fort. Perry Rhodan ist mit seinen drei Kameraden in der Wüste Gobi gelandet. Dort basteln sie mit dem Arkoniden Crest hinter einem effektiven Schutzschirm an einer besseren Zukunft für die Menschheit. Dieser Handlungsstrang ist in seinen Motiven äußerst idealistisch und ein wenig märchenhaft. Doch erst zum Ende passiert wirklich etwas, als arkonidische Roboter mit der Arbeit an der utopischen Stadt "Terrania" beginnen. Das ist aber für die Haupthandlung eigentlich das einzige, das wirklich passiert.
"Utopie Terrania" setzt die Geschichte aus dem ersten Teil nahtlos fort. Perry Rhodan ist mit seinen drei Kameraden in der Wüste Gobi gelandet. Dort basteln sie mit dem Arkoniden Crest hinter einem effektiven Schutzschirm an einer besseren Zukunft für die Menschheit. Dieser Handlungsstrang ist in seinen Motiven äußerst idealistisch und ein wenig märchenhaft. Doch erst zum Ende passiert wirklich etwas, als arkonidische Roboter mit der Arbeit an der utopischen Stadt "Terrania" beginnen. Das ist aber für die Haupthandlung eigentlich das einzige, das wirklich passiert.Glücklicherweise wird dieser nicht vorhandene Handlungsfortschritt durch die zahlreichen Nebenhandlungen, die Tempo, Menschlichkeit und interessante Gesellschaftsbeschreibungen mit in den Roman bringen. Dadurch wird der Roman dann doch zu einem kurzweiligen und unterhaltsamen Vergnügen.
Die komplette Rezension findet man auf Sf-Radio:
Perry Rhodan Neo 2 - Utopie Terrania (von Christian Montillon)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
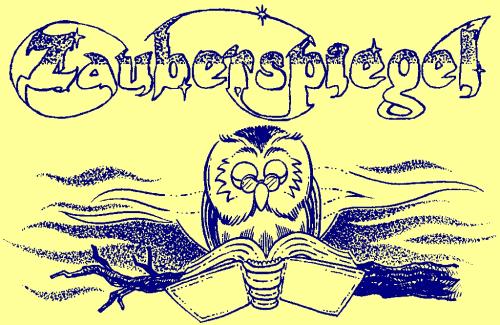
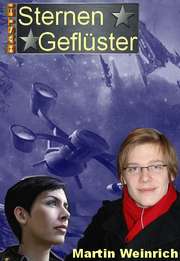 Vor zwei Wochen ging der Zyklus "Die große Leere" der Serie "Sternenfaust" mit dem gleichnamigen Roman zu Ende. Das Ende machte deutlich, dass es im nächsten Zyklus viel zu erzählen geben wird. Die Handlung wurde vorrübergehend nämlich wieder einige Jahrzehnte zurückgesetzt. Abgesehen von der Diskussion über die Fortsetzung der Handlung, sollte man jedoch auch einmal auf den Zyklus zurückgucken.
Vor zwei Wochen ging der Zyklus "Die große Leere" der Serie "Sternenfaust" mit dem gleichnamigen Roman zu Ende. Das Ende machte deutlich, dass es im nächsten Zyklus viel zu erzählen geben wird. Die Handlung wurde vorrübergehend nämlich wieder einige Jahrzehnte zurückgesetzt. Abgesehen von der Diskussion über die Fortsetzung der Handlung, sollte man jedoch auch einmal auf den Zyklus zurückgucken.Der weist nämlich, wie der vorherige, kaum schwache Romane auf. Für die Kolumne auf dem Zauberspiegel stelle ich noch einmal vier ganz besonders gelungene und drei eher nicht so gelungene Romane des Zyklus vor:
Erinnerungen an Maulwürfe und Alpha-Genetics
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
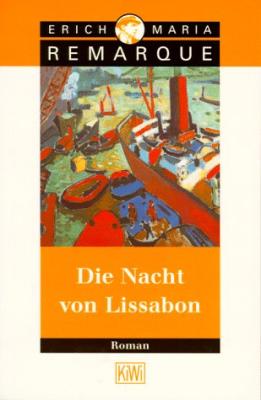 Lissabon 1942 ein namensloser Ich-Erzähler hat gerade im Casino all sein Geld verloren. Er wollte genügend gewinnen, um sich ein Ticket nach Amerika kaufen zu können. Nun läuft das Visum von ihm und seiner Frau ab, ihm droht die Abschiebung in das von Nazis besetzte Frankreich. Da trifft er am Hafen einen Fremden, der ihm zwei Tickets nach Amerika anbietet. Als Gegenleistung muss er sich dessen Geschichte anhören. So zieht er mit einem anderen Emmigranten eine Nacht durch die Bars von Lissabon und erfährt die Geschichte des Mannes.
Lissabon 1942 ein namensloser Ich-Erzähler hat gerade im Casino all sein Geld verloren. Er wollte genügend gewinnen, um sich ein Ticket nach Amerika kaufen zu können. Nun läuft das Visum von ihm und seiner Frau ab, ihm droht die Abschiebung in das von Nazis besetzte Frankreich. Da trifft er am Hafen einen Fremden, der ihm zwei Tickets nach Amerika anbietet. Als Gegenleistung muss er sich dessen Geschichte anhören. So zieht er mit einem anderen Emmigranten eine Nacht durch die Bars von Lissabon und erfährt die Geschichte des Mannes.Die Szenen in Lissabon sind ruhig und gemächlich geschrieben. Für diese Nacht ist man in relativer Sicherheit, in jedem Lokal wird etwas gegessen und getrunken. Diese Abschnitte wirken beinahe heimelig, obwohl klar ist, dass der Fremde ohne seine beiden Tickets verloren ist.
Daher ist dem Leser auch klar, dass es einen Grund geben muss, warum der Exilant seine Tickets nicht mehr haben möchte. Die Antwort wird rasch offensichtlich: Er hat seine Frau verloren. Wie das geschieht, schildert er dem Ich-Erzähler.
Der Exilant nennt sich Schwarz, dieser Name steht auf dem Pass, den er einem verstorbenen Exilanten abgenommen hat. Schwarz wurde gleich zu Beginn der Machtübernahme in ein KZ eingesperrt, im gelang jedoch die Flucht. Aus Frankreich heraus schmiedete er den Plan, seine Frau wiederzusehen. Unter dem Einsatz seines Lebens gelingt es ihm, seine Frau in Osnabrück zu besuchen. Diese ist zunächst abweisend, fasst dann aber den Entschluss mit ihm ins Exil zu gehen. So verbringen sie viel Zeit auf der Flucht, bis Schwarz erfährt, dass seine Frau die ganze Zeit wusste, dass sei totkrank ist. Die Frau stirbt, Schwarz verlässt der Lebensmut.
Das Buch schildert also ein Flüchtlingsdrama, das besonders bitter ist. Mehrmals scheint die Flucht zu misslingen. Doch zum Schluss scheitern die Eheleute nicht an den Nazis oder den französischen Behörden sondern an einer unheilbaren Krankheit. Bei dieser tragischen Geschichte kennt der Leser den Ausgang bereits.
Nichtsdestotrotz ist die Geschichte gelungen und beklemmend erzählt. Die sich wiederholende Verzweiflung, wenn ein Visum ausläuft oder die Behörden einmal mehr willkürlich handeln, ist gut eingefangen.
In erster Linie geht es Schwarz darum, dass seine Erlebnisse nicht vergessen werden. Er hat bereits selbst das Gefühl, sich nicht mehr objektiv erinnern zu können. Daher schildert er - so stellt sich zum Schluss heraus - noch am Abend nach dem Tod seiner Frau seine Geschichte. Dabei wirkt es zunächst erstaunlich, wie ruhig Schwarz doch bleibt. Allerdings bringt ihn der Ich-Erzähler regelmäßig aus dem Konzept. Denn mit jedem Restaurant-Wechsel lässt der Erzähler einen kurzen und gut gemeinten Kommentar fallen. Doch Schwarz bekommt ihn regelmäßig in den falschen Hals, versteht etwas anderes als das, was der Erzähler meinte, oder reagiert einfach nur sehr sensibel. In diesen Momenten merkt man besonders, wie verletzt Schwarz eigentlich noch ist.
Über den Ich-Erzähler erfährt man kaum etwas. Erst das Ende bringt Informationen über sein weiteres Schicksal. Die Beziehung des Erzählers geht kurz nach der Flucht in die Brüche. Im Gegensatz zu Schwarz, der sich mit der Weitergabe seiner Geschichte und seines Passes auch von seiner bisherigen Geschichte zu lösen scheint, übernimmt der Erzähler jedoch einige Eigenschaften des originalen Schwarz. So beginnt er sich für Kunst, insbesondere Malerei zu interessieren. Auch die Geschichte bekommt er nie aus dem Kopf. Insofern ist der Plan des Exilanten zum Schluss aufgegangen, die Geschichte seiner Frau wurde nicht vergessen.
"Die Nacht von Lissabon" vermittelt eine authentische und tragische Geschichte einer Flucht aus der Einflusssphäre der Nazis im Jahr 1942. Die Tragödie bedeutet jedoch die Rettung für ein anderes Paar, das durch die Rettung jedoch nicht glücklich wird. Der Roman ist erst 1960 erschienen. Insofern geht es wahrscheinlich nicht nur Schwarz darum, dass seine Geschichte nicht vergessen ist. Remarque, der ebenfalls vor den Nazis flüchtete, ist nie nach Deutschland zurückgekehrt. Das Buch endet damit, dass eine weitere Flüchtlingswelle losgetreten wird: Diesmal von Ost nach West. "Die Nacht von Lissabon" ist insofern auch ein Plädoyer dafür, die Flüchtlingsschicksale des 20. Jahrhundert nicht zu vergessen, sondern aus ihnen zu lernen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Die Kinder von South Park spielen Mexikaner und Grenzpolizei. Carmant spielt dabei den harten Texaner, der Mexikaner lieber erschießt, als sie in die Vereinigten Staaten zu lassen. Doch von Kyle und Stan wird er böse ausgetrickst. Alle als Mexikaner verkleidete Kinder gelangen hinter die Grenze, Cartman verliert mit seiner Truppe. Doch dann entdecken alle, dass Butters fehlt. Der hält sich tatsächlich für den Mexikaner Meheecan und versucht zurück nach Mexiko zu gelangen. Während die Kinder nun einerseits versuchen, Butters zu finden (Kyle, Stan) oder ihn zu töten (Cartman), wird Butters von einer mittelständischen amerikanischen Familie als Arbeitssklave benutzt und löst letztendlich die Bewegung "Mexican Pride" aus.
Nach der wieder eher ernsten vorherigen Folge fährt South Park mit dieser Episode wieder ein Absurditätenkabinett auf. Cartman macht wieder einmal als Rassist von sich reden, der selbst bei einem Spiel nicht verlieren kann. Dass die Kinder statt Cowboy und Indianer nun Mexikaner und Grenzpolizei spielen, zeigt unter anderem auch wie rassistisch das Originalspiel in seinen Ursprüngen eigentlich ist.
Am gelungensten ist in dieser Folge jedoch nicht Cartman, sondern Butters. Er hält sich nach dem Spiel tatsächlich für einen Mexikaner und versucht nach Mexiko zu gelangen. Auf der Straße wird er von einer liberalen amerikanischen Familie angefahren. Die glauben, nicht die Polzei rufen zu dürfen, um Butters vor der Abschiebung zu retten. Daher nehmen sie ihn bei sich auf, um ihm "great opportunities" zu schaffen. Schnell versuchen sie ihm die wichtigsten Wörter beizubringen. Der Einstand ist "window" - "cleeeaner" - "winnndow" - "cleeeaner". Letztendlich sind sie fest davon überzeugt Butters etwas Gutes zu tun, wenn sie ihn permanent im Haushalt arbeiten lassen. Schließlich sei Hausarbeit noch immer deutlich besser, als dass was ihm in Mexiko blüht. Doch selbst das amerikanische Ehepaar merkt, dass Butters nicht glücklich ist. Sie versuchen erst einmal, ihm mit mehr Arbeit "Glück" zu verschaffen. Dann kommen sie jedoch zu dem Schluss, dass er nur unter "Seinesgleichen" glücklich werden kann. Dieses Ehepaar ist in seinen Bemühungen einfach glorreich, da es dabei nicht einmal zu merken scheint, dass es Butters in einen Sklaven verwandelt. Die Ignoranz der amerikanischen Gesellschaft gegenüber den Lebensbedingungen und der Lebensqualität in Mexiko wird dabei äußerst gut dagestellt.
Doch die Ignoranz der Amerikaner hält in dieser Folge nicht lange an. Denn Butters entfacht mit seinem unbedingten Willen nach Mexiko zu kommen, unter den unterbezahlten amerikanischen Mexikanern eine "Mexican Pride"-Bewegung. Auf einmal versuchen alle Mexikaner möglichst schnell nach Mexiko zurückzukehren. Das verwirrt die echte Grenzpolizei zunächst natürlich maßlos. Dann - und das ist der beste Part der Folge - bringt die Polzei jeden fliehenden Mexikaner zurück in die Stadt, von der er gekommen ist. Schließlich habe man die Aufgabe, Mexikaner am Überqueren der Grenze zu hindern, da sei es egal, in welche Richtung die Mexikaner sich bewegen. Das gelungenste Bild dieser Aktion ist ein Lastwagen, der die Mexikaner zurück auf die Hauptstraße von San Francisco bringt. Amerikanische Einwanderungspolitik einmal umgekehrt.
Während in Amerika die meisten Dienstleistungsstrukturen ohne die Mexikaner zusammenbrechen, merkt Butters, dass er zwar von den Mexikanern verehrt wird, ihm aber seine Freunde fehlen. Die Grenzpolzeit feiert den ersten "zurückkehrenden" Mexikaner und lässt sofort die Grenze öffnen. Nur Cartman, der dann das Kinderspiel verlieren würde, versucht Butters zu hindern. Es kommt dann noch zu einer durchschnittlichen Verfolgungsjagd, die die Episode nicht unbedingt gebraucht hätte.
Doch trotz des unterhaltsamen, aber nicht mehr besonders witzigen Endes ist die Episode sehr gelungen. Die Abhängigkeit der amerikanischen Gesellschaft und die gleichzeitige Ignoranz mexikanischen MitbürgerInnen gegenüber wird sehr schön und äußerst amüsant herausgearbeitet. So muss eine "South Park"-Episode sein.
Die gesamte Folge kann man sich auf der deutschen Seite der Serie ansehen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
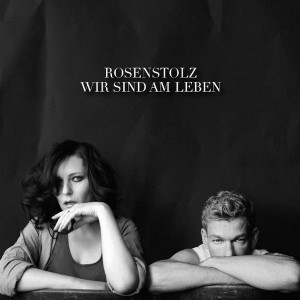 "Überdosis Glück" ist der zweite Titel auf dem aktuellen Rosenstolz-Album "Wir sind am Leben".
"Überdosis Glück" ist der zweite Titel auf dem aktuellen Rosenstolz-Album "Wir sind am Leben".Nach "Wir sind am Leben", das mit nachdenklichen Fragen und einer optimistischen Melodie daher kam, setzt "Überdosis Glück" auf ein ähnliches Konzept. Ein peppiger Rhythmus, deutliche Bläser und weder Klavier noch Streicher, für Rosenstolz ist das durchaus ungewöhnlich. Die Melodie wirkt dabei heiter und vermittelt Bewegung oder zumindest Aufbruchsstimmung. Der Rhythmus des Textes ist ebenfalls heiter gehalten. Das Lied beginnt mit einer Aneinanderreihung kurzer Worte, längere Zeilen gibt es kaum. Und wenn es mal einen längeren Satz gibt, werden die Worte so unnatürlich betont, dass es wieder so wirkt, als sei der Satz gar nicht so lang.
Der Inhalt des Textes passt eigentlich gar nicht zu dem Rhythmus. Schon gesehen, nichts passiert. Aber schön war es doch, ist die Beschreibung, die einer Aufzählung einiger schöner Dinge folgt. Trotz positiver Elemente scheint das Leben hier wohl an einer Art toten Punkt angekommen zu sein, an dem nichts mehr wirklich zufriedenstellend ist. Im Refrain wird dann auch erklärt was fehlt: Die titelgebende Überdosis Glück.
Im Refrain wird bereits angedeutet, dass das Glück an zwei Dingen scheitert. Sorgen und fehlende Liebe erschaffen eine unglückliche Stimmung. Leider wird der Punkt mit den Sorgen lediglich im Refrain angesprochen und in keiner Strophe verarbeitet. Dabei hätte man daraus noch mehr machen können. Die Liebe wiederum ist das Thema der anderen beiden Strophen.
In der zweiten Strophe wird dann klarer, was dieses Glück schaffen kann: Ein Partner. Darum wird sich offensichtlich bemüht, doch das Werben hat keinen Erfolg. Das ist eine etwas platte Aussage, schließlich macht eine Beziehung nun noch längst nicht glücklich. Wobei man bei Rosenstolz auch nicht ganz sicher sein kann, ob mit dem Partner auch unbedingt eine Beziehung verbunden sein muss.
Gelungener ist da die dritte Strophe. Hier geht der Wunsch nach Liebe vor allem in die Richtung "los lassen können." Ich will fliegen, nicht mehr denken, singt AnNa dabei und weicht von dem bisherigen Rhythmus ab. Das ist eine schönere Botschaft, die sich dann schnell wieder mit Teilen des Refrains vermischt.
Das größte Problem an dem Lied ist aber nicht die Verengung auf die Formel "Liebe=Glück", sondern eine häufig unglückliche Wortwahl. Ich brauch ne Überdosis Glück, ich will mein Schaukelpferd zurück, mag zwar für einige witzig klingen, ist erst einmal jedoch irritierend. Auch die Aneinanderreihung Jede Party, jeder Smarty, ist nicht ganz gelungen. Denn auch wenn mit dem "Smarty" ein vermeintlich intelligenter Gesprächspartner gemeint ist, klingt es als hätte das Duo die bunten Schokokugeln unbedingt in einem Lied haben wollen. Mindestens diese beiden Formulierungen stören das Lied also.
Interessant ist jedoch der bereits angesprochene Widerspruch zwischen Text und Melodie. Im Vorfeld wurde in der Berichterstattung natürlich häufig auf Peter Plates "Burn Out"-Erkrankung eingegangen. Darauf antwortete er regelmäßig, dass er kein Jammerlappen-Album machen wollte. Insofern ist das Lied zurecht auch als eine Art Statement zu seiner Krankheit empfunden worden. Selbst wenn die Sorgen den "Mars" füllen würden und Liebe nicht in Sicht zu sein scheint, bedeutet das nicht aufzugeben und zu resignieren. Denn irgendwo wartet die Überdosis Glück dann doch. Das ist eigentlich eine ganz schöne Aussage.
Zudem macht es trotz schwacher zweiter Strophe und teilweise merkwürdiger Wortwahl Spaß, das Lied zu hören. Und so ist "Überdosis Glück" trotz einiger Schwächen und eines teilweise dünnen Textes aufgrund der aufbrechenden Melodie und des Kontrasts zwischen Text und Melodie ein gutes bis sehr gutes Lied.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Vor zwei Wochen erschien der erste Band von "Perry Rhodan Neo". "Sternenstaub" erzählt die Handlung der größten Science-Fiction-Serie der Welt noch einmal modernisiert von vorne. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass gerade die Aufmachung der Serie alles andere als modern ist. Weder wirkt das Heft besonders peppig, noch machen Titel und Cover wirklich Sinn. Das hätte man anders lösen können.
Vor zwei Wochen erschien der erste Band von "Perry Rhodan Neo". "Sternenstaub" erzählt die Handlung der größten Science-Fiction-Serie der Welt noch einmal modernisiert von vorne. Bei näherer Betrachtung fällt jedoch auf, dass gerade die Aufmachung der Serie alles andere als modern ist. Weder wirkt das Heft besonders peppig, noch machen Titel und Cover wirklich Sinn. Das hätte man anders lösen können.Was sonst noch bei der Analyse der Aufmachung und des Inhalts auffällt, kann man in einem Artikel auf dem Zauberspiegel nachlesen:
Unmodern aber ereignisreich - "Perry Rhodan Neo"
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
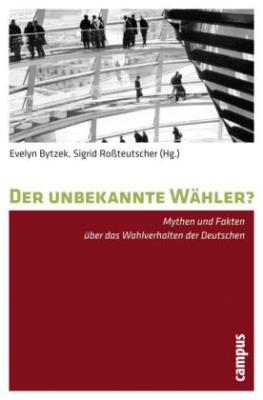 Zeitungen und ihre Leser scheinen viel über "den" Wähler zu wissen. Die Jugend sei zur Zeit ganz besonders politikverdrossen. Der Politik läuft somit auch der Nachwuchs davon. Und die Zeit der Volksparteien sei sowieso vorbei. Der Sammelband "Der unbekannte Wähler - Mythen und Fakten über das Wahlverhalten der Deutschen" nimmt sich daher dreizehn dieser Mythen und vermeindlichen Fakten vor und widerlegt sie in überraschend vielen Fällen.
Zeitungen und ihre Leser scheinen viel über "den" Wähler zu wissen. Die Jugend sei zur Zeit ganz besonders politikverdrossen. Der Politik läuft somit auch der Nachwuchs davon. Und die Zeit der Volksparteien sei sowieso vorbei. Der Sammelband "Der unbekannte Wähler - Mythen und Fakten über das Wahlverhalten der Deutschen" nimmt sich daher dreizehn dieser Mythen und vermeindlichen Fakten vor und widerlegt sie in überraschend vielen Fällen.Die Mythen werden alle durch Zahlen widerlegt. So wird bei der Frage, ob Ideologie bei den heutigen Wählern keine Rolle spielt, erst einmal abgefragt, welche Ideologie die Wähler eigentlich haben. Dann werden die Befragten gebeten, die Parteien ideologisch zu verorten und zum Schluss wird geguckt, ob eine ideologische Wahlentscheidung vorlag. Der überraschende Wert: Noch immer Wählen die meisten Bürger die Partei, die ihrer eigenen ideologischen Positionierung entgegen kommt.
So oder so ähnlich wird bei allen Mythen vorgegangen. Das ist vor allem deswegen spannend, weil dadurch meist Ergebnisse zustande kommen, die der vorherrschenden Medienmeinung diametral gegenüber stehen.
Dennoch gibt es zwei negative Punkte. Die einzelnen Beiträge verstehen sich bewusst als Medienkritik. Daher werden in jeder Einleitung und in jedem Fazit zuhauf Zeitungsartikel zitiert. Viele davon hätte man sich sparen können, das einleitende Zitat genügt meist. Erstens ist die Zeitungszitiertmethode äußerst umständlich, es werden immer Autor, Zeitung und das Erscheinungsdatum genannt. Das mag korrekt sein, ist aber äußerst umständlich. Fußnoten oder ein indirekter Vermerk der Zeitung im Fließtext hätten auch gereicht. Zweitens wählen die Beiträge einen Ton, der die letzte, durch Zahlen bewiesene Wahrheit zeigt. Es wird zwar immer darauf eingegangen, woher und aus welcher Umfrage die Zahlen kommen, doch die Methode selbst wird seltenst angegeben. So ist der Leser dazu gezwungen, den Zahlen zu vertrauen. Auf diese Weise werden in gewisser Weise neue Fakten beziehungsweise Mythen geschaffen. Denn nicht in jedem Beitrag ist die Argumentationsstruktur so einleuchtend, wie die Autoren es darstellen.
Die dreizehn Beiträge werden durch ein ordentliches Fazit abgerundet. Darin werden alle Erkenntnisse noch einmal zusammengefasst. Und es wird darauf hingewiesen, dass in dem Werk lediglich Wählerdefinitionen widerlegt wurden. Also Aussagen lediglich verneint wurden. Die Aufgabe der Wissenschaft sei es nun, anstatt Thesen wie "Die Jugend ist politikverdrossen" zu Thesen darüber zu finden, warum sich Jugendliche politisch engagieren.Aber es gibt auch noch einen selbstkritischen Hinweis. In erster Linie werden in dem Buch Medien zitiert und kritisiert. Das Fazit weist jedoch auch darauf hin, dass viele wissenschaftliche Werke auf die untersuchten Mythen reinfallen oder durch reißerische Titel selbst zur Mythenbildung beitragen. Hier wünschen sich die Autoren auch in der Wissenschaft einen ruhigeren, differenzierteren Ton.
Insgesamt bilden die Beiträge des Sammelband einen angenehm anderen Standpunkt als die übliche Meinung und lassen deutlich positiver auf das Wahlverhalten der Deutschen blicken - solange man den Zahlen vertraut.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
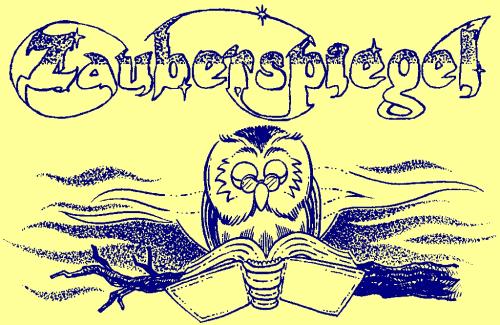
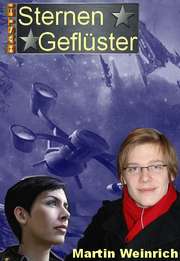 Der "Große Leere"-Zyklus ist jüngst mit dem gleichnamigen Roman zu Ende gegangen. Das Ende versetzte die Handlung vorerst auf den Stand des Band 99 zurück. Das ist natürlich nach 75 mehrheitlich guten Romanen ein großer Schock.
Der "Große Leere"-Zyklus ist jüngst mit dem gleichnamigen Roman zu Ende gegangen. Das Ende versetzte die Handlung vorerst auf den Stand des Band 99 zurück. Das ist natürlich nach 75 mehrheitlich guten Romanen ein großer Schock.Dieser Schock war jedoch durchaus angekündigt und muss gar nicht schlecht sein. Denn mit dem Finale wird nicht nur ein ungewöhnlicher Weg, einen Heftromanzyklus aufzulösen, da man endlich einmal ohne eine neue Waffe auskommt. Es besteht auch die Hoffnung, dass sich die bei "Sternenfaust" schon nicht sklavisch eingehaltene Zyklusstruktur der Serie noch weiter auflöst.
Eine Betrachtung des Finales sowie Überlegungen über die Auswirkungen finden sich in der aktuellen "Sternenfaust"-Kolumne:
"Der Leser wird nach dem Ende von Band 174 fragen: "Hat Thomas Höhl den Verstand verloren?""
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
