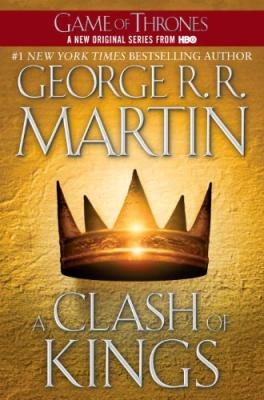 Nach "A Game Of Thrones" sind die sieben Königreiche von einem Staat wieder in viele einzelne zerfallen. Auf dem Königstrohn sitzt Joeffrey, der Erbe des vorherigen Königs Robert. Doch Joeffrey ist gar nicht dessen Sohn, sondern der seines Schwagers. Dieser Inzestfall motiviert die beiden Brüder Roberts, Renly und Stannis, gegen den König vorzugehen. Doch da sich die beiden Brüder selbst nicht einig sind, gehen sie erst einmal aufeinander los. Das passt Joeffrey und seinem Haus Lannister sehr gut. Denn die ehemalige erste Hand des Königs, Eddard Stark, wurde zusammen mit dem König von den Lannisters aus dem Verkehr gezogen. Stark war jedoch der Herr des Nordens. Sein Sohn rief sich bereits im letzten Roman als König des Nordens aus und zog gen Westen. Nun sind die Fronten verhärtet, doch die Zahl der Lannister übersteigt die der Stark um ein weites. Zusätzlich gibt es noch den König der Inseln, der seine eigenen Pläne verfolgt und die Tochter des Vorgängers von Robert. Denn schon Robert hat seinen Thron nur durch Krieg erobern können. Dessen Tochter lebt nun weit ab des Königreiches und bereitet ihre Rache vor.
Nach "A Game Of Thrones" sind die sieben Königreiche von einem Staat wieder in viele einzelne zerfallen. Auf dem Königstrohn sitzt Joeffrey, der Erbe des vorherigen Königs Robert. Doch Joeffrey ist gar nicht dessen Sohn, sondern der seines Schwagers. Dieser Inzestfall motiviert die beiden Brüder Roberts, Renly und Stannis, gegen den König vorzugehen. Doch da sich die beiden Brüder selbst nicht einig sind, gehen sie erst einmal aufeinander los. Das passt Joeffrey und seinem Haus Lannister sehr gut. Denn die ehemalige erste Hand des Königs, Eddard Stark, wurde zusammen mit dem König von den Lannisters aus dem Verkehr gezogen. Stark war jedoch der Herr des Nordens. Sein Sohn rief sich bereits im letzten Roman als König des Nordens aus und zog gen Westen. Nun sind die Fronten verhärtet, doch die Zahl der Lannister übersteigt die der Stark um ein weites. Zusätzlich gibt es noch den König der Inseln, der seine eigenen Pläne verfolgt und die Tochter des Vorgängers von Robert. Denn schon Robert hat seinen Thron nur durch Krieg erobern können. Dessen Tochter lebt nun weit ab des Königreiches und bereitet ihre Rache vor.Diese Einleitung zu der Handlung zeigt bereits, was für einen umfangreichen Hintergrund Martin in dem ersten Teil aufgebaut hat, der nun im zweiten Band ausgebaut werden kann. Denn all die erwähnten Personen sind nicht nur Namen. Martin hat ihnen in dem Vorgänger einen Hintergrund und gewisse Motivationen angeschrieben. Die Fülle der Akteure macht die Handlung komplex, ist jedoch auch eine Schwäche.
Der Roman umfasst etwas über 1 000 Seiten. Jedes Kapitel schildert die Ereignisse aus der Sicht einer Person. Das war im ersten Teil oft noch angenehm, da sich mehrere Personen an einem Ort aufhielten. Mittlerweile sind die Protagonisten jedoch einzelnd über das ganze Königreich verteilt. Das führt dazu, dass hier eine Fülle von Handlungssträngen erzählt werden und man desöfteren 100 bis 200 Seiten warten muss, bis einer wieder aufgegriffen wird. Gerade zu Beginn des Romans ist das anstrengend.
Denn natürlich ist "A Clash Of Kings" nicht von Anfang an übermäßig spannend. Stattdessen legt Martin wieder viele Grundlagen für das Finale des Romans. Wenn man aber immer 200 Seiten lesen muss, um zu erfahren, wie es an einem Ort weitergeht, dann demotiviert das etwas. Die vielen Charaktere an vielen Orten machen die Handlung zwar komplexer und anspruchsvoller, Martin hat es mit ihnen jedoch ein wenig übertrieben.
Außerdem hat man durch Martins Erzählweise Einblicke in beinahe alle Akteure. Lediglich Robb Stark, der König des Norden, wird in diesem Roman merkwürdigerweise ignoriert. Von allen anderen Charakteren, Freund und Feind, weiß man eigentlich was sie planen. Das ist in einem Punkt ein gelungener Schachzug. Denn die Grenzen zwischen Freund und Feind verschwimmen. Zum Schluss versteht man den Standpunkt eines jeden einzelnen Akteurs. Man findet selbstverständlich nicht jeden Standpunkt richtig. Aber man merkt auch, dass die "Guten" sich ebenfalls nicht immer "gut" verhalten. Insofern sorgt die breite Erzählweise für mehr Schattierungen, was dem Roman sehr gut tut.
Doch man ist dadurch auch nicht mehr überrascht. Der König der Inseln plant eine Invasion des Nordens, um Robb Stark in den Rücken zu fallen. Dadurch, dass man einige Kapitel aus der Sicht des Sohnes dieses Königs geschildert bekommt, weiß der Leser bereits was passiert. Nur wie es passiert, bleibt natürlich unklar. Dadurch sinkt aber auch die Motivation weiter zu lesen. Denn wirklich überraschend sind immer nur die Ausführungen, wirklich überraschende Wendungen kann man in dem Roman an der Hand abzählen.
Die Fantasy-Elemente werden auch in diesem Roman wieder abseits der Haupthandlung bedient. Im Norden ist der Bastard der Starks, Jon, dabei eine Invasion von Nordmännern zu entdecken. Die Tochter des vorletzten Königs hingegen hat drei Dracheneier ausgebrütet. Sowohl die Gefahren im Norden als auch die Drachen sind mit unseren Vorstellungen nur schwer erklärbar und deuten darauf hin, dass es in der Welt, die Martin erschaffen hat, doch Fantasy-Elemente gibt. Von den Königen verwendet lediglich Stannis übernatürliche Phänomene. Er paktiert mit einer Sektenführerin, die eine monotheistische Religion durchsetzen möchte. Dank ihrer Hilfe vollführt er erstaunliche Ansätze.
Ab der zweiten Hälfte nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf. Die Könige "clashen" wirklich aneinander, der Ausgang der Zusammenstöße wird tatsächlich etwas unvorhersehbar. Damit steigt dann auch die Erzählgeschwindigkeit, die Kapitel werden etwas kürzer und man erfährt somit schneller, wie es an den verschiedenen Orten weitergeht.
Trotz der Schwächen hinsichtlich der Erzählstruktur muss man Martin nämlich Respekt für die Handlung zollen. Zig Namen müssen hier bedient werden und mittlerweile ist man auf der Insel der sieben Königreiche immer vertrauter. Und auch das bereits erwähnte Verständnis für jeden beschriebenen Charakter ist eine eindrucksvolle Leistung.
"A Clash Of Kings" ist daher ein umfangreicher Roman, der äußerst realisitsch wirkt und dennoch an einigen Stellen mit überraschend glaubwürdigen Fantasy-Elementen durchsetzt ist. Durch die komplexe Handlung und die vielen Charaktere braucht der Roman extrem lange, um in Fahrt zu kommen. Hat man die erste Hälfte jedoch hinter sich, wird man mit einer spannenden und gelungenen Geschichte belohnt.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Steven Spielberg und Peter Jackson verfilmen Tim und Struppi. Dabei nehmen sie klugerweise Abstand von einer Realverfilmung, sondern setzen auf moderne Animationstechnik. Als Vorlage wählen sie eine außergewöhnliche („Das Geheimnis der Einhorn“) und eine gute („Die Krabbe mit den goldenen Scheren“) Geschichte aus der Comic-Reihe, um sie zu einem Film zu verbinden. Das müsste für gute Kinounterhaltung sorgen, tut es jedoch nicht.
Spielberg und Jackson wollten wohl unbedingt die Geschichte der Einhorn erzählen und einen Anfang der Serie markieren. Dementsprechend kennt Tim Captain Haddock zu Beginn des Abenteuers noch nicht. Er stößt von allein auf die Modellschiffe der Einhorn und auf die Hinweise auf den Schatz des Schiffes. Die Verbrecher, die ebenfalls hinter dem Schatz her sind, entführen ihn auf ein Schiff. Dort lernt er Haddock kennen.
Bis dahin ist der Film noch erträglich. Zwar ist bereits klar, dass Schultze und Schulze nicht wirklich funktionieren und Struppi eher nervt als hilft, aber die Geschiche ist noch ordentlich. Auf dem Schiff verharren Haddock und Tim jedoch viel zu lange. Ewigkeiten schleichen sie sich durch Gänge und duellieren sich mit anderen Matrosen. Das wirkt teilweise wie in einem Computerspiel – allerdings nicht wie in einem unterhaltsamen Computerspiel.
Haddock kann zu Beginn für ein, zwei Lacher sorgen, nervt dann aber ebenfalls. Seine ewige Trinksucht wirkt hier zu weinerlich, seine Flüche nicht hart genug. Das fällt aber bei der schwachen folgenden Handlung gar nicht mehr auf. Denn danach folgt noch eine Durchquerung eines Sturms mit einem Wasserflugzeug ohne Strom, eine Schilderung der Schlacht um die Einhorn, eine Verfolgungsjagd in einer Wüstenstadt und ein Showdown in einem Hafen mit Ladekränen (!).
Die zweite Hälfte der Handlung entspringt somit fast ausschließlich der Phantasie der beiden Produzenten. Das merkt man leider. In Hergés Comics gibt es zwar ebenfalls viel Action, die ist jedoch nie so platt wie in diesem Film.
Neben Tim („Der Held ohne Eigenschaften") funktioniert kein Charakter. Struppi nervt, Haddock ist nicht bissig genug und Schultze und Schulze zünden einfach nicht. Zudem lässt der Film vieles aus „Der Schatz Rackam des Roten“ einfach weg. Es kommt nie zu einer Suche des Schiffwracks, womit Professor Bienlein auch nie das Spielfeld betrifft. Das bedauert man während des Films. Danach ist man jedoch eigentlich froh. Denn wahrscheinlich wäre auch Professor Bienlein nicht richtig getroffen.
Wenn man etwas Positives an dem Film finden möchte, dann sind es der Taschendieb aus „Das Geheimnis der Einhorn“ und der Butler Nestor. Nestor ist sehr gut getroffen und man kann ihn sich bereits in kommenden Filmen vorstellen. Der Taschendieb war in dem Comic auf den ersten Blick eine unscheinbare Nebenhandlung, die letztendlich jedoch entscheidend für die Jagd nach der Einhorn war. Dass die Handlung in den Film aufgenommen wurde, ist schön. Leider wurde sie so abgewandelt, dass sie einen weitaus unwichtigeren Beitrag zu der Story leistet.
Ein netter Ansatz ist, dass man versucht hat, bekannt Figuren aus dem „Tim und Struppi“-Universum zu integrieren. So tritt zum Beispiel die Opernsängerin Castafiore auf. Deren Funktion ist jedoch leicht zu durchschauen – ihre hohe Stimme soll ein Glas zertrümmern, wodurch der Schurke des Films an ein Einhornmodell gelangen soll – und ihre Erscheinung wirkt somit zu konstruiert.
Die großen „Action“-Szenen des Films sind, das muss man leider wiederholen, alle misslungen. Die Flucht vom Schiff ist – wie erwähnt – zu lang. Dasselbe gilt für die Flucht aus einer Wüstenstadt, bei der die Stadt zwar schön zerlegt wird, aber sonst nicht viel Notwendiges geschieht. Der letzte Kampf mit Ladekränen ist nur noch albern, unnötig und dämlich. Allerdings ist man da vom Film bereits so genervt, dass dieses Ende auch keinen Unterschied mehr macht.
„Tim und Struppi“ ist ein wunderbar animierter Film, der ein unglaublich schlechtes Drehbuch aufweist. Der Film startet solide, ohne dabei besonders witzig zu sein, und driftet spätestens ab der Mitte völlig ab. Hier wären Jackson und Spielberg gut beraten gewesen, wenn sie einfach den glorreichen Zweiteiler „Das Geheimnis der Einhorn“ und „Der Schatz Rackam des Roten“ verfilmt hätten.
Nach dem Film ist klar, eine einfache Adaption ohne großes Eigenwerk überzeugt mehr. Statt ins Kino zu gehen, sollte man sich lieber die etwas angestaubte, dafür aber kultige und werksgetreue Fernsehserie aus den 90ern zulegen:
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
"1%" ist schon wieder eine "South Park"-Folge, die nicht witzig ist. Die Occupy-Bewegung wird zwar ein wenig auf den Arm genommen, dabei kommt es aber nicht zu wirklich amüsanten Szenen. Stattdessen betonen die Drehbuch-Autoren lediglich, dass es sich bei den Demonstranten sicherlich nicht um 99% der Bevölkerung handelt.
Die Hauptgeschichte spielt sich sowieso zwischen Cartman und seinen Kuscheltieren ab. Dabei stellt sich zum Schluss heraus, dass Cartman den Vorwurf, er müsse erwachsen werden, durchaus ernst nimmt. Daher vernichtet er sein letztes Kuscheltier selbst.
Für den Zuschauer ist damit unklar, wer eigentlich für die Vernichtung der Kuscheltiere zuständig ist. Waren es tatsächlich die Jungen aus der fünften Klasse? Man sieht sie nie bei den Verbrechen, sie machen jedoch deutlich, dass sie Cartman für seine schlechten sportlichen Leistungen bestrafen möchten. Zum Ende ist Cartman jedoch der Meinung, eines seiner Kuscheltiere hätte all die "Morde" inszeniert. Das müsste darauf hinauslaufen, dass Cartman selbst seine Kuscheltiere zerstört hätte. Da man Cartman jedoch regelmäßig bei seinen Taten sieht, ist das eigentlich nicht möglich. Insofern ist Cartmans Selbstfindungstrip ein kleines Rätsel.
Die Botschaft, Cartman müsse endlich erwachsen werden, ist dabei etwas platt. Bereits in der Mitte der Staffel versuchte man, Stan auf eine Art Charakterstudie. Das sind zwar nette Ideen, für eine kritische Comedy-Serie wie "South Park" sollte man das jedoch nur einmal pro Staffel machen. Zumal man aus der "Occupy"-Thematik weitaus mehr hätte machen können.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

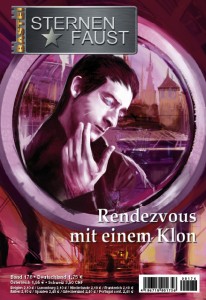 "Rendezvous mit einem Klon" erzählt die Erlebnisse Dr. Tregardes nach seiner Entführung im vorherigen Roman. Er wurde auf die Welt der Gemini verschleppt, die er erst einmal verstehen muss. Die Gemini haben einen Plan mit ihm und wünschen, dass er von sich aus kooperiert. Tregarde merkt jedoch rasch, dass die Gesellschaft der Gemini auf einer Reihe von perversen Prinzipien basiert.
"Rendezvous mit einem Klon" erzählt die Erlebnisse Dr. Tregardes nach seiner Entführung im vorherigen Roman. Er wurde auf die Welt der Gemini verschleppt, die er erst einmal verstehen muss. Die Gemini haben einen Plan mit ihm und wünschen, dass er von sich aus kooperiert. Tregarde merkt jedoch rasch, dass die Gesellschaft der Gemini auf einer Reihe von perversen Prinzipien basiert.Der Roman ist - für Sternenfaust untypisch - ausschließlich aus der Perspektive eines Charakters, Tregardes, geschrieben. Das ist in diesem Fall gelungen und sorgt für eine klasse Geschichte mit lediglich einem kleinen Schönheitsfehler.
Die komplette Rezension kann man auf SF-Radio nachlesen:
Sternenfaust Band 176 - Rendezvous mit einem Klon - von Guido Seifert
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Die Sozialdemokratie hat eine lange Lied- und Gesangstradition, die weitaus mehr umfasst als „Wann wir schreiten Seit' an Seit'“. Die Gesangskultur auf den meisten Ebenen ist jedoch verkümmert, gesungen wird höchstens noch sporadisch. Ein Grund dafür könnte sein, dass man an die Lieder nur schwer herankommt. Sicherlich ist es ein leichtes, MP3-Dateien zu bekommen. Und auch die Texte und Noten kann man sich auf mehr oder weniger legalem Weg aus dem Internet besorgen. Es fehlte aber bisher eine gedruckte, noch erhältliche Sammlung der wichtigsten und bekannten Lieder. Ein Herausgeberkreis um den Kieler Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Bartels änderte das bereits 2009. Damals kam die erste Auflage des „vorwärts Liederbuch“ heraus. Die Auflage war nach kurzer Zeit ausverkauft und nun, zwei Jahre später, liegt die zweite Auflage vor.
Die Sozialdemokratie hat eine lange Lied- und Gesangstradition, die weitaus mehr umfasst als „Wann wir schreiten Seit' an Seit'“. Die Gesangskultur auf den meisten Ebenen ist jedoch verkümmert, gesungen wird höchstens noch sporadisch. Ein Grund dafür könnte sein, dass man an die Lieder nur schwer herankommt. Sicherlich ist es ein leichtes, MP3-Dateien zu bekommen. Und auch die Texte und Noten kann man sich auf mehr oder weniger legalem Weg aus dem Internet besorgen. Es fehlte aber bisher eine gedruckte, noch erhältliche Sammlung der wichtigsten und bekannten Lieder. Ein Herausgeberkreis um den Kieler Bundestagsabgeordneten Hans-Peter Bartels änderte das bereits 2009. Damals kam die erste Auflage des „vorwärts Liederbuch“ heraus. Die Auflage war nach kurzer Zeit ausverkauft und nun, zwei Jahre später, liegt die zweite Auflage vor.
An der Neuauflage lässt sich nur eine ärgerliche Sache finden: Der Preis wurde von 10 € auf 12,50 € erhöht. Bereits bei dem ursprünglichen Preis konnte man nicht von jedem erwarten, dass sich jeder mögliche Mitsänger das Buch kauft. Auch wenn die Preiserhöhung gerade einmal 2,50 € beträgt, ist sie doch ärgerlich. Allerdings erhält man für den Preis eine umfangreiche, stabile und gut gestaltete Liedersammlung.
Das Buch ist zum Benutzen gedacht, schreiben die Herausgeber im Vorwort. Ihr oberstes Ziel ist es, ein praktisches Buch zu präsentieren, das beweisen kann, dass die Arbeiterliederkultur noch immer lebendig ist. Das merkt man auch. Wie schon die erste Auflage kommt das Büchlein mit einem flexiblen Plastikumschlag daher. Der ist abwischbar und vor allem deutlich stabiler, als ein Pappumschlag.
Die Lieder sind in sieben Abschnitte geteilt. Den Anfang macht der Abschnitt „Freiheitslieder“ mit Liedern wie „Die Gedanken sind frei“. Der anschließende Hauptteil „Arbeiterlieder“ deckt von der „Internationalen“ über „Auf, auf zum Kampf“ bis hin zum „Sozialistenmarsch“ eine große Bandbreite von Liedern ab. Es folgen Widerstandslieder wie „Die Moorsoldaten“ und „Das Thälmann-Batallion“ und Friedenslieder wie Brechts geniale „Kinderhymne“ oder Bob Dylans „Blowing in the Wind“. Nach den Friedensliedern findet man „allerlei politische Lieder“. Auch dieser Teil deckt von „Was wollen wir trinken“ bis „Unter dem Pflaster“ ein großes Spektrum von Liedern ab. Den Abschluss machen die Kapitel „Fahrten- und Lagerfeuerlieder“ sowie „Abend- und Abschiedslieder“ die den Vorsatz der Autoren, auch gesellige Lieder zu berücksichtigen, umsetzen.
Jedes Lied ist mit einem kleinen Text über den Autor und die Entstehungsgeschichte des Liedes versehen. Die kurzen Abschnitte informieren dabei ausreichend, um das Lied im Ansatz verstehen zu können, machen aber häufig auch neugierig auf die weitere Geschichte der Lieder. Insofern ist ein Blättern in dem Buch oft erst der Beginn einer Recherche im Internet. Zwischendurch sind Abbildungen von Gemälden, Plakaten und Liederbüchern der Arbeiterbewegung abgedruckt. Insgesamt macht die Gestaltung der Lieder einen sehr liebevollen Eindruck.
Das „vorwärts Liederbuch“ bietet eine große Liedervielfalt, in gelungener Aufmachung und eignet sich tatsächlich gut für den praktischen Gebrauch.
Die Rezension ist ursprünglich für die Novemberausgabe des Bremer Juso-Verbandsmagazin MorgenRot geschrieben worden.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
An all diesen Behauptungen und Analysen ist wahrscheinlich ein Körnchen Wahrheit. Es kann aber auch sein, dass die Mindestlohn-Debatte die FDP retten soll. Denn es sieht nicht so aus, als hätten die SPD oder die Grünen derzeit Lust mit der CDU zu koalieren. Selbst wenn es für rot-grün nicht reichen sollte, scheinen sich die beiden Parteien eher an der Linkspartei zu orientieren als an der CDU. Und das obwohl die Linkspartei derzeit nicht in einem guten Zustand ist. Die CDU muss also dafür sorgen, dass die FDP wieder auf die Beine kommt, um weiterregieren zu können.
Die Union selbst hat im Vergleich zu 2009 in den Umfragen kaum verloren. Sie liegt immer noch im Bereich zwischen 31 und 35 Prozent. Die schlechte Arbeit der Koalition muss in erster Linie die FDP ausbaden, die mittlerweile sehr profillos wirkt. Unionswähler wiederum sind in weiten Teilen durchaus staatsfixiert, nehmen der Partei einen Mindestlohn also nicht wirklich übel.
Für die FDP ist die Debatte hingegen die große Chance. Sie könnte bald die einzige Partei sein, die Mindestlöhne ablehnt. Das wird ein Großteil der Bevölkerung nicht gutheißen. Aber die Menschen, die noch immer gegen einen Mindestlohn sind, könnten das honorieren. Die FDP wäre wieder die (vermeintliche) Bastion wirtschaftlicher Vernunft und bekäme Zulauf.
Die Mindestlohn-Debatte könnte sich daher durchaus als Rettungsanker für die FDP und mit viel (derzeit unvorstellbarem) Glück sogar für die Koalition erweisen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
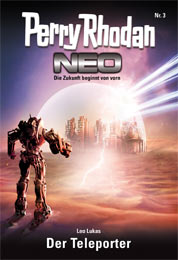 Der dritte Roman der "Perry Rhodan"-Neuerzählung weiß zur Hälfte zu überzeugen. Denn es gibt eine spannende und ereignisreiche Handlung in Amerika. Dabei flieht der ehemalige Chef eines Waisenhauses, John Marschall, mit zwei Schützlingen, Sid und Sue, vor der Polizei im mittlerweile repressiven Amerika. Dabei entdecken alle drei, dass sie besondere Fähigkeiten haben, Sid kann zum Beispiel teleportieren.
Der dritte Roman der "Perry Rhodan"-Neuerzählung weiß zur Hälfte zu überzeugen. Denn es gibt eine spannende und ereignisreiche Handlung in Amerika. Dabei flieht der ehemalige Chef eines Waisenhauses, John Marschall, mit zwei Schützlingen, Sid und Sue, vor der Polizei im mittlerweile repressiven Amerika. Dabei entdecken alle drei, dass sie besondere Fähigkeiten haben, Sid kann zum Beispiel teleportieren.Perry Rhodan wiederum bleibt in der Wüste unter seinem Schutzschild. Er verhilft immerhin zwei Astronauten und dem kranken Arkoniden Crest zur Flucht, ansonsten hälter er aber mal wieder pathetische Reden. Die einzige Ausnahme ist ein Gespräch über seine etwaige Liebe zu der Arkonidin Thora. Diese Spekulationen wirken leider nur albern.
Insgesamt ist "Der Teleporter" damit gut und nett zu lesen. Doch leider schwächelt ausgerechnet die Haupthandlung, die wohl in wenigen Romanen die Einigung der Erde erklären muss. Bis jetzt ist nicht absehbar, wie das mit dem blassen Rhodan gelingen soll. Die komplette Rezension findet man wie immer auf SF-Radio:
Perry Rhodan Neo 3 - Der Teleporter (von Leo Lukas)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Der Kommissar Nebe wurde in das Kaffe Rothenburg an der Fulda versetzt. Er erzählt dieses Hörspiel aus dem Off. Schnell wird deutlich, dass er mit seiner Abschiebung nicht zufrieden ist. Eigentlich wünscht er sich, schnell wieder aus dem Dorf weg zu kommen. Doch dann erfährt er von der Briefträgerin, dass ein toter Fisch in dem Briefkasten eines Hauses vor sich her gammelt. Nebe geht der Sache nach und findet ein totes Geschwisterehepaar, das gemeinsam zwei Söhne hatte. Bei der Lösung des Mordfalls begegnet er weiterem, vermeintlichem „Abschaum“ der Gesellschaft, phädophilen Pflegeeltern und einer obskuren Managermotivationsgruppe.
Der Kommissar Nebe wurde in das Kaffe Rothenburg an der Fulda versetzt. Er erzählt dieses Hörspiel aus dem Off. Schnell wird deutlich, dass er mit seiner Abschiebung nicht zufrieden ist. Eigentlich wünscht er sich, schnell wieder aus dem Dorf weg zu kommen. Doch dann erfährt er von der Briefträgerin, dass ein toter Fisch in dem Briefkasten eines Hauses vor sich her gammelt. Nebe geht der Sache nach und findet ein totes Geschwisterehepaar, das gemeinsam zwei Söhne hatte. Bei der Lösung des Mordfalls begegnet er weiterem, vermeintlichem „Abschaum“ der Gesellschaft, phädophilen Pflegeeltern und einer obskuren Managermotivationsgruppe.„Abschaum“ ist einer der gelungensten Radiotatorte, die ich bisher gehört habe. Leider gilt das nicht für die Auflösung, die den sehr gelungenen Fall beinahe ruiniert.
Der Schmerz des Kommissars wirkt sehr authentisch. Zwar wird in dieser Folge zum wiederholten Mahl damit gearbeitet, dass man die Vorfälle zu der aktuellen Situation nicht kennt, doch hier ist diese Methode am Besten inszeniert. Die Auflösung dieser Frage ist dann auch tragisch und nicht übertrieben konstruiert.
Die Ermittlung ist besonders gelungen, weil sie durch permanente Sprüche aus dem Off begleitet wird, obwohl der Kommissar eigentlich gar keine Sprüche machen möchte. Das wird nie wirklich komisch, sondern sorgt für eine äußerst gelungene Atmosphäre, die durch die Hörkulisse entsteht.
Dabei gelingt es "Abschaum" über lange Zeit Spannung aufzubauen und gleichzeitig den Hörer vollkommen im Unwissen über die wahren Täter zu lassen. Dabei werden verschiedenen Nebenschauplätze aufgebaut. Es stellt sich nämlich heraus, dass die beiden Kinder des Inzest-Paares in Familien gebracht wurden, deren männliche Mitglieder bekannte Pädophile sind.
Die Auflösung zum Schluss ist absurd. Die Managermotivationsgruppe hält sich selbst für die besseren Menschen, die die Aufgabe haben, "Abschaum" zu beseitigen. Daher haben sie das Paar einfach umgebracht. Dieses Motiv ist krank, allerdings auch etwas unglaubwürdig. Denn man muss wirklich schon sehr verrückt sein, um sich zu so einer Tat verleiten zu lassen. Daher müssten alle Mitglieder des Teams nicht nur einer menschenverachtenden Effizienz-Logik angehören, sondern auch verrückt sein. Das wirkt äußerst seltsam.
"Abschaum" ist ein intensives und spannendes Krimi-Erlebnis und einer der besseren "Radiotatorte". Lediglich die Auflösung stört und wirkt unglaubwürdig.
Die Folge kann man noch bis zum 14. November auf der Homepage der Serie herunterladen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Diese Episode hätte man sich auch sparen können. Es wird eigentlich kein interessantes Thema aufgegriffen. Die Musical-Handlung ist zwar abgedreht, aber in erster Linie dämlich. Es ist nicht einmal witzig, dass Spider-Man in Anlehnung an das Flop-Musical "Spider Man" am Broadway zum Schluss die ganzen Beeinflussungen kaput macht. Die Episode ist zwar relativ vergnüglich, witzig ist sie jedoch nicht. Da helfen auch Anspielungen an Sitcoms nicht mehr weiter.
Der einzig interessante Punkt ist, dass alle Männer sofort gewillt sind, ihre Frauen beeinflussen zu lassen. Keiner hat also ein vernünftiges kommunikatives Verhältnis zu ihnen. Daneben ist es noch ganz nett zu sehen, wie Stans griesgrämige Schwester ihren ersten Freund hat. Die Geschichte wird zum Schluss aber aufgrund einer billigen Pointe, die nicht mal wirklich lustig ist, abgewürgt.
"Broadway Bro Down" kann kein interessantes Thema aufweisen und ist darüber hinaus auch noch nicht wirklich witzig. Diese Folge muss man nicht sehen.
Wer das dennoch tun möchte, kann es wie immer auf der deutschen Seite der Serie tun.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
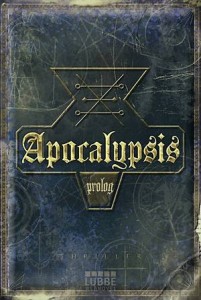 Am 24. Oktober ist die zweite Episode des ersten "Webnovel" Apocalypsis erschienen. Während die Handlung durchaus vorangebracht wurde, sind die Begleitumstände etwas anstrengend.
Am 24. Oktober ist die zweite Episode des ersten "Webnovel" Apocalypsis erschienen. Während die Handlung durchaus vorangebracht wurde, sind die Begleitumstände etwas anstrengend.I. Die Handlung
Die Episode beginnt damit, dass der durchaus gelungene Cliffhangar aus der vorherigen Ausgabe aufgelöst wird. Das geschieht jedoch nicht auf kreative Weise. Stattdessen wird eine rettende Nonne vorbeigeschickt, weil ein Pater eine dunkle Vorahnung hat. Zufall pur.
Die folgenden 40 Seiten sind jedoch durchaus spannend. Der gerade gerettete Hauptcharakter Peter Adams bricht mit der Nonne in die Wohnung des zurückgetretenden Papstes ein. Dort suchen sie einen Hinweis darauf, warum der Papst zurückgetreten und verschwunden ist und ob das etwas mit Peters Vision des Untergang des Vatikans zu tun hat. Der Einbruch ist durchaus spannend und beim Lesen hat man durchaus das Gefühl, dass die Handlung weitergebracht wird.
In dieser Episode wird auch deutlich, dass ein Hauptproblem der zukünftigen Handlung sein wird, dass die verschiedenen Akteure nicht zusammenarbeiten. So weiß der Polizeichef des Vatikans nicht, gegen wen er vorgehen soll. Eine mit Peter Adams befreundete Journalistin misstraut diesem und geht auf eigene Faust vor - mit fatalen Auswirkungen. Die fehlende Kommunikation kann jedoch in den folgenden Episoden für Spannung sorgen. Hier stört es eher, dass jeder alles für sich behält.
Letztendlich täuschen die Ereignisse in der Episode auch darüber hinweg, dass man über die Hintergründe nichts erfährt. Keine einzige enthüllte Tatsache wird wohl eine langfristige Bedeutung haben. Lediglich die gefundenen Artifakte haben eine Bedeutung, deren Verbleib im Cliffhangar ist jedoch unklar.
Und das ist dann auch das gelungenste an der Episode. Auf 40-Seiten wird eine dichte Geschichte mit hohem Tempo erzählt, die in einem gelungenen und durchaus spannenden Cliffhangar überführt wird. Dass täuscht über die schwache Auflösung des Cliffhangars aus der ersten Episode hinweg und darüber, dass die Charaktere noch immer relativ blass sind.
II. Umfang und Dateiformat
Der Verlag gibt auf verschiedenen Seiten an, dass jede Episode 80-Seiten umfasst. Das wirkt wie blanker Hohn. Denn 80-Seiten wären 1,49€ tatsächlich wert. Denn jede Episode umfasst 42 E-Pub-Seiten, die zumindest in der Adobe-Darstellung sehr schmal sind. Hinzu kommt noch, dass die ersten vier Seiten aus Titelbilder bestehen. Letztendlich kommt man so gerade einmal auf 38 Seiten. Das liest man in wenigen Minuten durch - was meinetwegen auch der Sinn eines Webnovels ist - aber 1,49€ sind dafür ein extrem hoher Preis, der auch dadurch nicht besser wird, dass einem 80 Seiten versprochen werden.
Bisher habe ich lediglich libri.de als Anbieter gefunden, der "Apocalypsis" im epub-Format anbietet, das nicht an einen bestimmten Reader gebunden ist. Gleichzeitig ist dieses Format mit einem umständlichen DRM-Schutz belegt. Bis man das auf meinem Reader (Sony) freigeschaltet hat, ist beinahe die Hälfte der Zeit vergangen, die man benötigt, um die Episode zu lesen. Das nervt.
III. Fazit
Die Idee, einen Webnovel zu machen, ist immer noch gut. Preis und Umfang sind jedoch äußerst unbefriedigend. Immerhin wird einem aber eine unterhaltsame und spannende Geschichte präsentiert, die noch das Potential besitzt, wirklich gut zu werden. Der Webnovel muss dafür aber einen typischen Serien-Fehler vermeiden. Denn häufig wird die Handlung nach einem ereignisreichen Start rasch nur noch bis zum Finale gestreckt. Das würde bedeuten, dass von nun an bis zum Finale nur noch wenig geschieht. Sollten in den nächsten Folgen aber bereits die ersten Zusammenhänge aufgeklärt werden und dabei spannende Geschichten erzählt werden, kann der Webnovel richtig gut werden.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Bei der Bewertung zeichnen die Medien eine äußerst negatives Bild der Beschlüsse. Spiegel Online kommt zu dem vagen Fazit, "das kann klappen, ist aber gefährlich". Die Welt ist klarer: "Der Staat spekuliert mit dem Geld seiner Bürger". Beide Artikel erklären jedoch kaum sachlich, sondern machen beim Lesen eher Angst.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
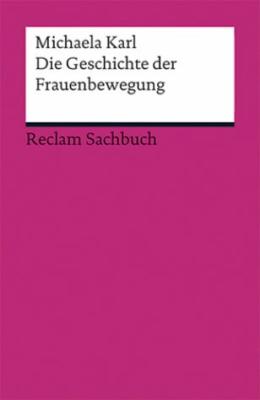 Das Reclam-Sachbuch "Die Geschichte der Frauenbewegung" zeichnet die Titelgebende Geschichte anhand der Entwicklung in Frankreich, England den USA und Deutschland nach. Dementsprechend ist das Buch also in erster Linie eine Skizzierung der westlichen Frauenbewegung.
Das Reclam-Sachbuch "Die Geschichte der Frauenbewegung" zeichnet die Titelgebende Geschichte anhand der Entwicklung in Frankreich, England den USA und Deutschland nach. Dementsprechend ist das Buch also in erster Linie eine Skizzierung der westlichen Frauenbewegung.Zu Beginn wird daran erinnert, dass die Frauenbewegung auch heute noch kaum ein Thema im Geschichtsunterricht ist. Dabei handele es sich bei ihr um die erfolgreichste soziale Bewegung der Moderne. Nicht nur der Satz zeigt, wie wichtig das Buch ist. Denn im weiteren Verlauf werden eine Reihe von Entwicklungen beschriebenen, die man tatsächlich weder aus dem Geschichtsunterricht noch aus Zeitungen entnehmen kann.
Das Buch ist in drei Abschnitte geteilt. Zunächst wird die Entwicklung bis zum zweiten Weltkrieg, die in erster Linie durch Kämpfe um allgemeine Rechte und das Wahlreicht gezeichnet ist, beschrieben. In dem zweiten Teil steht dann der "Feminismus", also wie sich eine Bewegung um die Verwirklichung der Frauenrecht gebildet hat, im Mittelpunkt. Der letzte Teil trägt den Titel "Gender" und skizziert aktuelle Entwicklungen und vor allem Differenzierungen der Bewegung.
Vor allem der erste und der letzte Teil sind dabei sehr interessant. Denn weder die umfangreichen Organisationen, die sich für das Wahlrecht und Frauenrechte im 19. Jahrhundert einsetzten, noch die kleinteiligen Bewegungen, die an die "bekannten" Akteurinnen der 60er und 70er Jahre anschlossen, lassen sich auch über durchschnittliche Medienkonsum aufgreifen.
In dem Buch werden viele Organisationen, Akteurinnen und Ereignisse angerissen. Das macht es teilweise zu kleinteilig. Allein die vielen Vereinigungen, die hier erwähnt werden, wird sich wohl niemand durch eine Lektüre merken können. Auch verliert man in einigen Beschreibungen leicht mal den Überblick, wenn sich eine Organisation mal wieder in mehrere Unterorganisationen aufgespalten hat, um sich später dann wieder zu vereinigen.
Zurück bleibt also das "große" Bild, in dem man vielleicht nicht jede Entwicklung durch das Buch nachvollziehen kann. Der Überblick über die Diskussionen, die theoretische Verwurzelung und die Probleme zu verschiedenen Zeitpunkten in den vier untersuchten Ländern ist jedoch durch das Werk gegeben. Da davon tatsächlich nur wenig an anderen Orten vermittelt wird, ist die Lektüre höchstwahrscheinlich gewinnbringend.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
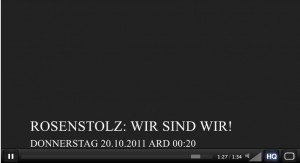 Letzten Freitag lief kurz vor eins eine sehr gelungene Dokumentation auf der ARD. Rosenstolz feiert das 20-jährige Bühnenjubiläum und die ARD hat dem Duo daher eine einstündige Dokumentation spendiert.
Letzten Freitag lief kurz vor eins eine sehr gelungene Dokumentation auf der ARD. Rosenstolz feiert das 20-jährige Bühnenjubiläum und die ARD hat dem Duo daher eine einstündige Dokumentation spendiert.Der Aufbau der Doku verwundert zunächst. Denn es wird nicht etwa mit der Gründung der Band begonnen, sondern mit ihrer schwersten Phase, der chronischen Erschöpfung von Peter Plate. Doch schnell wird klar, dass es sich bei den anfänglichen Szenen lediglich um einen Teaser für die Sendung handeln soll. Dennoch bleibt ein schaler Beigeschmack, dass der „Rahmen“ der Doku ausgerechnet dieses Ereignis sein soll.
Die Doku zeigt auf wunderbare Weise, welche Bandbreite Rosenstolz während ihrer 20-jährigen Arbeit erreicht haben. Dabei wird immer wieder thematisiert, dass sich das Duo den Erfolg hart erarbeiten musste und wenig geschenkt bekam.
Leider wird die Bandgeschichte zwar gut skizziert, dabei stehen aber willkürlich gewählte Lieder im Mittelpunkt. Hier wäre es vielleicht besser gewesen, die Alben zu nennen. Denn oft werden Ausschnitte wie „Die Zigarette Danach (1996)“ gezeigt. Dabei wird jedoch nicht erwähnt, dass lediglich der gezeigte Auftritt von 1996 ist, das Lied jedoch von 1994. Viele Alben werden nicht einmal beim Namen genannt, vom Album „Zucker“, immerhin das erste, das in die deutschen Top-10 gekommen ist, wird sogar kein einziges Lied angespielt.
Die Idee, die Geschichte nicht ganz chronologisch zu erzählen, ist jedoch gelungen. Zwar wird die Entwicklung des Duos dadurch nicht ganz klar, aber die Sprünge fordern den Zuschauer und stellen einige Zusammenhänge durchaus in ein neues Licht.
Die Doku zeigt an einigen Stellen, dass Rosenstolz überraschend authentisch geblieben sind. Selbst bei „Liebe ist Alles“ gibt Peter noch ohne Umschweife zu, dass große Textpassagen des Liedes einfach Klischees bedienen. Aber da er diese Klischees empfinde sei das kein großes Problem. Diese Offenheit wirkt sehr sympatisch.
An anderen Stellen wäre ein kritischer Blick jedoch angebrachter. So haben AnNa und Peter häufiger erwähnt, dass „Macht Liebe“ nicht nur differenziert von Fans aufgenommen wurde, sondern auch in ihren Augen nicht gänzlich gelungen war. Das tut dem Album in meinen Augen zwar unrecht, könnte aber durchaus erwähnt werden. Zudem die beiden die meisten Lieder überarbeitet und dann in einem wunderbaren Live-Album verwendet haben.
Es ist etwas anstrengend, dass grundsätzlich jede gezeigt Szene doppelt auf dem Bildschirm erscheint. Während das Fernsehformat durch die Bilder ausgefüllt ist, wird die Szene gleichzeitig noch einmal in einem Kasten darauf projiziert. Das ist am Anfang etwas anstrengend. Gegen Ende der Dokumentation wirkt das Konzept jedoch weitaus sympathischer und zum Schluss sogar richtig gut.
„Wir sind Wir“ zeigt auf wunderbare Seite die Vielfalt eines der erfolgreichsten deutschen Pop-Duos. Die Stunde unterhält selbst Menschen, die die Geschichte von Rosenstolz bereits kennen wunderbar, was ebenfalls für eine gute Dokumentation spricht. Die Sendung lieft am vergangenen Freitag und ist (wahrscheinlich aus rechtlichen Gründen) nicht in der ARD-Mediathek zu sehen. Wer sie verpasst hat, sollte sie bei einer möglichen weiteren Ausstrahlung unbedingt ansehen, gucken, ob Teile rechtswidrig bei Youtube hochgeladen wurden oder muss sich wohl einfach ärgern.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
