... neuere Einträge
Hector et les secrets de l'amour (von François Lelord)
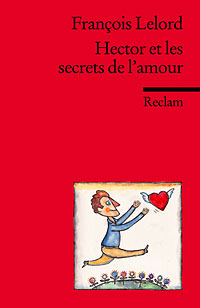 Nachdem sich Hector bereits einmal auf die Suche nach dem Glück gemacht hat, steht im zweiten Teil die Liebe im Mittelpunkt der Reise. Hector ist immer noch Psychater und wird von der Chemiefirma, bei der seine Freundin arbeitet gebeten, sich an einer Tagung über die Liebe zu beteiligen. Dabei erfährt er, dass sein Freund der Professor Cormoran für die Firma an einem neuen Medikament arbeitet, das die Liebe revolutionieren wird. Wenn nämlich zwei Personen es gleichzeitig einnehmen, verlieben sie sich sofort dauerhaft ineinander. Professor Cormoran hatte das Medikament beinahe fertig gestellt, doch dann verschwand er. Hector soll ihn und das Medikament nun wiederfinden. Und so geht Hector wieder auf eine Reise.
Nachdem sich Hector bereits einmal auf die Suche nach dem Glück gemacht hat, steht im zweiten Teil die Liebe im Mittelpunkt der Reise. Hector ist immer noch Psychater und wird von der Chemiefirma, bei der seine Freundin arbeitet gebeten, sich an einer Tagung über die Liebe zu beteiligen. Dabei erfährt er, dass sein Freund der Professor Cormoran für die Firma an einem neuen Medikament arbeitet, das die Liebe revolutionieren wird. Wenn nämlich zwei Personen es gleichzeitig einnehmen, verlieben sie sich sofort dauerhaft ineinander. Professor Cormoran hatte das Medikament beinahe fertig gestellt, doch dann verschwand er. Hector soll ihn und das Medikament nun wiederfinden. Und so geht Hector wieder auf eine Reise.Das zweite Abenteuer Hectors fällt weit hinter das erste zurück. Es spielt an viel weniger Orten, ist viel langatmiger und kann keine interessante Geschichte aufweisen.
Man merkt gleich zu Beginn, dass die Beziehung zwischen Clara und Hector nicht mehr besonders gut ist. Auf einer seiner ersten Stationen wird Hector von dem Professor zu einer Schnitzeljagd eingeladen. Dabei nimmt er das Medikament ein und verliebt sich somit sofort in eine Asiatin, mit der er sich aber nicht unterhalten kann, weil sie keine gemeinsame Sprache haben.
Der Rest des Buches ist daher die Suche nach Cormoran und die Bewältigung des Dreierverhältnisses Hector, Valyia und Clara, wobei Clara eine Affäre mit ihrem Chef Gunther unterhält. Das wird ganiert durch einige chemische und philosophische Überlegungen zur Liebe. Den letzten Teil gab es im vorherigen Roman bereits zum Glück. Das war gut, weil die theoretischen Überlegungen in eine gute Geschichte eingebettet waren. In "Hector et les secrets de l'amour" ist das nicht der Fall.
Hector trifft den Professor nämlich sehr schnell, doch der reist immer wieder ohne Hector weiter. Dadurch bekommt Hector nie das Gegenmittel und bleibt in der irrationalen Beziehung mit der Asiatin. Dabei ist für den Leser relativ schnell ersichtlich, dass es sich bei Hectors Tablette um ein Placebo handeln musste, da er sonst zu einigen Gedanken gar nicht in der Lage sein sollte. Ärgerlich ist auch, dass von Hector kaum Eigenantrieb ausgeht, aus seiner Situation herauszukommen. Dadurch verhält er sich (genau so wie Clara) höchst irrational. Das ist zwar, wenn es um das Thema Liebe geht, durchaus angebracht. Führt hier jedoch zu vielen unglücklichen Situationen im Dschungel, die weder dem Leser noch Hector Spaß machen.
Abgesehen davon, ist die gesamte Geschichte um das Medikament des Professor albern, da sie sehr unrealistisch ist. Da hätte Lelord sich etwas Besseres einfallen lassen können. Zwar ist das Ende noch einmal ganz putzig, in dem sich herausstellt, dass alle Begleiter Hectors eigentlich nur hinter dem Professor her waren. Das rettet die Handlung jedoch nicht.
"Hector et les secrets de l'amour" kann einige interessante Gedanken und Betrachtungen über die Liebe aufweisen. Diese sind jedoch in eine langweilige, anstrengende und letztendlich uninteressante Rahmenhandlung eingebettet. Da kann man sich auch gleich ein Buch über die psychatrischen Erkenntnisse hinsichtlich der Liebe besorgen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Verräter unter uns!

 Die Gemini greifen das Wega-System an. Damit eröffnen sie den Krieg gegen die Solaren Welten mit einem Angriff auf eines der wichtigsten Systeme der Menschen. Die Invasion erlebt Margaret Barnes mit. Barnes ist ehemalige Journalistin und verpatzt am Vorabend der Invasion eine Pressekonferenz. Im Laufe der Invasion zeigt sich, dass die Unterwerfung nicht so offensichtlich ist, wie man denken mag. Um die wahren Pläne der Gemini zu enthüllen, braucht es journalistisches Talent. Und das hat Barnes glücklicherweise ja.
Die Gemini greifen das Wega-System an. Damit eröffnen sie den Krieg gegen die Solaren Welten mit einem Angriff auf eines der wichtigsten Systeme der Menschen. Die Invasion erlebt Margaret Barnes mit. Barnes ist ehemalige Journalistin und verpatzt am Vorabend der Invasion eine Pressekonferenz. Im Laufe der Invasion zeigt sich, dass die Unterwerfung nicht so offensichtlich ist, wie man denken mag. Um die wahren Pläne der Gemini zu enthüllen, braucht es journalistisches Talent. Und das hat Barnes glücklicherweise ja."Verräter unter uns!" begeistert mit einer spannenden und flotten Handlung auf der Wega, bei der die Charaktere allesamt authentisch wirken, obwohl sie das erste Mal in der Serie auftauchen. Lediglich die schwache Nebenhandlung trübt die Freude ein wenig.
Die komplette Rezension findet man wie immer bei SF-Radio:
Sternenfaust Band 177 - Verräter unter uns! (von Gerry Haynaly)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gesehen: The Poor Kid (von South Park)
Cartman denunziert Kennys Familie bei einer Fernsehsendung, die "white trash"-Familien ihre Kinder wegnehmen. Kenny und seine Geschwister werden daher in eine Pflegefamilie gebracht. Cartman sucht sofort nach dem nächstärmsten Kind an der Schule, um dieses zu hänseln. Unglücklicherweise kommen seine Berechnungen zu dem Ergebnis, dass er nun das ärmste Kind an der Schule ist. Als seine Mutter sich weigert, mehr als ihre zwei Jobs zu machen, denunziert er auch sie und kommt in Kennys Pflegefamilie. Das ist jedoch ein agnostisches Paar, dass die Kindern zum Zweifeln zwingt oder sie sonst hart bestraft.
"The Poor Kid" ist das Staffelfinale der 15. "South Park"-Staffel. Die Folge steht eigentlich exemplarisch für eine durchschnittliche Staffel. Die Geschichte um dämlich agierenden Polzei- und Jugendamtsbehörden gepaart mit einer schrägen Pflegefamilie, ist ganz amüsant. Allerdings ist die Episode weder besonders witzig noch besonders bissig.
Viele Szenen der Folge sind an amerikanische Fernsehsendungen angelehnt. Dabei wird beobachtet, wie Kinder von der Polizei aus ihren Familien gerissen werden. Dabei müssen die Eltern immer in die Kamera sagen "I'am white trash and I'm in trouble". Das ist am Anfang witzig, ödet zum Schluss aber eher an. Putzig ist allein, dass alle Beteiligten bereits wissen, was sie zu sagen haben.
Die agnostische Familie ist eine relativ gelungene Idee. Sie zwingen die Kinder dazu, keine klaren Aussagen zu machen. Sie trinken nur Dr. Peppers Cola, weil sie weder Coca noch Pepsicola ist. Beim Tischgebet werden alle religiösen Möglichkeiten bedacht und wer eine eindeutige Aussage macht, kommt in die Folterkammer.
Doch aus der eigentlich guten Idee entstehen kaum lustige Szenen. Kenny übernimmt schnell seine Superheldenidentität, um seine Schwester zu schützen. Dadurch denken die Kinder, es gebe einen Engel und werden von den Pflegeeltern bestraft. Kennys Superheld ist hier jedoch ehe langweilig und nicht witzig.
Der Jugendhelfer, der die Kinder betreut, ist zwar völlig unfähig, er ist jedoch bei weitem nicht überzeichnet genug, um witzig zu sein. Stattdessen nervt auch er bei seinem zweiten Auftritt bereits.
Daher steht "The Poor Kid" für ein Symptom dieser Staffel. Gute Ideen gab es zuhauf, daraus entstanden jedoch nur selten auch gute Episoden. Stattdessen dominierte zu viel Mittelmaß, das aus misslungenen Umsetzungen entstand. "The Poor Kid" kann immerhin zum Ende noch einmal ausbrechen. Cartman wähnt sich nämlich gerade am Ziel, nicht mehr das ärmste Kind an der Schule zu sein, weil Kenny zurückgekehrt ist. Und was in diesen Fällen mit Kenny in der Serie geschieht, sorgt auch nach 15 Jahren noch für ein Schmunzeln.
"The Poor Kid" ist das Staffelfinale der 15. "South Park"-Staffel. Die Folge steht eigentlich exemplarisch für eine durchschnittliche Staffel. Die Geschichte um dämlich agierenden Polzei- und Jugendamtsbehörden gepaart mit einer schrägen Pflegefamilie, ist ganz amüsant. Allerdings ist die Episode weder besonders witzig noch besonders bissig.
Viele Szenen der Folge sind an amerikanische Fernsehsendungen angelehnt. Dabei wird beobachtet, wie Kinder von der Polizei aus ihren Familien gerissen werden. Dabei müssen die Eltern immer in die Kamera sagen "I'am white trash and I'm in trouble". Das ist am Anfang witzig, ödet zum Schluss aber eher an. Putzig ist allein, dass alle Beteiligten bereits wissen, was sie zu sagen haben.
Die agnostische Familie ist eine relativ gelungene Idee. Sie zwingen die Kinder dazu, keine klaren Aussagen zu machen. Sie trinken nur Dr. Peppers Cola, weil sie weder Coca noch Pepsicola ist. Beim Tischgebet werden alle religiösen Möglichkeiten bedacht und wer eine eindeutige Aussage macht, kommt in die Folterkammer.
Doch aus der eigentlich guten Idee entstehen kaum lustige Szenen. Kenny übernimmt schnell seine Superheldenidentität, um seine Schwester zu schützen. Dadurch denken die Kinder, es gebe einen Engel und werden von den Pflegeeltern bestraft. Kennys Superheld ist hier jedoch ehe langweilig und nicht witzig.
Der Jugendhelfer, der die Kinder betreut, ist zwar völlig unfähig, er ist jedoch bei weitem nicht überzeichnet genug, um witzig zu sein. Stattdessen nervt auch er bei seinem zweiten Auftritt bereits.
Daher steht "The Poor Kid" für ein Symptom dieser Staffel. Gute Ideen gab es zuhauf, daraus entstanden jedoch nur selten auch gute Episoden. Stattdessen dominierte zu viel Mittelmaß, das aus misslungenen Umsetzungen entstand. "The Poor Kid" kann immerhin zum Ende noch einmal ausbrechen. Cartman wähnt sich nämlich gerade am Ziel, nicht mehr das ärmste Kind an der Schule zu sein, weil Kenny zurückgekehrt ist. Und was in diesen Fällen mit Kenny in der Serie geschieht, sorgt auch nach 15 Jahren noch für ein Schmunzeln.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Von verdorrten Äpfeln
m-dis | 18. November 11 | Topic '(Kurz)Gelesen'
 Lori wird von einem Blatt nach draußen gelockt. Ihr Mann findet es zwar nicht gut, dass sie spät noch das Haus verlässt, doch sie kann ihn überreden. Sie macht sich auf den Weg zu einem verdorrten Wald. Dort unterhält sie sich mit einem sterbenden Ampfelbaum, der ihr offensichtlich Angst macht. Sie eröffnet dem Baum, dass sie nicht wiederkommen wird, da ihr Mann die Besuche nicht gutheißt. Der Baum wirft ihr einen kleinen Apfel hinterher, den sie mitnimmt und auf dem Rückweg verzehrt. In der Nacht erwacht sie mit großen Schmerzen, ihr Blinddarm platzt, Lori stirbt. Ihr Mann und ihr Vater besuchen sieben Monate später ihr Grab und stellen fest, dass bereits ein kleiner Apfelbaum dort gewachsen ist, der blutrote Äpfel trägt.
Lori wird von einem Blatt nach draußen gelockt. Ihr Mann findet es zwar nicht gut, dass sie spät noch das Haus verlässt, doch sie kann ihn überreden. Sie macht sich auf den Weg zu einem verdorrten Wald. Dort unterhält sie sich mit einem sterbenden Ampfelbaum, der ihr offensichtlich Angst macht. Sie eröffnet dem Baum, dass sie nicht wiederkommen wird, da ihr Mann die Besuche nicht gutheißt. Der Baum wirft ihr einen kleinen Apfel hinterher, den sie mitnimmt und auf dem Rückweg verzehrt. In der Nacht erwacht sie mit großen Schmerzen, ihr Blinddarm platzt, Lori stirbt. Ihr Mann und ihr Vater besuchen sieben Monate später ihr Grab und stellen fest, dass bereits ein kleiner Apfelbaum dort gewachsen ist, der blutrote Äpfel trägt."Von verdorrten Äpfeln" ist eine äußerst kurze Geschichte, die eine merkwürdige Handlung erzählt. Irgendetwas hat dafür gesorgt, dass ein Landstrich, auf dem früher eine Farm stand, verdorrte. Lori scheint den Ort regelmäßig besucht zu haben, ein Blatt reicht aus, um sie dorthin zu rufen. Die Unterhaltung mit dem Baum ist völlig unrealistisch. Zusammen mit den Schilderungen der verschneiten Landschaft, baut diese Konversation jedoch viel Atmosphäre auf. Loris Angst vor dem Baum ist auf den wenigen Seiten deutlich spürbar.
Unklar ist aber, was die Kurzgeschichte ausdrücken möchte. Offensichtlich werden hier Geschlechterrollen reproduziert. Während Lori ein Verhältnis zur Natur aufbauen kann, beschäftigen sich ihr Vater und ihr Ehemann ausschließlich mit Rechnungen, Geschäften und Gewinnen. Außerdem haben die beiden Herren eine Art Weisungsbefugnis über Lori. Ihr ausgesprochenes Verbot sorgt dafür, dass der Baum Lori bestraft. Insofern tragen die beiden eine Mitschuld an Loris Tod. Die Handlung um den Baum wird dadurch jedoch nicht verständlicher.
Der Apfelbaum ist umgeben von toten Bäumen. Lori hat Angst, dass der Apfelbaum ebenfalls bald sterben wird. In der Gegend gibt es zudem noch einen ausgetrockneten Fluss und eine verlassen Farm, auf der nichts mehr wächst. Das alles deutet darauf hin, dass schwerwiegende Veränderungen stattgefunden haben. Vermutlich hat der Mensch die Natur in der Gegend verändert, was ihr nicht gut bekommen ist. Das agressive Verhalten des Baumes könnte somit auch eine Art Rache an den Verletzungen sein, die ihm von den Menschen zugefügt wurde. Dagegen spricht jedoch, dass die Rache die Falsche trifft. Denn Lori hat offensichtlich soviel Sympathie mit der Natur, dass sie sie noch nicht vergessen hat.
Letztendlich könnte die Blinddarmkatastrophe zum Schluss aber auch eine "natürliche" Ursache haben. 1953 stellten Blinddarmentzündungen oder gar ein Platzen des Blinddarms durchaus ernstzunehmende medizinische Probleme dar. Lori und ihr Mann leben in einer Einöde, in der der Arzt lange braucht, bis er das Haus erreicht. Daher kann es auch sein, dass die vorherigen Ereignisse während des Spaziergangs sich in Loris Wahnvorstellungen abgespielt haben. Dem wiederspricht lediglich der Apfelbaum, der aus Loris Leiche heruaswächst und blutrote Äpfel trägt. Ein Apfelkern im Blinddarm könnte also durchaus der Auslöser für Loris Tod gewesen sein.
Insofern muss man "Von verdorrten Äpfeln" wohl als fantastische Geschichte klassifizieren, was für Dick eher ein Normalfall als eine Seltenheit wäre. Da der Baum nie selbst spricht, sondern sich hauptsächlich mit Gesten verständigt, ist die Versuchung jedoch groß, die Ereignisse andersweitig zu erklären. Das gelingt jedoch nicht. Leider fehlt der Geschichte eine Botschaft abseits der eigentlichen, etwas makabren Handlung. Da hätte man einen der beiden oben erwähnten Aspekte (Natur, Geschlechterverhältnis) noch weiter ausbauen müssen.
"Von verdorrten Äpfeln", 11 Seiten, 1953, erschienen in der Zweitausendeins Anthologie "Variante Zwei".
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
A Choice Of Catastrophes (von Michael Schuster & Steve Mollman)
m-dis | 17. November 11
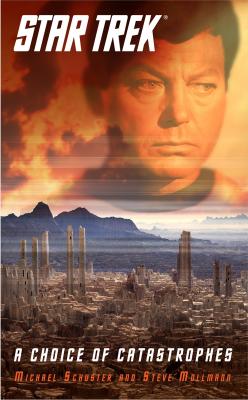 Dieser "Classic"-Roman erzählt, wie die Enterprise den Planeten Mu Ariglon V erkundet, während Doctor McCoy einen Botengang nach "Deep Space C-15" erledigt. Das ist so interessant, wie es sich anhört. Die Autoren erzählen anhand dieser Konstruktion die Geschichte einer Weltraumanomalie sowie einer Sklavenhändlerband, die versucht, ein ganzes eingefrorenes Volk zu versklaven. Um etwas Charaktertiefgang in den Roman zu bringen, konfrontieren sie McCoy mit unklugen Entscheidungen aus seiner Vergangenheit.
Dieser "Classic"-Roman erzählt, wie die Enterprise den Planeten Mu Ariglon V erkundet, während Doctor McCoy einen Botengang nach "Deep Space C-15" erledigt. Das ist so interessant, wie es sich anhört. Die Autoren erzählen anhand dieser Konstruktion die Geschichte einer Weltraumanomalie sowie einer Sklavenhändlerband, die versucht, ein ganzes eingefrorenes Volk zu versklaven. Um etwas Charaktertiefgang in den Roman zu bringen, konfrontieren sie McCoy mit unklugen Entscheidungen aus seiner Vergangenheit.Leider geht diese Geschichte völlig nach hinten los. Die Raumanomalie ist nicht interessant. Sie löst zwar Probleme bei den Telepathen an Bord der Enterprise (!) aus, was wiederum die Stimmen in McCoys Kopf auslöst. Spannend ist das nicht. Die Autoren machen sich nicht die Mühe, den Planeten zu beschreiben. Er wirkt dadurch steril. Die Sklavenhändlerhandlung kommt erst auf den letzten Seiten wirklich in Fahrt und wirkt äußerst konstruiert.
Somit bleibt das Beste an dem Roman das Cover. Und nach dem man das ganz gelungene Bild genossen hat, hätte man den Roman auch wieder aus der Hand legen sollen. Die komplette Rezension findet man bei Trekzone:
Star Trek: A Choice Of Catastrophes (von Michael Schuster & Steve Mollman)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Ungarns Verfassungsgericht jetzt unnötig?
Anfang des Jahres belegte die rechtsnationale Regierung Orbán die ungarische Presse mit strengen Auflagen, die staatlichen Medien werden seitdem ebenfalls stärker kontrolliert. Möglich macht das eine konfortable zwei Drittel Mehrheit, die die Regierungskoalition nach einigen Skandalen der früheren linken Regierung erwerben konnte. Die EU protestierte zwar ein wenig, tat letztendlich aber gar nichts. Auch Deutsche Verlage, die in Ungarn recht aktiv sind, scherten sich nicht darum, dass die Pressefreiheit eingeschränkt wurde. Heute kann man in der taz als kleine Meldung lesen, dass die Regierung Orbán zum nächsten Schlag ausholt: Sie macht das Verfassungsgericht des Landes quasi unnötig.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Schmierfinken - Politiker über Journalisten (von Maybrit Illner und Hajo Schumacher (Hg.))
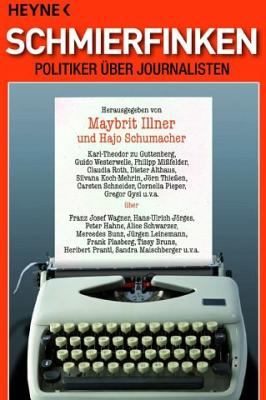 Maybrit Illner und Hajo Schumacher hatten eine schöne Idee: Journalisten schreiben ständig über Politiker, warum lässt man die Politiker nicht mal über die Journalisten sprechen? Unter dem Titel "Schmierfinken" finden sich daher 25 Beiträge von Politikern über den Journalismus und Journalisten. Dabei wird versprochen, dass sich die Politiker "unverblümt und ungeschönt" äußern und dass das Buch "die Verhältnisse auf den Kopf stellt". Dem Anspruch wird das Buch in keiner Weise gerecht.
Maybrit Illner und Hajo Schumacher hatten eine schöne Idee: Journalisten schreiben ständig über Politiker, warum lässt man die Politiker nicht mal über die Journalisten sprechen? Unter dem Titel "Schmierfinken" finden sich daher 25 Beiträge von Politikern über den Journalismus und Journalisten. Dabei wird versprochen, dass sich die Politiker "unverblümt und ungeschönt" äußern und dass das Buch "die Verhältnisse auf den Kopf stellt". Dem Anspruch wird das Buch in keiner Weise gerecht.Denn die Mehrheit der Beiträge lesen sich wie Lobeshymnen auf bekannte Journalisten. Maischberger, Prantel und Jörges bekommen so bestätigende Worte zugehaucht. Kritische Worte finden sich nur äußerst selten.
Die Auswahl der Politiker ist relativ langweilig. Es gibt kaum wirklich bekannte Namen in dem Buch, das vor der Bundestagswahl 2009 erschien. Lediglich Karl-Theodor zu Guttenberg, Guido Westerwelle und Claudia Roth sind von damals einflussreichen Bundespolitikern vertreten. Neben Guttenberg hat kein Minister und kein Fraktionsvorsitzender etwas beigetragen.
Besonders beliebt ist es, einfach über "den" Journalismus zu reden. Das macht zu Guttenberg in seinem Beitrag. Der Beitrag soll irgendetwas zwischen experimentell, klug und witzig sein. Guttenberg beschreibt wie er einen Beitrag über den "Journalist ohne Namen" schreiben möchte. Der Beitrag ist so peinlich, dass es schon wieder witzig ist.
Das es auch anders geht, beweisen die beiden ehemaligen Juso-Vorsitzenden Nils Annen und Björn Böhning. Anhand des SPD-Beauftragten des Spiegels beschreiben sie die Entwicklung des Journalismus hin zum "Journellismus". Bei diesem Modell des Journalismus geht es den Journalisten nur noch darüber, Personenkonstellationen zu konstruieren und zu analysieren. Und wenn man über die SPD-Beiträge des Spiegels in den letzten Jahren nachdenkt, dann wird da tatsächlich in erster Linie darüber geschrieben, welcher Sozialdemokrat wie über andere Sozialdemokraten denkt. Auf jeden Fall gehört der Beitrag zu den Besten des Buches.
Gelungen sind sonst noch die kurze Kolumne von Claudia Roth, die im Stil von Franz Josef Wagner denselben kritisiert und der Beitrag der CDU-Fraktionsvorsitzenden in Rheinland-Pfalz (damals noch Staatssekretärin) Julia Klöckner, die über die Wechselwirkung zwischen Journalismus und Politik schreibt und ein paar Journalistentypen herausarbeitet.
Ansonsten ist das Buch auch durch einen Überhang der damaligen Opposition geprägt, es finden sich extrem viele FDP- und Grüne-Beiträge. Die Linke wird fast komplett ignoriert, lediglich zwei Beiträge stammen von Linken-Politikern.
Kein einziges Mal wird jedoch ein Journalist wirklich hart angegangen. Auch Claudia Roth, Nils Annen und Björn Böhning tun letztendlich niemandem weh. Große Enthüllungen bleiben auch aus, es bleibt letztendlich eine enttäuschende Sammlung lobender bis einschleimender Beiträge von Politikern - und ein peinlicher Beitrag des Lügenbarons.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Beziehungen
m-dis | 14. November 11 | Topic 'Geschrieben'
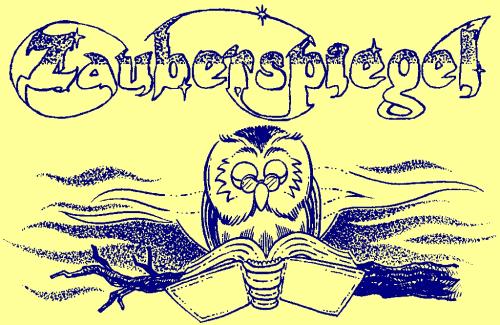
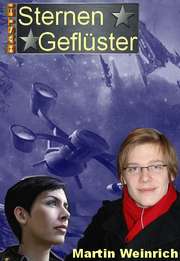 Der aktuelle "Sternenfaust"-Roman ist zum ersten Mal seit langer Zeit komplett aus der Sicht eines einzigen Charakters geschrieben. Das funktioniert überraschend gut. Denn durch den Roman erhält man zum ersten Mal seit langem Einblick in die Gedankenwelt des Bordarztes Tregardes.Dabei werden in diesem Roman mehr Worte über die Schwärmerei des Doktors für die Kommandantin der Sternenfaust als in den vorherigen Bänden. Dabei sind dessen Gefühle seit Band 130 bekannt.
Der aktuelle "Sternenfaust"-Roman ist zum ersten Mal seit langer Zeit komplett aus der Sicht eines einzigen Charakters geschrieben. Das funktioniert überraschend gut. Denn durch den Roman erhält man zum ersten Mal seit langem Einblick in die Gedankenwelt des Bordarztes Tregardes.Dabei werden in diesem Roman mehr Worte über die Schwärmerei des Doktors für die Kommandantin der Sternenfaust als in den vorherigen Bänden. Dabei sind dessen Gefühle seit Band 130 bekannt.Daher wirft die aktuelle "Sternenfaust"-Kolumne mal einen knappen Blick auf die Beziehungen in der Serie. Bei Sternenfaust dominiert nämlich bereits seit langem der (sehr gelungene) Inhalt, der die Charaktere eher auf Funktionen beschränkt. Die Kolumne findet man auf dem Zauberspiegel unter dem Titel:
Beziehungen
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Hilft Regulierung der FDP?
Parteitage sind wohl die größten Inszenierungen von Parteien. In der Regel bemüht sich eine bedrängte Partei, ein “starkes” Signal nach außen zu setzen. Das hat auch die FDP versucht und scheint damit kolossal gescheitert zu sein. Denn heute zum Ende des Parteitags dominiert nur eine Schlagzeile die Berichterstattung: Rösler will die Finanzmärkte stärker regulieren.
Das ist super und es ist toll, dass die FDP dies drei Jahre nach Beginn der Krise ebenfalls begriffen hat. Blöderweise hat das mit FDP-Positionen nur wenig zu tun. Natürlich kann der FDP-Landeschef aus Schleswig-Holstein, Kubicki, sich darüber auslassen, dass die FDP immer falsch verstanden wurde. Bei der letzten Bundestagswahl haben ca. 15% der Bevölkerung die FDP aber nicht nur falsch verstanden. Sie haben sich auch erhofft, dass die FDP den Eindruck, den sie vermittelt auch umsetzt. Eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte gehörte jedoch nicht zu dem Eindruck, den diese Wähler hatten.
Daher wirkt es äußerst skurril, dass ausgerechnet diese Forderung von Rösler während des Parteitags in die erste Reihe gestellt wurde. Denn wie will man frühere Stammwähler zurückgewinnen, wenn man Positionen vertritt, die diese nie gewünscht beziehungsweise honoriert haben?
Also: Regulierung der Finanzmärkte ist gut und schön, aber der FDP dürfte das wenig nützen. Denn wer die Finanzmärkte regulieren möchte, der wählt eine andere Partei. Wer sie hingegen nicht regulieren möchte, wählt in Zukunft nicht mehr die FDP.
Das ist super und es ist toll, dass die FDP dies drei Jahre nach Beginn der Krise ebenfalls begriffen hat. Blöderweise hat das mit FDP-Positionen nur wenig zu tun. Natürlich kann der FDP-Landeschef aus Schleswig-Holstein, Kubicki, sich darüber auslassen, dass die FDP immer falsch verstanden wurde. Bei der letzten Bundestagswahl haben ca. 15% der Bevölkerung die FDP aber nicht nur falsch verstanden. Sie haben sich auch erhofft, dass die FDP den Eindruck, den sie vermittelt auch umsetzt. Eine stärkere Regulierung der Finanzmärkte gehörte jedoch nicht zu dem Eindruck, den diese Wähler hatten.
Daher wirkt es äußerst skurril, dass ausgerechnet diese Forderung von Rösler während des Parteitags in die erste Reihe gestellt wurde. Denn wie will man frühere Stammwähler zurückgewinnen, wenn man Positionen vertritt, die diese nie gewünscht beziehungsweise honoriert haben?
Also: Regulierung der Finanzmärkte ist gut und schön, aber der FDP dürfte das wenig nützen. Denn wer die Finanzmärkte regulieren möchte, der wählt eine andere Partei. Wer sie hingegen nicht regulieren möchte, wählt in Zukunft nicht mehr die FDP.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Journalismus am Abgrund - Wie wir in Zukunft Öffentlichkeit finanzieren (von Marc Jan Eumann)
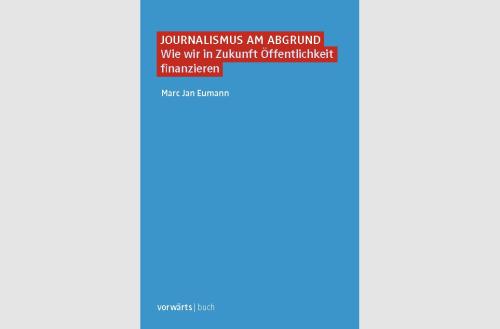
Zeitungen verlieren immer mehr Leser und werden immer unprofitabler. Mittlerweile sind auch große Zeitungen wie die "Frankfurter Rundschau" in Bedrängnis, die Angst vor dem großen Zeitungssterben grasiert. Gleichzeitig sinkt die Qualität der Blätter immer mehr, da die Verlage Journalisten entlassen und an allen Ecken sparen. Der Journalismus scheint sich in einem Teufelskreis zu befinden.
Der Vorsitzende der SPD-Medienkommission stellt daher mit seinem Buch "Journalismus am Abgrund" die Frage, wie Öffentlichkeit eigentlich in Zukunft finanziert werden soll. Diese Frage kann er nur unzureichend beantworten. Dennoch lohnt sich die Lektüre des Buches. Denn sie ist ein sehr gelungener Abriss über die Presselandschaft in den USA, Großbrittanien, Frankreich und Italien. Außerdem liefert das Buch einen guten Überblick über die Entwicklung von Nachrichtenagenturen und verweist auf eine Reihe kreativer Finanzierungswege von Journalismus. Die Frage, wie Öffentlichkeit in der Zukunft finanziert werden kann, beantwortet Eumann jedoch nicht konkret, da es dafür in seinen Augen keinen "Königsweg" gibt.
Eumann beginnt sein Buch mit einer Schilderung der derzeitigen Situation in Deutschland. Dabei liegt sein Schwerpunkt darauf, dass sich die Finanzierung geändert hat. Während früher zwei Drittel der Erlöse durch Anzeigen erwirtschaftet wurden, sind Verkaufs- und Anzeigeneinnahmen mittlerweile bei den meisten Zeitungen gleich hoch. Dieser Trend verstetigt sich, da das Internet immer mehr Anzeigen abwirbt. Das bringt einige Probleme mit sich und sorgt vor allem dafür, dass Presseprodukte immer teurer werden.
In einem umfangreichen Mittelteil geht Eumann, wie erwähnt, auf die Situation in den USA, Großbritannien, Frankreich und Italien ein und schildert die Entwicklung der Nachrichtenagenturen. Das ist interessant, denn über die deutschen Medien bekommt man relativ wenig Informationen über die Medienlandschaft in anderen Ländern. Die einzelnen Abschnitte sind gut strukturiert. Eumann skizziert knapp die wirtschaftliche Situation einiger Zeitschriften, erwähnt manchmal positive Einzelfälle oder Journalisten, die sich gegen den Trend stemmen konnten, und verweist auch immer wieder auf staatliche Subventionsmöglichkeiten. Dabei arbeitet er Subventionsmethoden von der Reduzierung der Mehrwertsteuer für Presseprodukte über die staatliche Förderung der Journalistenausbildung bis hin zu niedrigeren Zöllen für Zeitungspapier heraus.
Sehr interessant ist das abschließende Kapitel über Nachrichtenagenturen. Denn keine Zeitung kann es sich leisten, überall Korrespondenten zu haben. Daher gibt es Nachrichtenagenturen. Wie diese sich entwickelt haben und wie auch um den Einfluss auf Agenturen gekämpft wurde, beschreibt Eumann recht detailliert.
Im letzten Drittel geht Eumann dann der Eingangsfrage nach. Dabei hält er zu Beginn fest, dass unabhängige Medien für eine demokratische Gesellschaft unerlässlich sind, dass die Finanzierung dieser Medien jedoch schon immer Veränderungen unterworfen war und sich immer ein rettender Weg finden ließ. Allerdings gebe es derzeit keinen Königsweg für die Finanzierung von Journalismus. Nach dieser Eingangsfeststellung werden dann verschiedene Lösungen auf Probleme skizziert. Die Ideen reichen dann von der Konzentrierung auf Online-Möglichkeiten (bezahlte Online-Zeitung, Recherche über soziale Netzwerke) über die Fokussierung auf lokale Konzepte (Kommunalpolitik in Lokalzeitungen stärken, Kompetenzsteigerung bei Lokalzeitungen) bis hin zu Stiftungen und Crowdfunding-Modelle.
Klar ist jedoch immer, dass es in Zukunft weniger und vor allem teurere Zeitungen geben wird. Daher ist fraglich, ob die Modelle, die er skizziert tragfähig sind. Denn eine bezahlte Internet-Zeitung wird wohl in absehbarer Zukunft nicht die Recherche-Fähigkeit der derzeitigen großen Zeitungen an den Tag legen. Die Politikkompetenz von Lokalzeitungen kann sicherlich gesteigert werden. Doch auch sie leiden darunter, dass Anzeigenerlöse ausbleiben, werden teurer und verlieren Leser. Viele Lokalzeitungen kämpfen daher um ihr Überleben. Und Vielfalt gibt es auf diesem Makrt an vielen Stellen schon lange nicht mehr. Daher ist es auch fraglich, ob darin die Zukunft liegt. Stiftungen wiederum sind eine sehr gute Idee. Doch Stiftungen einzurichten ist schwierig und ebenfalls teuer. Eumann berichtet über einige interessante Stiftungen aus den USA und Großbritannien, die keine Zeitung herausgeben, sondern einfach nur Artikel prodzuieren. Diese sind gut recherchiert und werden an Zeitungen weitergegeben, teilweise sogar kostenlos. Das sind beeindruckende Beispiele, die jedoch ebenfalls nicht ausreichen, um eine Massenpresse zu sichern.
Eumanns Lösungsansätze für die Verlage sind etwas merkwürdig. Eine Reduzierung der Mehrwertsteuer und die steuerliche Absetzung von Abonnements machen als indirekte Subventionen noch Sinn. Auch die Verbesserung des Urheberrechts leuchtet noch ein. Warum aber das Pressekonzentrationsrecht unbedingt geändert werden sollte, um eine bessere Zusammenarbeit zu ermöglichen, ist unklar. Denn natürlich sind große Konzerne leistungsstärker. Andererseits wird Vielfalt nicht dadurch bewahrt, dass alle zusammenarbeiten. Da muss es andere Lösungen geben.
Das Buch endet mit dem konkreten Vorschlag Coopetition und einer 14-Punkte-Liste. Bei "Coopetition" geht es in erster Linie darum, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk mithilft, den Journalismus zu finanzieren. Das könnte unter anderem dadurch gelingen, dass Zeitungen das Korrespondentennetz und andere Infrastrukturen mitnutzen. Aber auch Zeitungen sollen bei Infrastrukturen kooperieren, während sie gleichzeitig auf dem Markt konkurrieren. So werden Kosten gesenkt und durch Wettbewerb wird dennoch Meinungsvielfalt gesichert. Dieses Modell wirkt etwas utopisch, ist aber immerhin ein handfester Lösungsvorschlag.
Die 14-Punkte fassen das lehrreiche und interessant Buch zusammen. "Journalismus am Abgrund" ist somit eine sehr gelungene Darstellung der Pressesituation in einigen westlichen Ländern, bietet einen Aufschlussreichen Abriss über die Entwicklung der Nachrichtenagenturen und zeigt, dass es eine schwierige, aber lohnenswerte Aufgabe sein wird, weiterhin Öffentlichkeit in Deutschland zu sichern und zu finanzieren.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gesehen: A History Channel Thanksgiving
 Die Jungs bekommen den Auftrag, einen kritischen Text über "Thanksgiving" zu schreiben. Cartman hat darauf überhaupt keine Lust, hat aber auch eine vermeintlich geniale Idee. Da Thanksgiving naht, laufen im History Channel viele Dokumentationen über das Thema. Die müsse man sich lediglich angucken, dann ließe sich der Text ganz einfach schreiben. Die Dokumentationen auf dem Sender verkünden die "wahre" Geschichte hinter Thanksgiving: Sowohl die Indianer als auch die Pilger waren Außerirdische!
Die Jungs bekommen den Auftrag, einen kritischen Text über "Thanksgiving" zu schreiben. Cartman hat darauf überhaupt keine Lust, hat aber auch eine vermeintlich geniale Idee. Da Thanksgiving naht, laufen im History Channel viele Dokumentationen über das Thema. Die müsse man sich lediglich angucken, dann ließe sich der Text ganz einfach schreiben. Die Dokumentationen auf dem Sender verkünden die "wahre" Geschichte hinter Thanksgiving: Sowohl die Indianer als auch die Pilger waren Außerirdische!Nach einer Reihe schwächerer Episoden, amüsiert "A History Channel Thanksgiving" endlich wieder. Anhand eines der wichtigsten amerikanischen Feste, werden docudramas aufs Korn genommen. Diese Dokumentationsform verbreitet sich auch in Deutschland immer mehr. Während man auf N24 und ähnlichen Sendern gelgentlich erfahren kann, ob Hitler nun wirklich manisch depressiv oder doch eher schwul war, ist das Format in den USA noch viel verbreiteter.
Diese Episode nimmt die Arbeitsweise der Sender, die jeden vermeintlichen Wissenschaftler mit kruder These zu Wort kommen lassen, ins Visier und das ist komisch. Denn im Laufe der Folge landen auch Klyde und Stan als "Professoren" in einer Sendung des History Channels. Bei den Beweisen wird mit unglaublich präziser Methode gearbeitet. Das Highlight ist ein Professor der darauf verweist, dass in keinem Journal aus der Untersuchungszeit erwähnt wird, dass Aliens nicht bei Thanksgiving anwesend waren. Die kruden Thesen, dass sowohl Indianer als auch die Pilgerväter Außerirdische seien, erhärten sich paradoxer Weise dennoch. Die abgedrehte Episode enthüllt, dass es fünf Planeten gibt, die durch Wurmlöcher miteinander verbunden sind. Die Indianer und die Pilger leben auf einem und haben vor 300 Jahren auf der Erde Frieden geschlossen. Das ändert sich nun, nachdem die Indianer ein Friedensabkommen "gebrochen" haben, indem sie ihr Land zurückforderten.
Der History Channel will mit seinen Thesen auch die Verbrechen an den Indianern entkräften. Die Pilger seien nicht böse gewesen und hätten den Indianern nichts Böses getan. Das sei nur eine weiße Konstruktion. Diese These wird die ganze Zeit bestätigt und untermauert. Allerdings führend die Pilger zum Ende der Episode, nachdem sie wieder erstarkt sind, genau den Genozid an den Indianern durch, der von den Menschen in Zweifel gezogen wird.
"A History Channel Thanksgiving" ist eine gelungene "South Park"-Folge, die mit der Gutgläubigkeit der Menschen gegenüber Fernsehsendungen spielt und dazu noch eine gelunene und abgedrehte Handlung präsentieren kann.
Die Episode kann - wie alle "South Park"-Episoden - auf der Homepage der Serie angesehen werden.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Krisenbewältigung
Europa befindet sich am Abgrund und unsere Bundeskanzlerin reist von Gipfel zu Gipfel. Über diese hohen Gremien wird regiert, doch die Gremien selbst reagieren nur. Jedes Mal schnüren die anwesenden Staatschefs, Finanzminister oder Wirtschaftsminister mühsam einen Minimalkompromiss, mühen sich ab, diesen durch die nationalen Parlamente zu bringen und stellen dann fest, dass das wenig Erreichte bei weitem nicht ausreicht. Eine “klare Linie” ist dadurch nicht möglich. Jede Maßnahme scheint nur punktuell zu fruchten und die Probleme nicht an ihren Wurzeln zu packen. mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Wirtschaftskompetenz: - 6 000 000 000?
Es ist Mittwoch und das Wochenende hat in der Berichterstattung bereits keinen Platz mehr. Von den beschlossenen Steuersenkungen hört man nur noch, dass die SPD sie mit allen Mitteln blockieren möchte. Die Koalition hofft hingegen, dass die Bevölkerung dies nicht honorieren wird. Es steht damit jedoch fest, dass die Ergebnisse dieses Wochenendes so mickrig sind, dass nicht einmal die FDP sich traut, dies als großen Erfolg zu vermarkten.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Die Apokalypse

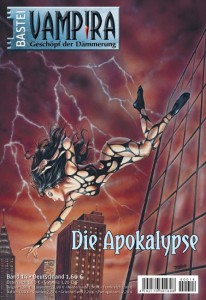 Der aktuelle "Vampira"-Roman hält, was er verspricht. Tatsächlich bahnt sich in diesem Heft die Apokalypse an. Leider wirkt das Ganze eine Nummer zu groß für das 14. Heft der Reihe. Durch ein hohes Erzähltempo und das Aneinanderreihen von Ereignissen wird zwar etwas Spannung aufgebaut, dennoch wirkt die Handlung um die Schöpfungsmythologie der Aborigines zu "groß", um sie einfach so in einem Doppelband abzuhandeln.
Der aktuelle "Vampira"-Roman hält, was er verspricht. Tatsächlich bahnt sich in diesem Heft die Apokalypse an. Leider wirkt das Ganze eine Nummer zu groß für das 14. Heft der Reihe. Durch ein hohes Erzähltempo und das Aneinanderreihen von Ereignissen wird zwar etwas Spannung aufgebaut, dennoch wirkt die Handlung um die Schöpfungsmythologie der Aborigines zu "groß", um sie einfach so in einem Doppelband abzuhandeln.Da zum Schluss noch nicht ganz sicher ist, ob die Apokalypse wirklich verhindert worden ist, besteht noch Hoffnung, dass hiermit ein langfristiger Handlungsstrang eröffnet wurde. Das würde bedeuten, dass die Aborigine-Thematik die Chance bekommt, noch etwas ausführlicher in die Serie eingebettet zu werden. Vielleicht steht dann auch nicht gleich das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel. Andererseits würde es mich nach diesem Roman freuen, wenn mal wieder andere Vampire in der Serie auftreten würden - und das obwohl die echten Vampire der Serie bisher keine gute Figur gemacht haben.
Die komplette Rezension findet man bei SF-Radio:
Vampira Band 14 - Die Apokalypse (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
... ältere Einträge
