... neuere Einträge
Mappus und ENBW: Späte Aufregung
Aus Baden-Württemberg erreichte in den letzten Wochen und Monaten vor allem die Aufarbeitung um den EnBW-Kauf des ehemaligen Ministerpräsidenten Mappus die Bundespresse. Der einhellige Tenor ist, dass der Deal ein Geschmäckle hat. Es wird von Begünstigung und Steuergeldverschwendung geredet. Dazu kommen pikante Informationen wie der Hinweis eines Beteiligten, Stefan Mappus könne mit seinen "Truppen" der Kanzlerin gefährlich werden. Das alles ist reichlich unangenehm für den CDU-Landesverband in Baden-Württemberg, der sich als größte Oppositionspartei gerne mit voller Kraft auf die Pannen der neuen Regierungskonstellation grün-rot stürzen würde. Das lassen die Medien aber nicht zu. CDU-Vertreter müssen sich fragen lassen, wie Mappus den Deal quasi im Alleingang abwickeln konnte und warum die CDU jemanden wie Mappus überhaupt zum Ministerpräsidenten gemacht hat.
Dieses Trommelfeuer an “investigativen” Fragen ist äußerst scheinheilig. Denn alle diese Fragen hätten bereits Anfang 2011 gestellt werden müssen.mehr
Dieses Trommelfeuer an “investigativen” Fragen ist äußerst scheinheilig. Denn alle diese Fragen hätten bereits Anfang 2011 gestellt werden müssen.mehr
Permalink (2 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Die Delta-Anomalie (von Rick Barba)

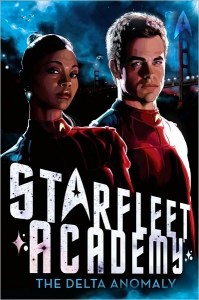 "Die Delta-Anomalie" ist der Beginn einer "Star Trek"-Jugendbuchserie, die in der alternativen Zeitlinie des letzten "Star Trek"-Films spielt. Dementsprechend ist auch der Aufbau des Buches: Wenig Seiten, große Schrift, kurze Sätze. Das sorgt für hohes Lesetempo, die Komplexität der Handlung leidet aber automatisch darunter. Dennoch gelingt es dem Autor, trotz einiger konzeptioneller Schwächen, den ein oder anderen interessanten Aspekt aus der Handlung herauszuarbeiten.
"Die Delta-Anomalie" ist der Beginn einer "Star Trek"-Jugendbuchserie, die in der alternativen Zeitlinie des letzten "Star Trek"-Films spielt. Dementsprechend ist auch der Aufbau des Buches: Wenig Seiten, große Schrift, kurze Sätze. Das sorgt für hohes Lesetempo, die Komplexität der Handlung leidet aber automatisch darunter. Dennoch gelingt es dem Autor, trotz einiger konzeptioneller Schwächen, den ein oder anderen interessanten Aspekt aus der Handlung herauszuarbeiten.Die komplette Rezension ist auf Trekzone nachzulesen:
Starfleet Academy - Die Delta-Anomalie (von Rick Barba)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Der Hüter des Krinoi'i

 Mit "Der Hüter des Krinoi'i" steigt Mara Laue nach langer Zeit wieder als Autorin in die Serie "Sternenfaust" ein. Mara Laue schrieb einst im Schnitt jeden dritten Roman der Serie und war besonders gut darin, fremde Völker auf engem Raum zu beschreiben. Vielleicht auch um dieses Klischee zu wiederlegen, glänzt der Roman nicht mit einem neuen Volk, sondern mit einem alten und dem Innenleben der Sternenfaust-Besatzung. Denn im Gegensatz zu der etwas konventionellen Haupthandlung wissen die Nebenstränge um Verwandte der Shisheni und desillusionierte und diskriminierte Sternenfaust-Mitglieder wirklich zu überzeugen.
Mit "Der Hüter des Krinoi'i" steigt Mara Laue nach langer Zeit wieder als Autorin in die Serie "Sternenfaust" ein. Mara Laue schrieb einst im Schnitt jeden dritten Roman der Serie und war besonders gut darin, fremde Völker auf engem Raum zu beschreiben. Vielleicht auch um dieses Klischee zu wiederlegen, glänzt der Roman nicht mit einem neuen Volk, sondern mit einem alten und dem Innenleben der Sternenfaust-Besatzung. Denn im Gegensatz zu der etwas konventionellen Haupthandlung wissen die Nebenstränge um Verwandte der Shisheni und desillusionierte und diskriminierte Sternenfaust-Mitglieder wirklich zu überzeugen.Die komplette Rezension ist auf SF-Radio nachzulesen:
Sternenfaust Band 194 - Der Hüter des Krinoi'i (von Mara Laue)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gesehen: The 112th Congress (The Newsroom Folge 3)
Will McAvoy, Moderator der Nachrichtensendung News Night, entschuldigt sich zu Beginn der Episode in einem Editorial dafür, zu lange oberflächliche Nachrichten produziert zu haben. Im Nachgang geht er, als Republikaner, hart gegen den Populismus der "Tea Party"-Bewegung vor und versucht, für einen seriösen Konservatismus einzutreten. Das wird in der Firmenzentrale äußerst kritisch gesehen, der Verantwortliche für die Nachrichtensendung, Charlie Skinner, bekommt das deutlich zu spüren. Im Hintergrund menschelt es in der Redaktion: Wills viele Dates regen seine Ex-Freundin und Produzentin MacKenzie auf, obwohl sie selbst wieder in einer Beziehung ist. Der zweite Produzent Jim, hilft der Journalistin Maggie zwar in einer Notsituation, in der sie von ihrem Freund im Stich gelassen wird. Das reicht jedoch nicht aus, um sie davon zu überzeugen, sich endgültig von ihm zu trennen.
Der Beginn der Folge ist gut anzuhören und dramatisch inszeniert. Will spricht dabei viele Wahrheiten, die man über Fernsehnachrichten, nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, beklagen könnte, aus. Dabei betont er immer, dass er ausschließlich sich selbst beschuldigt und andere Journalisten weder kritisieren noch zu einer ähnlichen Entschuldigung auffordern möchte. Das ist äußerst rücksichtsvoll und trägt damit leider nur noch mehr dazu bei, dass dieser Teil äußerst unrealistisch wirkt. Aus dieser Eingangsszene sprüht so viel Idealismus, dass es wieder einmal etwas zu viel ist. So sehr man sich so einen Ansatz auch wünschen mag, wahr kann er wohl nicht werden. Daher unterstützt Wills Entschuldigung den märchenhaften Eindruck, den man von den Vorgängen in der Serie erhält.
Glücklicherweise wird der Idealismus im Verlauf der Episode mit der Realität konfrontiert. Will und sein Team machen - und das ist das Highlight an dieser Folge - in den darauf folgenden Wochen und Monaten eine seriöse und kritische Nachrichtensendung, die sich aber nicht davor scheut, Ereignisse einzuordnen. Dies zu beobachten, macht Spaß. Die vielen Sendungen werden aber nicht nur im Zeitraffer dargestellt, sondern auch als Rückblende. Alle Ereignisse sind nämlich in eine Rahmenhandlung eingebettet. Darin befindet sich Charlie, der zuständige Verwantwortliche der Firmenleitung für die Sendung, in einem Meeting mit der Führungsspitze des Senders. Anwesend ist Leona Lasing, der CEO des Senders, und ihr Sohn, ihr designierter Nachfolger.
Obwohl Wills Sendung die Quoten scheinbar gehalten hat und mit Lob überschüttet wurde, sind die beiden außer sich. Denn mit ihrem "Wahrheitskurs" verärgert News Night vor allem "Tea Party"-Abgeordnete, die in den Interviews regelmäßig vorgeführt werden oder sich selbst vorführen (je nach Lesart). Das aber macht die Zusammenarbeit der Geschäftsfrau Leona Lasing mit dem Kongress schwierig. Es ist also nicht einmal der Profit der Nachrichtenabteilung, die die Sendungsleitung dazu bringt, Druck auf News Night auszuüben, sondern die eigene Lobbykraft.
Diese Entwicklung ist ausgezeichnet. Denn während Will McAvoy, als gemäßigter Republikaner, Probleme damit hat, dass seine Partei durch die "Tea Party"-Bewegung ins Unseriöse gezogen wird, denkt Leona Lasing, als angebliche Demokratin, ausschließlich an ihre Beziehungen und ihren Profit. Bis zu dieser Enthüllung am Ende der Folge hat es den Anschein, als würde "The Newsroom" (berechtigtes?) Republikaner-Bashing betreiben und sich damit nicht von den tendenziösen Nachrichtensendungen, die es kritisiert, unterscheiden. Mit Leona Lasing sind einige Graustufen in die Handlung gekommen.
Leider wird Charlie Skinner dabei immer mehr zum heimlichen Helden der Serie. Sein Charakter ähnelt mittlerweile dem Idealismus des Eingangsstatements. Er hat dafür gesorgt, dass Will mit MacKenzie jemanden als Produzentin hat, die eine wirkliche Nachrichtensendung produzieren möchte. Er unterstützt Will auf diesem Kurs und hier schützt er Will sogar vor der Geschäftsleitung. Dabei stellt sich die Frage, ob Charlie auch einmal an sich und seine Karriere denkt. Etwas Graustufen in seinem Charaktere wären auf jeden Fall hilfreich.
Sowieso sind die Charaktere auch in der dritten Folge noch die größte Schwäche der Serie. Ihre Interaktionen überzeugen nicht. Wills viele Dates und MacKenzies Reaktion darauf wirken albern. Der einzig gelungene Moment, als Will dies erkennt und sich entschuldigen möchte, wird durch eine alberne Racheaktion MacKenzies, sie bringt ihren Freund in den Produktionsraum, zunichte gemacht. Jims verzweifelte Eroberungsversuche gegenüber Maggie wirken ebenfalls entweder albern oder aber zu gekünstelt. Das muss sich ändern. Denn so schön die Handlung um eine Redaktion, die sich bemüht tatsächlich gute Nachrichten zu produzieren, auch ist, letztlich werden Fernsehserien von ihren Charakteren getragen. Bisher ist "The Newsroom" aufgrund der Idee dahinter, nicht wegen der Protgonisten sehenswert.
"The 112th Congress" fügt der Handlung viel Dramatik, in der Form einer ablehnenden Senderleitung, hinzu. Damit entstehen im politischen Spektrum kleine Grautöne, was der Serie ebenfalls gut tut. Während die Charaktere dabei bisher nicht zu überzeugen wissen, sind die Ausschnitte aus Wills Nachrichtensendung genau so spannend und unterhaltsam, wie Charlies Meeting im Hintergrund. Das alle sorgt für gute Unterhaltung.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Raise The Dawn (von David R. George III)
 "Raise The Dawn" knüpft nahtlos an den ereignisreichen, inhaltlich aber nicht brillierenden Vorgänger "Plagues Of Night" an. "Deep Space Nine" ist zerstört, die "Typhon Pact"-Geheimdienste setzen ihre Verschwörung zur Erlangung des Slipstream-Antriebes weiterhin fort. An diese Situation, in der ein Krieg zwischen den Kithomer-Verbündeten und dem Typhon Pact unausweichlich wirkt und das stümperhafte vorgehen des romulanischen Geheimdienst zudem das Dominion erregt, gelingt David R. George ein weiterer ereignisreicher Roman, der eingies besser macht, aber noch immer einige inhaltliche Schwächen aufweist.
"Raise The Dawn" knüpft nahtlos an den ereignisreichen, inhaltlich aber nicht brillierenden Vorgänger "Plagues Of Night" an. "Deep Space Nine" ist zerstört, die "Typhon Pact"-Geheimdienste setzen ihre Verschwörung zur Erlangung des Slipstream-Antriebes weiterhin fort. An diese Situation, in der ein Krieg zwischen den Kithomer-Verbündeten und dem Typhon Pact unausweichlich wirkt und das stümperhafte vorgehen des romulanischen Geheimdienst zudem das Dominion erregt, gelingt David R. George ein weiterer ereignisreicher Roman, der eingies besser macht, aber noch immer einige inhaltliche Schwächen aufweist.Die vollständige Rezension ist auf trekzone nachzulesen:
Star Trek Typhon Pact: Raise The Dawn (von David R. George III)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gesehen: News Night 2.0 (The Newsroom Folge 2)
Die Sondersendung zu der Öl-Katastrophe im Golf von Mexiko war ein großer Erfolg. Alle erwarten, dass die nächste Sendung an dieses Ereignis anknüpfen wird. Die neue Produzentin MacKenzie McHale lehnt dies ab, für sie gibt es keinen Neuigkeitswert. Der Skandal ist bekannt, es bliebe nur noch Populismus. Also konzentriert sie sich auf das gerade verabschiedete Anti-Immigranten-Gesetz aus Arizona. Während sie immer mehr merkt, dass Moderator Will McAvoy, mit dem sie einst zusammen war und den sie betrogen hat, von der Crew als "Arschloch" und "Fremdgeher" gesehen wird, versucht sie, diesen Eindruck zu korrigieren. Damit macht sie alles nur noch schlimmer. Als zu allem Überfluss die republikanische Regierung Arizonas ihre Teilnahme an der Sendung aufgrund eines Anfängerfehlers einer Mitarbeiterin absagt, gerät die abendliche Sendung zu einem Desaster.
Bereits die zweite Sendung der Serie zeigt, was bei dem anspruchsvollen Konzept MacKenzies schief gehen kann. Ruhiger, argumentativer und ausgewogener Journalismus klingt gut. Doch da Journalisten nur berichten, benötigen sie dafür auch die richtigen Quellen. In diesem Fall bleiben dem Team für die Pro-Seite des Immigrantengesetzes nur extreme Bürger der Vereinigten Statten. So muss Will ein Interview mit einer "Miss Arizona"-Kandidatin, einem rassistischen Pseudo-Wissenschaftler und einem Waffennarr führen. Dies gerät natürlich zum Desaster.
Es ist gut, dass diese Gefahr bereits in der zweiten Folge thematisiert wird. Leider tritt diese Haupthandlung stark in den Hintergrund. Wichtiger scheint es den Autoren zu sein, die alte Beziehung zwischen Will und MacKenzie zu erklären. Dabei verhält sich vor allem MacKenzie an vielen Stellen sehr unsouverän. Das ist gewollt. Auch auf ihrem fachlichen Gebiet wird sie häufig naiv inszeniert. Das wird regelmäßig dadurch ausgeglichen, dass sie, wenn es denn darauf ankommt, stark und richtig auftritt. In dieser Episode wirken sie und auch ihre Konzepte aber häufig lächerlich.
So schreibt sie ein pikante Mail, die an Will gehen soll, aus Versehen an die komplette Redaktion. Das wird als zweiter Höhepunkt neben der Sendung in der Episode inszeniert. Dabei ist gerade dieser Moment recht unnötig.
Spannender ist da die Art und Weise wie Redaktionschef Jim Harper mit dem Fehler von Maggie Jordan umgeht. Leider ist der Fehler ähnlich schlecht konstruiert wie die Aufklärung der Beziehung zwischen Will und MacKenzie. Auch hier geht es wieder um eine ehemalige Beziehungsgeschichte. Immerhin wird daraus aber ein guter Einblick in Maggies Charakter hergestellt. Das gelingt bei dem Konflikt zwischen Moderator und Produzentin aber nicht. Jim verhält sich in dieser Situation weitestgehend souverän und überlässt es Maggie, ihren Fehler zu analysieren und damit zu leben. Das wirkt überzeugend.
Am gelungensten ist die Nebenhandlung um Wills Quotengläubigkeit. Er gibt offen zu, dass es für ihn äußerst wichtig ist, von den Menschen gemocht zu werden. Jemand aus der Geschäftsleitung spielt ihm daher regelmäßig die Quoten zu und berät ihn, wie er die Show populärer ausrichten könnte. MacKenzie hat er versprochen, diese Einstellung zu ändern. Doch angesichts des katastrophalen Arizona-Verlaufs entschließt er sich dazu, Sarah Palin in die Show zu holen. MacKenzie hält das für Populismus und stellt daher am Ende der Folge die Vertrauensfrage. Es geht darum, ob Will weiterhin nach Quoten oder nach einer guten Sendung giert. Er entscheidet sich für letzteres, was klar war, da die Serie sonst beendet wäre.
"News Night 2.0" stellt eindrucksvoll die Schwierigkeiten einer guten Nachrichtensendung dar, denn dazu braucht es auch gute Gäste, die nicht immer leicht zu finden sind. Leider wird der Schwerpunkt sehr auf die persönlichen Beziehungen gesetzt. Das hat bei "The West Wing", der ersten Serie von Aaron Sorkin äußerst gut funktioniert. Hier springt aber vor allem bei den beiden Hauptdarstellern der Funke nicht über, MacKenzie wirkt dabei zu intuitiv und zu emotional. Hier besteht ein deutlicher Verbesserungsbedarf. Die gelungeneren Wortspiele zwischen Jim und Maggie lassen jedoch darauf hoffen, dass sich so etwas in den kommenden Episoden auch noch bei den Hauptcharakteren einspielen wird.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Mein Katalonien - Bericht über den Spanischen Bürgerkrieg (von George Orwell)
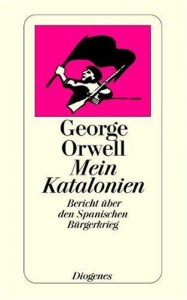 George Orwell beschreibt in dem Buch, wie er sich während des Spanischen Bürgerkrieges von der revolutionären Atmosphäre im republikanischen Katalonien anstecken ließ und der trotzkistischen Miliz beitrat. Das Buch beginnt mit einer begeisterten und schillernden Beschreibung Kataloniens unter der Führung der Arbeiter. Dabei werden Schwachstellen bereits offenbar, doch verblassen sie hinter der Atmosphäre der Gleichheit, die Orwell ausgemacht haben will.
George Orwell beschreibt in dem Buch, wie er sich während des Spanischen Bürgerkrieges von der revolutionären Atmosphäre im republikanischen Katalonien anstecken ließ und der trotzkistischen Miliz beitrat. Das Buch beginnt mit einer begeisterten und schillernden Beschreibung Kataloniens unter der Führung der Arbeiter. Dabei werden Schwachstellen bereits offenbar, doch verblassen sie hinter der Atmosphäre der Gleichheit, die Orwell ausgemacht haben will.Die Begeisterung für diesen Zustand war so stark, dass Orwell begeistert in den Krieg zog. Später macht er jedoch deutlich, dass er auch für eine schlichte, weil kapitalistische Demokratie ins Feld gezogen wäre. Seine Begeisterung wäre zwar begrenzt gewesen, doch der Faschismus musste unbedingt einmal aufgehalten werden. Bekanntlich gelang nicht einmal dieses Ziel.
Orwell unterteilt seine Kapitel strikt in Frontbeschreibungen und Schilderungen der politischen Situation. Damit möchte er es – nach eigener Aussage – dem Leser möglich machen, zwischen dem, was ihn interessiert zu wählen. Es ist aber ganz klar, dass auch die Kampfschilderungen nicht ohne kleine politische Seitenhiebe auskommen.
Was Orwell über die Kampfhandlungen an sich schreibt, ist erschreckend. Es ist nämlich nicht der Schrecken des Krieges, der ihn stört, sondern die Langeweile. Beide Armeen sind während Orwells Frontzeit sehr schlecht ausgerüstet. Kaum ein Schuss trifft und daher nimmt niemand die Kämpfe ernst. Gelegentlich wird zwar jemand getroffen, wirklich irritieren tut das niemanden. Orwells Ton ist dabei selten anklagend, obwohl er jeden Grund dazu hätte. Denn die Ausrüstung seiner Organisation ist genau wie die Ausbildung der Miliz fahrlässig. Mit so einem Rüstzeug kann man niemanden in einen Krieg ziehen lassen. Denn wäre die faschistische Armee nicht ähnlich schlecht ausgestattet gewesen, hätte keiner der trotzkistischen (und zu dem Zeitpunkt auch alle republikanischen) Soldaten keine Chance gehabt. Stattdessen beschreibt Orwell das so, dass es beinahe witzig klingt.
Der Krieg wirkt in Orwells Beschreibung unglaublich banal, beinahe sinnlos. Das ist aber gerade falsch, schließlich ist es ja gerade ein Krieg gewesen, der zwischen einer demokratisch oder kommunistischen und einer faschistischen Ausrichtung des Landes entscheiden sollte. Das macht Orwell immer wieder klar, dennoch sind die Kampfhandlungen, an denen er teilnimmt an Sinnlosigkeit nicht zu überbieten. Er nimmt an keiner einzigen sauber geplanten Offensive teil. Die einzige länger geplante Aktion, geht aufgrund von Planungsfehlern schrecklich schief.
Aber anstatt das Milizsystem anzuklagen, verteidigt Orwell es. Für ihn muss der Soldat auch in der Armee mit allen gleichgestellt sein. Ein hehrer Ansatz, der natürlich von allen anderen Gruppen nicht geteilt wurde. Damit beschäftigt sich der politische Teil. Den vielen Konflikten der demokratischen, liberalen, sozialistischen, kommunistischen, anarchistischen und trotzkistischen Parteien, die auf Seiten der Republikaner zu Beginn Seite an Seite kämpften, ist nur schwer zu folgen. Deutlich wird hier aber, dass die stalinistisch gelenkte kommunistische Partei rasch die Oberhand gewann. Anstatt aber für eine wirkliche Revolution zu sorgen, behinderte diese Partei – nach Orwells Schilderungen – alle Revolutionsbemühungen. Stattdessen arbeitete sie – nach Vorgabe aus der UdSSR eng mit liberalen Kräften zusammen und machte sogar revolutionäre Entwicklungen rückgängig. Das musste auf radikalere Kräfte provozierend wirken, weswegen es innerhalb der Republikaner zu Kämpfen kommt.
Die Beschreibung dieser Kämpfe, die die zweite Hälfte des Berichts ausmachen, strotzen vor Sinnlosigkeit. Anstatt sich gemeinsam auf das faschistische Ziel zu konzentrieren, musste die Oberhand im eigenen Lager gewonnen werden. Es ist klar, dass die Kommunisten, auf deren Seite der einzige große Waffenlieferant der Republikaner, die UdSSR, stand, gewannen. Die anschließenden Säuberungen verleiden Orwell die Lust am Krieg, er sieht keine Chance mehr auf einen guten Ausgang für die Arbeiter. Nach dem Sieg der Kommunisten ist in seinen Augen die positivste Ausgangsmöglichkeit eine Verhinderung des Faschismus durch eine autoritäre Demokratie. Seine Verwundung kommt im daher gerade recht.
Besonders beachtlich ist in der politischen Beschreibung, dass Orwell stark auf die Propaganda eingeht. Er selbst stellt klar, dass sein Bericht keineswegs objektiv ist und es auch nicht sein kann. Seitenlang zerlegt er – was teilweise etwas langatmig zu lesen ist – Zeitungsartikel aus verschiedenen kommunistischen Zeitungen Spaniens und Großbritanniens. Oft schildert er Ereignisse in Spanien, dann wie sie in der spanischen kommunistischen Presse aufgenommen wurden und letztlich wie die britische sozialistische und kommunistische Presse sie verarbeitet hat. Der Veränderungsprozess ist weitreichend und der Bericht macht damit deutlich, wie bereits während des Spanischen Bürgerkriegs die Weltöffentlichkeit mit Zeitungspropaganda gelenkt wurde, um bestimmte Strömungen, wie zum Beispiel den Trotzkismus, zu diskreditieren und ihrer Unterstützung zu berauben. Das ist eindrucksvoll und ist wohl bereits der erste Grundstein für Orwells „1984“-Dystopie.
Orwells Bericht über den Spanischen Bürgerkrieg ist sehr subjektiv. Bei der Lektüre des teilweise langatmigen Textes wird aber deutlich, wie gruselig die meisten Soldaten im Spanischen Bürgerkrieg ausgerüstet waren, wie sinnlos die meisten republikanischen Konflikte waren und – relativ überraschend – wie bürgerlich, rechts und kapitalfreundlich die stalinistischen Kommunisten agierten. Über all dem schwebt die lenkende Propaganda, die es für den einfachen Soldaten, fast unmöglich gemacht haben muss, die Wahrheit zu erkennen. Stattdessen war er (bzw. seine Organisation) von Lüge und Intrige umgeben und es konnte gut sein, dass er von der Front zurückkehrte und verhaftet wurde – bloß weil er Mitglied der falschen Miliz war. Das wird zwar nicht besonders anklagend, sondern in einem bemüht sachlichen Ton berichtet, ist aber trotzdem erschütternd.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gesehen: Die Dreigroschenoper (im Berliner Ensemble)
 Die Dreigroschenoper wurde vor 74 Jahren am Theater am Schiffbauerdamm aufgeführt. Heute residiert dort das Berliner Ensemble. Seit 2006 wird dort die hier rezensierte Inszenierung des Stückes aufgeführt.
Die Dreigroschenoper wurde vor 74 Jahren am Theater am Schiffbauerdamm aufgeführt. Heute residiert dort das Berliner Ensemble. Seit 2006 wird dort die hier rezensierte Inszenierung des Stückes aufgeführt.In dieser Dreigroschenoper-Inszenierung sind alle Schauspieler weiß überschminkt, sie wirken dadurch etwas puppenhaft, auf jeden Fall aber verfremdet. Denn Gefühlsregungen sind entweder gar nicht oder aber in übertriebenem Ausmaß zu erkennen. Damit nimmt natürlich die Bedeutung der Körperbewegungen der Schauspieler zu. Es ist angesichts der Mimik nicht verwunderlich, dass auch die Bewegungen ins übertriebene gesteigert sind. Vom hoppelnden Verbrecher bis zur tippelnden Polly sorgen die Bewegungen meist für ein Schmunzeln. Mit der präsentierten Entfremdung dürfte die Inszenierung aber einige Elemente von Brechts - später entwickelter - Theorie des epischen Theaters umsetzen.
Trotz der Verfremdung sind alle Schauspieler "normal" gekleidet. Wie es sich für das victorianische London wohl gehörte treten die Herren im Anzug auf, die Frauen entweder im Hosenanzug oder aber in Kleidern. Farbe gibt es dabei keine. Nur Maceath fällt aus diesem Schema. Seine Kleidung, zumindest aber seine Unterwäsche, ähnelt eher Damenbekleidung. Er macht einen äußerst androgynen Eindruck.
Die Hauptsache des Stückes, die kritischen, lustigen und bewegenden Lieder, wirken exellent. Das Orchester setzt die Lieder gekonnt um und die Schauspieler singen weitestgehend sehr gut, schaffen häufig auch die hohen Tonlagen. Dabei werden für die Zwischenszenen beim Bühnenumbau immer wieder die Grundthemen einzelner Stücke genommen und ohne Gesang ausgebaut. So kommt der Zuschauer nicht nur während des "Kanonensong" in den Genuss des Liedthemas sondern auch in einer Zwischenszene, in der der Polizeipräsident Brown über die Bühne wandert.
Die Finale der Akte sind sehr gute herausgearbeitet. Sowohl die Ballade über die Unsicherheit menschlicher Verhältnisse als auch die Ballade über die Frage, wovon lebt der Mensch wirken eindrucksvoll und bleiben im Gedächtnis hängen. Das weniger prägnante, weil unrealistische Endfinale wirkt vor allem wegen des dann zur Schau gestellten Prunkes.
Die Bühne ist nie leer. Auch wurde von einem einheitlichen Aufbau abgesehen. Stattdessen wird eine Mischung aus Symbolik und Requisite angewandt. Der Galgen im Finale ist als solcher deutlich zu erkennen. Auch die Arrestzelle hat dicke Gefängnisstäbe. Hier beginnt aber bereits der Übergang zur Symbolik. Denn dieses Stabmotiv wird in kleinerem Maßstab an anderer Stelle verwendet. Bei dem Bettlerkönig Peachum werden kleine Gitterelemente, die mal leuchten und mal nicht angewandt. Ein deutliches Symbol dafür, dass die Peachums nicht in der Lage sind, über ihren Pragmatismus hinaus zu denken.
Die Inszenierung kann den Zuschauer mit den grandiosen Liedern begeistern. Auch sonst ist ist sie inhaltlich nahe am Original. Zusätzlich sorgen die Entfremdungseffekte mal für Nachdenken über die gewählten Gesten mal aber auch einfach für Lacher. "Die Dreigroschenoper" am Theater am Schiffbauerdamm sorgt für einen unterhaltsamen Abend, bei dem aber auch die von Brecht gewollte Kritik an gesellschaftlichen Verhältnissen nicht zu kurz kommt.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gehört: Beautiful (von Rosenstolz)
 Das letzte Lied des Rosenstolz-Albums "Wir sind am Leben" ist lang und überzeugend. Das Lied greift eine Situation der Trauer und Einsamkeit auf und verbindet diese mit der Hoffnung und Bitte an jemanden, diese Situation zu lösen. Dabei werden überzogene Erwartungen formuliert, die in dem Satz "Make it beautiful now" münden.
Das letzte Lied des Rosenstolz-Albums "Wir sind am Leben" ist lang und überzeugend. Das Lied greift eine Situation der Trauer und Einsamkeit auf und verbindet diese mit der Hoffnung und Bitte an jemanden, diese Situation zu lösen. Dabei werden überzogene Erwartungen formuliert, die in dem Satz "Make it beautiful now" münden."Beautiful" beginnt mit leichten Klavierklängen, die den Gesang in der ersten Strophe und im Refrain betonen. In der zweiten Strophe treten Bässe dazu, die sich zum Refrain hin steigern. Die ganze Zeit über erklingen sehr dezente Streicher im Hintergrund, die nach dem zweiten Refrain in den Vordergrund treten, die dritte Wiederholung des Refrains über weiter gespielt werden und am Ende während der mehrfachen Wiederholung der Zeile make it beautiful now sehr laut erklingen.
Das Lied besteht aus zwei Strophen. In der ersten Strophe wird die verlorene und orientierungslose Situation thematisiert. Viel zu lange war ich fort, find nicht mehr nach Haus, fasst die Botschaft am Ende der Strophe zusammen. Die zweite Strophe wiederholt betont die Einsamkeit der vorherigen Situation (große Sehnsucht, große Stadt), bringt aber zusätzlich noch eine gescheiterte Beziehung in die Handlung, Traum von Liebe ist geplatzt. Dem schließt aber gleich danach die erwünschte und erhoffte Rettung an: Herz verloren, unbewacht, bringst Du mich nach Haus. Bereits im Liedtext ist also darauf hingewiesen, dass es eine andere Person braucht, um die Situation zu durchbrechen.
An dieser Person wird im Refrain appelliert. Bei ihr wird nach Bestätigung für Sicherheit (Sag, dass Du heut bei mir bleibst), Hilfe (meine Wunden wieder heilst), Zuversicht (Küss die Angst aus meinem Gesicht, leuchte heute nur für mich) gesucht. Vor allem aber sollen die Einsamkeit und die Orientierungslosigkeit durchbrochen werden (Lass mich nicht mehr alleine hier, bring mich nach Haus). Das sind sehr hohe Erwartungen. Es ist aber in einer traurigen und etwas verzweifelten Situation die größte Hoffnung: Dass es jemanden gibt oder geben wird, der einen von der Lage ablenkt und neue Zuversicht gibt. Dann fällt es schnell leicht, diese großen Erwartungen zu erfüllen.
Ein Zwischenspiel vor der dritten Wiederholung des Refrains ist eine Erklärung des Ziels (bring mich nach Haus). Es ist eine kleine Ode an die Sicherheit und das Wohlbefinden, dass eine lokale oder aber nur geistige Heimat bietet. Dort läuft die Zeit anders als in der Fremde (Wo die Zeit nicht so schnell rennt), dort tritt man selbstsicherer und wahrhaftiger auf (Wo ich sein kann, was ich bin, Wo die Angst mich nicht regiert) und zuletzt erfühlt man dort Sicherheit und Orientierung (Wo ich mich nicht mehr verlier). Das Zwischenspiel macht aber auch sehr deutlich, dass dieser Zustand an dem derzeitigen Ort in der derzeitigen Lage nicht erreicht werden kann: Bring mich weg, bring mich fort von hier.
An die dritte Refrain-Wiederholung schließt sich dann, gesungen von einem australischen Sänger, die titelgebende Zeile an: Make it beautiful now. Das ist eine unglaublich übertriebene Erwartung. Schließlich kann nicht eine einzelne Person alle Probleme, alle Schwierigkeiten, die man mit sich herum schleppt wieder richten und "schön" machen. Das ist aber auch nicht die Aussage des Liedes.
Stattdessen vermittelt es tatsächlich mit den Strophen und der Melodie den Eindruck einer traurigen, melancholischen Situation. Es macht aber deutlich, dass es daraus einen Ausweg gibt. Das ist der "leidenden" Person durchaus bewusst. Die externe, angesprochene Person macht also keineswegs alles wieder "schön". Stattdessen wird sie dafür benötigt, den Ausweg, der aus eigener Kraft nicht erkennbar ist, aufzuzeigen. Das geht vor allem durch die im Refrain erbetene Nähe.
"Beautiful" ist auf diese Weise tatsächlich ein sehr schönes Lied. Es wird nicht nur von einer angenehmen Melodie getragen, sondern bringt den Hörer von einer melancholischen in eine äußerst zuversichtliche Stimmung. Gerade die Streicher zum Schluss erwecken tatsächlich den Eindruck einer sich aufklärenden Lage, die durch jedes "beautiful" ein Stück besser ist. Gleichzeitig bedient das Lied die in einer traurigen, einsamen Situation immer angelegte Sehnsucht nach einer helfenden Person.
Das Album "Wir sind am Leben" wird, nach vielen Liedern, die die eigene Lebensführung hinterfragen sollen, mit einem zuletzt sehr zuversichtlichen Lied abgerundet. Gleichzeitig ist "Beautiful" auch das stärkste und beste Lied des Albums.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
"Star Trek"-Romane im Juli
m-dis | 02. Juli 12 | Topic 'Geschrieben'
Auch für den Juli habe ich auf Trekzone eine kleine Übersicht über die erscheinenden "Star Trek"-Romane und Comics erstellt. In diesem Juli wird in Deutschland die Serie "Vanguard" mit "Sturm auf den Himmel" beendet, während die Mini-Serie "Welten von Deep Space Nine" mit "Cardassia - Die Lotusblume" beginnt. In Amerika wird die "Titan"-Serie mit "Falling Gods" fortgesetzt und es erscheint ein neuer Comic-Sammelband.
Die komplette Übersicht ist auf Trekzone zu finden:
"Star Trek"-Romane im Juli
Die komplette Übersicht ist auf Trekzone zu finden:
"Star Trek"-Romane im Juli
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Vor dem Sturm (von Theodor Fontante
 Weihnachten 1812, die französische Armee wurde in Russland vernichtend geschlagen. In der Mark Brandenburg versucht der alte Junker Berndt Vitzewitz eine preußische Armee gegen Napoleon aufzustellen. Noch stößt er damit auf Zurückhaltung und Widerstand. Sein romantischer, unpolitischer Sohn Lewin macht sich zu alledem keine Gedanken. Für ihn und seine Schwester Renate geht es vor dieser dramatischen Kulisse eher darum, die wahre Liebe zu finden. Kritisch wird es für Lewin erst, als sein Vater Erfolg hat und er sich im Landsturm wiederfindet.
Weihnachten 1812, die französische Armee wurde in Russland vernichtend geschlagen. In der Mark Brandenburg versucht der alte Junker Berndt Vitzewitz eine preußische Armee gegen Napoleon aufzustellen. Noch stößt er damit auf Zurückhaltung und Widerstand. Sein romantischer, unpolitischer Sohn Lewin macht sich zu alledem keine Gedanken. Für ihn und seine Schwester Renate geht es vor dieser dramatischen Kulisse eher darum, die wahre Liebe zu finden. Kritisch wird es für Lewin erst, als sein Vater Erfolg hat und er sich im Landsturm wiederfindet.Für seinen ersten großen Roman hat sich Theodor Fontane eine dramatische Kulisse ausgesucht. Preußen ist zwar formal noch selbständig, wird militärisch aber von Frankreich dominierst. Der Leser weiß, dass sich das kurz nach dem gescheiterten Russland-Feldzug Napoleons ändern wird. Der Titel „Vor dem Sturm“ ist aber wörtlich zu nehmen. Berndt Vitzewitz, dem die französische Vorherrschaft seit langem ein Dorn im Auge ist, bemüht sich vor allen anderen darum, einen Landsturm aufzustellen. So schlagen die Dörfer um Vitzewitz bereits zu, als sich alle anderen preußischen Gegenden noch ruhig und loyal präsentieren. Der ganzen Bewegung ist ein Erfolg beschieden. Da Vitzewitz so früh los schlägt, ist der Erfolg von dessen erstem Angriffsplan nicht abzusehbar. Das ist das einzige spannungsbringende Element des Romans.
Denn Theodor Fontan schrieb bekanntlich nicht der Spannung wegen. Die Handlung könnte in wenigen Sätzen zusammengefasst werden. Die dtv-Ausgabe besteht aus etwa 700 Seiten Text mit zusätzlichen 200 Seiten Anmerkungen. Erst nach 600 Seiten hat sich der Landsturm formiert und es kommt zum Überfall auf eine französische Garnison. Bis dahin wird in endlosen Runden über die politische Situation und vor allem über aktuellen Klatsch und Tratsch diskutiert.
Das ist einmal mehr überraschend fesselnd. Fontane charakterisiert eine Vielzahl von Personen, häufig seitenlang. Außerdem beschreibt er den historischen Hintergrund vieler Orte, Dörfer und Schlösser. Auch hierfür gestattet er sich meist ein ganzes Kapitel. Dadurch erschafft er eine sehr lebendige märkische Landschaft in dem Roman, zu der die behäbige Erzählweise wirklich zu passen scheint.
Es ist daher das Beeindruckendste an dem Roman, dass man das Gefühl hat, die Denk- und Handlungsweise einer vor 200 Jahren lebenden Gesellschaft spüren zu können. Natürlich konzentriert sich Fontane dabei auf die Adligen, doch auch Pastoren, Schulzen und Bauern finden in einigen Kapiteln Beachtung. Obwohl viele Charaktere für die eigentliche Handlung nur Nebenrollen sind, wird ihr Hintergrund in etwa so umfangreich ausgebreitet, wie der der Hauptpersonen. Dadurch entsteht ein abgerundetes Bild des gesellschaftlichen Aufbaus zu der Zeit.
Die Liebe spielt selbstverständlich ebenfalls eine Rolle in dem Roman. Hier zeichnet sich bereits ab, dass die „alten“ Werte nicht mehr aufrecht erhalten werden können. Denn während Berndt Vitzewitz mit einem polnischen Adligen bereits Heiratspläne für die gemeinsamen Kinder schmieden, entwickelt sich im Lauf des Romans in dieser Hinsicht alles überraschend anders.
Häufig erschafft Fontane bei seinen Schilderungen eindrucksvolle Bilder. Wenn Lewin nachts durch die Straßen seiner Universitätsstadt wandert, von unerfüllter Liebe getrieben und ihm kommt die geschlagene französische Armee entgegen, die sich durch die eisige Kälte Russlands nach Preußen vorgearbeitet hat, ist das ein starkes Bild, das durch die Sprachgewalt Fontanes sehr berührend ist. Vor allem wenn man bedenkt, dass Lewins Vater bereits daran arbeitet, die leidenden Überlebenden zu vernichten. Diese Doppeldeutigkeit, die sich zu dem sonst zur Schau getragenen Patriotismus gesellt, tut dem Roman gut.
„Vor dem Sturm“ ist ein langer, behäbiger und anstrengender Roman, der nur wenig Handlung bietet. Dafür erlebt der Leser eine eindringliche, wortgewaltige Schilderung der märkischen Adels- und Bauernwelt kurz vor den Befreiungskriegen, mit teilweise beeindruckenden Bildern.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Der stählerne Stern

 "Der stählerne Stern" ist der zweite durchschnittliche Roman des "Andromeda"-Zyklus. Die Sternenfaust fliegt einen Planeten an, diesmal aber nicht, weil sie dort ein Akoluthorum vermutet, sondern um frische Lebensmittel mitzunehmen und damit die Moral der Crew zu steigern. Doch - oh Zufall - es gibt dort ein Akoluthorum. Der Leser weiß dies leider deutlich vor der Sternenfaust-Besatzung, was die Spannung etwas mindert. Am Ende werden noch einige Tenebrikoner verkloppt und die spannendste Fragestellung des Romans gekonnt ignoriert. Das hätte besser laufen können.
"Der stählerne Stern" ist der zweite durchschnittliche Roman des "Andromeda"-Zyklus. Die Sternenfaust fliegt einen Planeten an, diesmal aber nicht, weil sie dort ein Akoluthorum vermutet, sondern um frische Lebensmittel mitzunehmen und damit die Moral der Crew zu steigern. Doch - oh Zufall - es gibt dort ein Akoluthorum. Der Leser weiß dies leider deutlich vor der Sternenfaust-Besatzung, was die Spannung etwas mindert. Am Ende werden noch einige Tenebrikoner verkloppt und die spannendste Fragestellung des Romans gekonnt ignoriert. Das hätte besser laufen können.Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Sternenfaust Band 193 - Der stählerne Stern (von Guido Seifert)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
We Just Decided To (The Newsroom Folge 1)
Will McAcoy ist der Leiter und Sprecher der Nachrichtensendung News Night. Seine Sendung erreicht gute Quoten, vor allem weil Will sich mit seiner Meinung zurückhält und es allen recht macht. Bei einer Podiumsdiskussion mit Studenten sieht er eine Ex-Freundin, die ihm Botschaften hochhält. In der für ihn ermüdenden Diskussion, in der neben ihm eine Demokratin und ein Republikaner teilnehmen und heftig streiten, bringt ihn das zu einem kleinen Wutausbruch. Auf die Frage einer Studentin, warum Amerika das beste Land der Welt ist (was die anderen Diskussionsteilnehmer mit Phrasen beantworten), erklärt er ihr, warum Amerika das nicht ist.
Das bringt für seine Sendung natürlich einige Probleme mit sich. Es stellt sich zudem heraus, dass Will ein schlechter Arbeitgeber ist und seine Mitarbeiter stiefmütterlich behandelt. Ein Großteil wechselt daher bei der nächstbesten Möglichkeit zu anderen Sitzungen.
Der einstündige Pilotfilm kommt in Fahrt als MacKenzie McHale - wie sich später herausstellt, die Ex-Freundin aus dem Publikum - als neue Redaktionsleiterin von der Firmenleitung eingestellt wird. Will ist darüber nicht begeistert, versucht das sogar zu verhindern. MacKenzie erhält aber die Chance, ihren Plan einer wirklichen, seriösen und doch akzentsetzenden Nachrichtensendung in die Tat umzusetzen. Sie erhält die Chance als einer ihrer Mitarbeiter, gegen den Widerstand von Wills bisherigen Redakteuren, erkennt, dass die DeepWater Katastrophe im Golf von Mexiko tatsächlich eine Katastrophe ist und das Material für eine einstündige Nachrichtensendung bietet.
Binnen kürzester Zeit gelingt dem Team eine wegweisende Sendung, die die Debatte über die Katastrophe überhaupt erst startet.
Mitten in die aufgeheizte Stimmung in Amerika platzt die Serie "THe Newsroom" von "West Wing"-Erfinder Aaron Sorkin. Der Hauptcharakter, Will McAcoy, hat eine starke Abneigung gegen das ideologische Phrasendreschen der Anhänger der beiden großen Parteien Amerikas. An diesen Diskussionen kann er sich seines Rufes wegen nicht beteiligen und er will es auch nicht da sie ihm, wie die Startsequenz zeigt, schlicht zu verblendet sind.
Er ist jedoch kein reiner Sympathieträger. Seine Angestellten und Mitarbeiter beachtet er kaum. Zu Beginn fällt ihm nicht einmal auf, dass seine Redaktion leer ist, weil beinahe sein komplettes Team zu einer anderen Nachrichtensendung der Firma gewechselt ist. Außerdem ist er, zumindest in dieser Episode, kein Idealist.
Als MacKenzy ihm nämlich ihre Pläne für eine seriöse Nachrichtensendung, wie es sie in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht mehr erfolgreich gibt, präsentiert, verweist er sie auf viele Studien, die zeigen, dass so ein Konzept gar nicht erfolgreich sein kann. Entweder seichte, anbiedernde Unterhaltung ist gefragt, oder aber eine stark tendenziöse Berichterstattung. Da er letzteres nicht leisten wolle, müsse er sich auf ersteres konzentrieren.
Trotz dieser Pessimismus und der unsympathischen Ader beweist er den richtigen "Riecher" als er MacKenzies Produzenten anhört und seinen Vorschlag die Ölkatastrophe im Golf von Mexiko als Sonderthema zu nehmen.Die Hauptperson ist also mit einer unsympathischen Seite ausgestattet, gleichzeitig aber talentiert und von der polarisierten Stimmung sichtlich genervt. Gleichzeitig ist Will noch immer sehr beliebt und aufgrund seiner bisherigen Arbeitsweise wird er als sehr seriös empfunden. Mit einer seriösen, aber kontroversen Sendung könnte er theoretisch also Erfolg haben.
Der Ansatz der Sendung ist dabei zu loben. In Zeiten, in denen - nicht nur in Amerika - seriöse Berichterstattung schlicht nicht mehr erfolgreich ist, sondern tendenziöse, eindeutig ideologisch gefärbte Nachrichten am ehesten noch Erfolg haben, ist ein Plädoyer für "guten" Journalismus in Form einer Serie ein mutiges Unterfangen. Denn warum sollte das Plädoyer für ein zur Zeit unerfolgreiches Nachrichtenkonzept erfolgreicher sein als das ungefragte Original?
Mutig sind auch die langen Dialoge über ein recht begrenztes Thema. Nach dem durchaus unterhaltsamen Einstieg, dreht sich die erste halbe Stunde alles um Wills Sendung und die Übernahme durch MacKenzie als Executive Producer. Die zweite Hälfte der Folge ist dann das Bestreiten der Sendung selbst. Das ist wenig Handlung mit vielen Dialogen. Diese Dialoge sind aber bei weitem nicht so spritzig wie sie noch in Sorkins erster Serie "The West Wing" waren.Das ist gefährlich, denn die sprachliche Gewandheit, die vielen Witze und der Sarkasmus, der oft nah am Zynismus war, machte "The West Wing" trotz des Anspruchs und der Dialoglastigkeit zu einer erfolgreichen Serie. Nur mit Anspruch und Dialoglastigkeit ist schwer vorzustellen, dass die Serie ein breites Publikum erreicht.
Dieses Ziel wird auch dadurch erschwert, dass wenig Spannung in der Episode aufkommt. Die große Frage ist für den Zuschauer nämlich, ob die Sendung gelingt. Dabei könnte die Kernfrage lauten, ob das Thema richtig gesetzt ist. Da ein reales Ereignis, das zwei Jahre zurückliegt, gewählt wurde, weiß der Zuschauer, dass das Team auf die richtige Seite gesetzt hat. Ein fiktives Ereignis hätte zwar erst einmal genauer beschrieben werden müssen, hätte aber auch die Spannung vergrößert.
Daher bleibt abzuwarten, ob sich auch die folgenden Episoden an realen Ereignissen orientieren werden. Die Serie kann von dieser Folge zur nächsten schwerlich einen Zeitsprung von zwei Jahren machen. Es ist somit zu erwarten, dass die Sendung zumindest erst einmal im Jahr 2010 weitermachen wird. Weitere reale Ereignisse aus der Zeit sind also nicht ausgeschlossen.
"We Just Decided To" ist ein Pilotfilm, der gut in das Setting der Serie einführt. Es geht um eine Nachrichtensendung, mit einem erfolgreichen aber desillusionierten Moderator. Sie wird von einer Frau übernommen, die sehr idealistisch ist, als Kriegsreporterin viel erlebt hat und das Profil der Sendung radikal verändern will. Die Beziehung zwischen Moderator und Executive Producer bietet noch einiges Potential. Auch die bereits eingeführten Redakteure deuten interessante Charakterstränge an.
Die Sendung zeigt dabei in der Grundhandlung von großer Sehnsucht nach dem "guten", dem "seriösen" und doch "kontroversen" Journalismus. Lebte "The West Wing" während der Bush-Jahre vor wie amerikanische Politik auch aussehen könnte, bietet "The Newsroom" die Chance eine fiktiven Alternative zu dem immer populistischeren und gleichzeitig doch unerfolgreicheren US-Journalismus zu zeigen. Der dabei gelegentlich etwas kitschig wirkende Idealismus, der dabei zutage tritt, ist zumindest in der ersten Episode zu ertragen.
Insofern ist es "The Newsroom" der Erfolg sehr zu wünschen. Es könnte, gerade jetzt im Wahlkampf, nicht schaden, wenn in den Staaten ein erfolgreiches Serienplädoyer für weltanschaulich neutralen aber doch kontroversen Journalismus läuft. Und es würde vielen anderen Ländern, unter anderem auch Deutschland, nicht schaden, wenn dieses Plädoyer auch dort erfolgreich wäre. Die erste Folge mag zwar nicht spannend sein, aber sie unterhält durch kluge, lange, aber nicht langweilige, Dialoge und die Einblicke in die Herstellung einer Nachrichtensendung. Nach dem Sehen freut man sich nicht nur auf die nächste Episode, sondern verspürt Sehnsucht und das Bedürfnis nach guten Journalismus.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Das befremdliche Überleben des Neoliberalismus (von Colin Crouch)
 Die internationale Finanzkrise führt uns seit 2008 vor, welche Auswüchse neoliberale Wirtschaftspolitik treiben kann. Mittlerweile ist es zwar vielen (neoliberalen) Ökonomen gelungen, den Fokus auf die Staatsverschuldungskrise zu lenken. Doch kann dabei nicht ignoriert werden, dass die enormen Auswüchse dieses Problems in erster Linie durch die Rettung der 2008 gescheiterten Banken hervorgerufen wurden.
Die internationale Finanzkrise führt uns seit 2008 vor, welche Auswüchse neoliberale Wirtschaftspolitik treiben kann. Mittlerweile ist es zwar vielen (neoliberalen) Ökonomen gelungen, den Fokus auf die Staatsverschuldungskrise zu lenken. Doch kann dabei nicht ignoriert werden, dass die enormen Auswüchse dieses Problems in erster Linie durch die Rettung der 2008 gescheiterten Banken hervorgerufen wurden.Colin Crouch befasst sich in seinem Buch, was er in Anspielung auf sein bekanntestes Werk mit „Postdemokratie II“ untertitelt, mit der Frage, warum der Neoliberalismus nicht im Rahmen der Finanzkrise 2008 untergegangen ist. Das Fazit ist ernüchternd und wird bereits in der Einleitung benannt: Weil es zur Zeit keine vernünftige, umsetzbare Alternative gibt.
Crouch verwendet den Großteil des Buches darauf, seine Sicht der Entstehungsgeschichte des Neoliberalismus zu schildern. Dabei holt er weit aus, fasst den historischen Konsens der Wirtschaft und der Arbeiterklasse im Zeitalter des Keynsianismus zusammen und beschreibt, wie dieser aufgrund der schwächer werdenden Arbeiterklasse ersetzt werden konnte. Dabei verschweigt Crouch auch kritische Aspekte am Keynsianismus nicht und arbeitet sogar positive Elemente der neoliberalen Theorie heraus.
Seine Grundthese ist jedoch, dass der Neoliberalismus nur wenig mit Liberalismus zu tun hat, da der Konflikt zwischen Markt und Staat lediglich vorgeschoben sei. Während neoliberale Theoretiker immer wieder betonen, sie würden den freien Markt fördern, unterstützen sie in Wirklichkeit lediglich große Konzerne, die den freien Markt und regulierenden Wettbewerb verhindern. Viele Maßnahmen, vor allem Privatisierungen, unterstützten einseitig große Konzerne. Diese gelangten dadurch in Schlüsselpositionen, in denen sie nicht mehr vom Markt verschwinden können, ohne dass dieser zusammenbrechen würde. Das wurde von Neoliberalen willig in Kauf genommen, obwohl es der eigenen Theorie entgegenlief. Da es aber wichtiger erschien, den Staat schnell zu entmachten, schien es legitim.
Um diese These herum, geht Crouch in Kapiteln auf das Verhältnis zwischen Wirtschaft und Staat, auf die Finanzierung neoliberaler Politik durch privaten Keynsianismus, also die Verschuldung der privaten Haushalte und zuletzt auf die Strategie großer Konzerne sich mittels „Corporate Social Responsibility“-Strategien auch als politische Akteure zu betätigen, ein.
Nach diesen interessanten Erläuterungen beginnt Crouch mit seinen Ratschlägen.Sein Buch, das stellt er von Anfang an fest, richtet sich an diejenigen, die das System pragmatisch verändern wollen. Crouch ist kein Revolutionsromantiker. Das wird vor allem in den Abschnitten deutlich, in dem er (wahre) sozialdemokratische Politik und den keynsianischen Kompromiss beschreibt. Dabei führt er nämlich immer an, dass diese Politik daran zugrunde ging, dass die sie tragende Klasse zerbröckelte. Eine Wende kann also nur gelingen, wenn sie von einer deutlichen gesellschaftlichen Mehrheit getragen wird, die zur Zeit nicht absehbar beziehungsweise organisierbar ist.
Sein Fazit weist in erster Linie darauf hin, wie im neoliberalen System kleine Veränderungen möglich sind. Dabei stimmt positiv, dass Neoliberale in keinem westlichen Land ganz erfolgreich waren und es noch immer Gesellschaftsbereiche gibt, die wirtschaftlichen Einflüssen relativ entzogen sind. Während es in Amerika die Post ist, in Großbritannien (bis jetzt) der öffentliche Gesundheitssektor, ist es hierzulande das staatliche Bildungswesen. Verhindert wurde der Siegeszug dabei dadurch, dass die jeweiligen Sektoren der Bevölkerung zu wichtig waren und/oder sich zivilgesellschaftliche Gruppen für ihren Erhalt ausgesprochen haben. Crouch plädiert dafür, das Dreigespann Staat-Markt-Konzerne durch eine vierte Kraft zu ersetzen. Denn er arbeitet ebenfalls heraus, dass der Staat allein, wie viele Linke fordern, nicht die Lösung sein kann. Als viertes müsste ein aktive, selbstbewusste Zivilgesellschaft, zu der er neben Bürgerinitiativen auch Vereine, Kirchen, Parteien, Berufsverbände und ehrenamtlich aktive Bürger zählt, die Auswüchse der ersten drei Akteure kontrollieren. Das erscheint schwierig, in vielen Fällen unwahrscheinlich. Doch es motiviert angesichts eines ungerechten, in vielen Punkten derzeit aber nicht zu ändernden Systems dazu, wachsam, nachdenklich und aktiv zu bleiben.
Das Buch ist - noch - günstig über die Bundeszentrale für politische Bildung zu beziehen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
... ältere Einträge
