Gelesen: The Canterville Ghost (von Oscar Wilde)
 Kurz vor meiner mündlichen Abiturprüfung hatte ich das Gefühl, mich noch einmal beruhigen zu müssen. Wie bereitet man sich besser auf eine Englisch-Prüfung vor als ein Buch zu lesen?
Kurz vor meiner mündlichen Abiturprüfung hatte ich das Gefühl, mich noch einmal beruhigen zu müssen. Wie bereitet man sich besser auf eine Englisch-Prüfung vor als ein Buch zu lesen?Also wählte ich "The Canterville Ghost" von Oscar Wilde. Die Geschichte ist relativ simpel. Die Familie eines amerikanischen Gesandten zieht in ein britisches Schloss ein. Dort spukt ein Geist, der sich allerdings an der materialistisch orientierten, amerikanischen Familie die Zähne ausbeist und beinahe in den Wahnsinn getrieben wird. Zum Ende hin wird er von der gutherzigen Tochter des Gesandten erlöst.
Die Geschichte ist simpel und abstrus zugleich. Denn zu keinem Zeitpunkt wird die Existenz des Geistes wirklich in Frage gestellt. Nur kurze Zeit zweifelt die amerikanische Familie, der Erzähler geht immer von der Existenz des Übersinnlichen aus.
Der Geist wiederum sieht sich als Künstler. Immer wieder erinnert er sich an Verkleidungen, mit denen er Menschen erschreckt hat. Das ist zu Beginn noch sehr amüsant, wird bis zum Schluss aber zu häufig wiederholt.
Auch sonst enthält die "hylo-idealistic romance" einige gute Einfälle. Interessanterweise war mir der Inhalt schon komplett durch ein "Donald Duck"-Comic mit derselben Geschichte bekannt. Inhaltlich hätte ich mir das Buch also durch meine Jugendcomiclektüre sparen können. Da soll noch einmal jemand sagen, dass Disney-Comics nichts zur Allgemeinbildung beitrügen.
Putzig ist natürlich, dass Oskar Wilde schon am Ende des 19. Jahrhunderts die Amerikaner als besonders materialistisch erkannt hat. "The Canterville Ghost" zeigt aber ja auch, dass die Amerikaner mit ihrer Ruhe und dem Glauben an die eigene Kraft das "alte Europa" hinter sich lassen. Da hilft auch kein Geist dagegen.
Die Geschichte war sprachlich beinahe ein wenig einfach und eignete sich prima, um an einem sonnigen Tag vor der letzten Abiturprüfung eine Stunde im Garten zu verbringen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Next (von Michael Crichton)
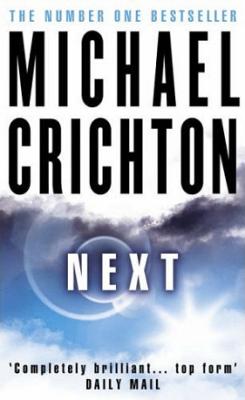 "Next" ist ein recht kleinteiliger Roman. Er schildert aus der Sicht vieler Charaktere eine Welt, die von Gentechnik bestimmt wird. Dabei hat man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass an Gentechnik geforscht wird, um Menschen zu helfen. Stattdessen wird um Forschungsgelder, Markanteile und Patente gekämft.
"Next" ist ein recht kleinteiliger Roman. Er schildert aus der Sicht vieler Charaktere eine Welt, die von Gentechnik bestimmt wird. Dabei hat man zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass an Gentechnik geforscht wird, um Menschen zu helfen. Stattdessen wird um Forschungsgelder, Markanteile und Patente gekämft.Der Autor orientiert sich dabei durchaus an den Möglichkeiten der heutigen Forschung. Zwar gibt es durchaus Elemente, die heute (noch) unrealistisch sind. So kommen sowohl ein sprechender Papagei als auch ein sprechender Affe in dem Roman vor. Trotz der sprechenden Tiere wirkt alles in dem Roman aber erschreckend realistisch. Es wäre durchaus möglich, dass hinter den Kulissen so viel abgeht, wie in "Next" beschrieben.
"Next" zeigt sowohl die Skruppellosigkeit vieler Forscher als auch deren Einsicht, wenn sie merken, dass etwas schief gelaufen ist. Der "Erfinder" des - bereits erwähnten - sprechenden Affens entdeckt zum Beispiel auf einmal sein Herz und bietet dem Wesen einen Wohnplatz.
Die vielen Personen in dem Roman sind sowohl Vorteil als auch Nachteil. Kurze Kapitel erhöhen die Lesegeschwindigkeit und sorgen in der Regel dafür, dass man immer mal wieder nebenbei liest. Außerdem gibt es mit vielen verschiedenen Personen auch viele offene Handlungsstränge und die permanente Frage, wie das alles zusammenführen soll.
Andererseits bleiben die Charaktere damit auch oberflächlich und stereotyp. Es gibt den skurppellosen Wirtschaftsmann, die Hausfrau, die Anwältin und so weiter. Eine Entwicklung der Personen erfolgt kaum.
Der Roman strotzt dafür vor kreativen Ideen. Gentests im Scheidungsfall, Gentests, um die Versicherungshöhe zu Bestimmen - das sind nur zwei Beispiele. Nebenbei baut Crichton auch noch verschiedene Nebenhandlungen ein, die dann in Zeitungsartikeln, die immer wieder zwischen den Kapiteln auftauchen, geklärt werden. So wird ein Krankenhausarzt, der ein paar "krumme Dinger" dreht, auf üble Art und Weise von seinem Gehilfen hintergangen.
Die eigentliche Intention des Romans, nämlich die Gefählichkeit von Gentechnik und der damit verbundenen Industrie zu demonstrieren, ist gelungen. Dafür braucht es keine, sich entwickelnden Charaktere. Crichton fügt dem Roman dann noch ein fünf-Punkte-Programm an, in dem er erklärt, was getan werden muss, um die Auswüchse der Genforschung einzudämmen. Diese Punkte sind wohl überlegt und überraschend unpopulistisch. Er spricht sich zum Beispiel gegen ein Forschungverbot aus, da es immer Wege gehen wird, um solche Verbote zu umgehen. Kontrolieren statt verbieten ist sein Motto.
"Next" ist leicht zu lesen und entführt einen schnell in eine erschreckend realistisch wirkende Welt, in der es leider nur stereotype Charaktere gibt.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Jagd auf Nickie Berger
 Die Auftraggeber hinter der Meuterei von Nickie Berger werden endlich enthüllt. Das Ganze geschieht im Rahmen einer soliden Agentenstory. Leider überzeugt die Hauptfigur des Romans nicht wirklich. Denn auf einmal wandelt sich der stille erste Offizier der Sternenfaust in einen Top_Agenten. Das muss man als Leser erst einmal verkraften - authentisch wirkt es nicht.
Die Auftraggeber hinter der Meuterei von Nickie Berger werden endlich enthüllt. Das Ganze geschieht im Rahmen einer soliden Agentenstory. Leider überzeugt die Hauptfigur des Romans nicht wirklich. Denn auf einmal wandelt sich der stille erste Offizier der Sternenfaust in einen Top_Agenten. Das muss man als Leser erst einmal verkraften - authentisch wirkt es nicht.Die gesamte Rezension ist wie immer auf sf-radio zu lesen:
Sternenfaust Band 139 - Jagd auf Nickie Berger (von Simon Borner)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: A clockwork orange (von Anthony Burgess)
 Alex verbricht mit seinen Freunden in einer düsteren Zukunftswelt unglaubliche Dinge. Regelmäßig rauben sie Geschäfte aus, verprügeln Obdachlose und vergewaltigen Frauen. Doch dann läuft ein Einbruch der Gruppe schief und Alex wird - von seinen Freunden verraten - verhaftet...
Alex verbricht mit seinen Freunden in einer düsteren Zukunftswelt unglaubliche Dinge. Regelmäßig rauben sie Geschäfte aus, verprügeln Obdachlose und vergewaltigen Frauen. Doch dann läuft ein Einbruch der Gruppe schief und Alex wird - von seinen Freunden verraten - verhaftet..."A clockwork orange" ist in drei Teile eingeteilt. Der erste Teil beschreibt Alex Verbrechen. Dabei ist besonders hervorzuheben, dass Alex bei allem erst 15 Jahre alt ist. Im zweiten Teil wird Alex Gefängnisaufenthalt und seine "Heilung" beschrieben. Da die Gefängnisse überfüllt sind, hat die Regierung nämlich eine Methode zur "Heilung" von Verbrechern entwickelt. Nach der Prozedur ist der Mensch nicht mehr in der Lage dazu, an "schlechte" Sachen überhaupt nur zu denken. Der dritte Teil zeigt dann, dass Alex ohne negativen Neigungen ein absolutes Opfer der Gesellschaft wird.
So wandelt sich der Täter im Laufe der Geschichte zum Opfer. Die gesamte Geschichte wird in der ersten Person von Alex erzählt, der sich selbst immer nur als "your humble narrator" bezeichnet. Er verwendet permanent eine Art Jugenslang, die Burgess selbst erschaffen hat. Das macht gerade den ersten Teil sehr schwer zu verstehen, schließlich muss man sich das Vokabular des Slangs erst einmal aneignen ("the old-in-and-out" als Synonym für Geschlechtsverkehr geht ja noch, "gulliver" als Bezeichnung für den Kopf ist schon schwieriger). Der zweite und dritte Teil strotzen nicht mehr so vor Slang, wodurch der erste Teil weitaus länger wirkt, als eigentlich ist.
Burgess schildert eine Zukunft, in der die Jugend extrem verwahrlost ist. Während alle Menschen arbeiten müssen, versucht die Regierung im Hintergrund Stück für Stück das Staatssystem in eine totalitäre Diktatur umzubauen. Alex bekommt davon natürlich kaum etwas mit. Für ihn zählt lediglich der nächste Abend und was er dann wieder verbrechen möchte. Das ist nur durch das Nadsat (besagter Slang) erträglich, denn der sorgt dafür, dass man permanent am übersetzen ist und etwas Distanz zu den grausamen Verbrechen aufgebaut wird.
Im Laufe der Geschichte gelingt es aber tatsächlich so etwas wie Sympathie für Alex aufzubauen. Auch wenn man sich mit seinen Ansichten - hoffentlich - nicht identifizieren kann, leidet man doch mit ihm sobald er seines freien Willens beraubt ist.
"A clockwork orange" überzeugt auch deswegen, weil Alex bei allem doch eine Entwicklung durchmacht. In den drei Jahren, die die Geschichte beschreibt, entwickelt er sich durchaus weiter. Zum Schluss ist er gar auf natürlich Weise "geheilt".
"A clockwork orange" überzeugt vor allem aber auch deswegen, weil die Zukunft, die dort beschrieben ist, so realistisch ist. Die meisten Leute hängen nur noch vor dem Fernseher, Bibliotheken werden kaum wertgeschätzt und niemand interessiert sich wirklich dafür, was die Regierung macht, solange es allen gut geht. All das liegt durchaus im Bereich möglicher Entwicklungen.
Die Geschichte hat natürlich keine eindeutige Botschaft. Lediglich die Betonung des freien Willens fällt sofort auf. Denn ohne diesen - das zeigt Alex Schicksal ganz gut - ist ein Mensch einfach nicht mehr menschlich, sondern kaum mehr als ein "Uhrwerk".
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: City Of Glass (Paul Auster)
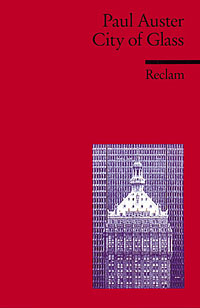 „City Of Glass“ ist ein vertrackter Krimi. Der einsiedlerische Schriftsteller Daniel Quinn wird eines Abends angerufen. Der Anrufe verlangt Paul Auster. Nach einer Weile gibt sich Quinn als Paul Auster aus und übernimmt einen Beschattungsauftrag.
„City Of Glass“ ist ein vertrackter Krimi. Der einsiedlerische Schriftsteller Daniel Quinn wird eines Abends angerufen. Der Anrufe verlangt Paul Auster. Nach einer Weile gibt sich Quinn als Paul Auster aus und übernimmt einen Beschattungsauftrag.Was sich wie ein durchschnittlicher Krimi anhört, wandelt sich schnell zu etwas ganz anderem. Denn eigentlich geht es um das Schicksal Daniel Quinns. Wobei Schicksal etwas hochgestochen ist, denn nach der Lektüre des Buches hat man das Gefühl, es gibt in dieser Welt eigentlich nichts als den Zufall.
Das Buch ist verwirrend. Es startet zunächst gradlinig. Quinn übernimmt den Auftrag und beschattet die Zielperson auch pflichtbewusst. Nach einer Weile beginnt er sogar mit dem „Auftragsobjekt“ zu kommunizieren. Dieses hat krude, religiöse Ansichten und ist auf einer „Mission“ die Ursprache der Menschen, also die Sprache vor dem Turmbau zu Babel, wiederherzustellen.
Bis dahin ist alles in Ordnung. Doch dann verliert Quinn sein Beschattungsobjekt. Alles spielt ab da verrückt. Quinn wird allmählich besessen von dem Fall. Zum Schluss ist seine Persönlichkeit eigentlich nicht mehr existent. Quinn hat sich dann zwischen seinem Leben, seinem Synonym und der Identität Paul Auster aufgerieben.
Auch die Erzählperspektive spielt verrückt. Quinn trifft nämlich auf einen fiktiven, wirklichen Paul Auster. Die Geschichte wird aber erzählt von einem Freund dieses fiktiven Austers. Das Buch ist aber ja geschrieben von dem wirklichen Paul Auster. Sehr einfallsreich, aber auch verwirrend.
Bevor man zum Schluss kommt, werden noch krude Gespräche geführt und New York wird beschrieben. All dies geschieht auf eine Weise, die immer wieder Realität und Fiktion verschwimmen lässt. So ufert der Roman dann zum Schluss deutlich aus.
Zurück bleibt erst einmal Unverständnis. Dann – wie schon erwähnt – die Erkenntnis des Zufalls. Auch der „falsche“ Lebensstil Quinns, der seine Synonyme quasi zu einer Art Schizophrenie ausgebaut hat, ist während der ganzen Geschichte deutlich. Trotzdem ist es erschreckend, wie schnell ein eigentlich geordnetes Leben den Bach hinunter gehen kann. Auster zeigt in "City of glass" aber deutlich, dass "Leben im Falschen" nicht möglich ist.
Auffällig ist auf jeden Fall, dass die eigentlich Kriminalgeschichte kaum eine Rolle spielt. Letztendlich ist sogar nicht einmal sicher, ob es überhaupt eine Kriminalgeschichte gab oder ob Quinn oder sein Auftragsgeber sie sich nur eingebildet hat.
Andererseits ist bis auf den Zufall heutzutage ja auch nichts mehr sicher.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: The star to every wandering (David R. George III)

 Im Jahr 2006 wurde "Star Trek" 40 Jahr alt. Damals setzte David R. George III den drei bekanntesten Charakteren der Originalserie, Kirk, Spock und Pille, ein einzigartiges Denkmal. Extrem melancholisch und immer auf eine Person fixiert sind die Bücher der "Crucible"-Trilogie eigentlich eine Charakterisierung der drei über mehrere hundert Seiten.
Im Jahr 2006 wurde "Star Trek" 40 Jahr alt. Damals setzte David R. George III den drei bekanntesten Charakteren der Originalserie, Kirk, Spock und Pille, ein einzigartiges Denkmal. Extrem melancholisch und immer auf eine Person fixiert sind die Bücher der "Crucible"-Trilogie eigentlich eine Charakterisierung der drei über mehrere hundert Seiten. Bei McCoy uferte das in einem 600 seitigen, äußerst lesenserten Roman aus. Für Kirk gab es gerade einmal halb so viele Seiten. Wie sich das liest, kann man wie immer auf trekzone nachlesen:
The star to every wandering
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Everyman (von Philip Roth)
 "Everyman“ beginnt mit der Beerdigung des namenlosen Hauptdarstellers. Der Rest des Buches beschreibt den Alterungsprozess dieser Person aus dessen Blickwinkel. Hier wird also eine Lebensgeschichte erzählt.
"Everyman“ beginnt mit der Beerdigung des namenlosen Hauptdarstellers. Der Rest des Buches beschreibt den Alterungsprozess dieser Person aus dessen Blickwinkel. Hier wird also eine Lebensgeschichte erzählt.Das ist zunächst äußerst skurril. Blitzschnell nähert sich der Erzähler nämlich dem hohen Alter zu. Das liegt daran, dass er sein Leben nur anhand seiner Krankenhausbesuche erzählt. Diese Idee reicht beinahe schon aus, um die Lektüre lesenswert zu machen. Zu Beginn wirkt das noch heiter. Denn als kleiner Junge und als 35-jähriger hat man durchaus gute Gedanken bei Krankenhausaufenthalten. Später muss er sich aber jährlich Operationen unterziehen, das ist dann nicht mehr lustig.
Daher ist die zweite Hälfte des Romans auch düsterer. Der Erzähler muss mit Einsamkeit auskommen. Und mit wachsender Einsamkeit fragt er sich natürlich auch, wodurch diese Einsamkeit entstanden ist. Daher geht er gedanklich noch einmal seine drei Ehen durch. Die Einsamkeit wird sogar so stark, dass er einige erbärmliche Versuche startet mit Frauen in Kontakt zu kommen. Das kann dann nur noch als tragisch-komisch bezeichnet werden.
Immer wieder gibt es Pläne, aus der Einsamkeit auszubrechen. Und jedes Mal scheitern sie wieder an banalen Sachen. Immer mehr Freunde sterben, um den „Everyman“ herum. Denn der Erzähler ist tatsächlich eine Art „Everyman“. Nicht umsonst bleibt er namenlos – sein Schicksal kann eigentlich jeden treffen.
Trotz der Fokussierung auf die Krankheitsgeschichte des Erzählers gelingt es Roth, das Leben des Erzählers zu skizzieren. Von der Jugend als Sohn eines Arbeiter-Juweliers (dies wird auf der Beerdigung geschildert) über seine Affären in seiner zweiten Ehe (dies reflektiert der Erzähler als er nach den Ursachen für seine Einsamkeit sucht) bis hin zu dem Versuch, über das Anbieten von Malkursen im Altersheim an Frauen heranzukommen (dass ist dann Teil der eigentlichen Handlung) erlebt man den Erzähler in den verschiedensten Situationen. So ist sein Tod zum Schluss weitaus bewegender als die einleitenden Trauerreden auf seiner Beerdigung.
Roths Erzählstil sorgt glücklicherweise dafür, dass keine allzu düstere Stimmung zum Schluss erzeugt wird. Der Tod kommt schnell und nicht allzu schmerzvoll. Trotzdem ist es gerade die Art von Tod, vor der sich der Erzähler in seiner Jugend so gefürchtet hat. Hier schwingt wieder die Ironie und der Witz mit, die den Stil des Buches zu einem großen Teil ausmachen und auch lesenswert machen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Countdown (von Mike Johnson und Tim Jones)

 Mit einiger Verspätung ist nun auch mein Kommentar zu der Vorgeschichte des neuen "Star Trek"-Films auf trekzone.de online gegangen.
Mit einiger Verspätung ist nun auch mein Kommentar zu der Vorgeschichte des neuen "Star Trek"-Films auf trekzone.de online gegangen."Countdown" ist ein Comic, das die Ereignisse vor Neros Eintritt in das Schwarze Loch beschreibt. Mit dabei sind viele Hauptfiguren der "Next Generation"-Serie.
Allerdings ist das Comic im Stil wie der neue Film: Actionreich aber inhaltsleer. Zudem werden einige Ereignisse, wie z.B. die Rückkehr Datas, nicht würdig behandelt.
Wie das Comic insgesamt wirkt, ist auf trekzone nachzulesen:
Star Trek Countdown
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Tyrannenmord auf Kridania

 "Sternenfaust" setzt dem Kridan-Krieg ein Ende...beinahe zumindest. "Tyrannenmord auf Kridania" erzählt die Geschichte einer Verschwörung auf...Überraschung...Kridania. Dies ist extrem spannend und endet mehr als überraschend.
"Sternenfaust" setzt dem Kridan-Krieg ein Ende...beinahe zumindest. "Tyrannenmord auf Kridania" erzählt die Geschichte einer Verschwörung auf...Überraschung...Kridania. Dies ist extrem spannend und endet mehr als überraschend."Sternenfaust" ist also weiterhin auf einem guten Kurs. Die Geschichten stimmen, die Handlung kommt mit jedem Heft vorwärts.
Wie sich das bei "Tyrannenmord auf Kridania" liest, erfährt man - wie immer - auf sf-radio.net:
Sternenfaust Band 138 - Tyrannenmord auf Kridania (von Michelle Stern)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen:Der Stechlin (Theodor Fontane)

„Zwei Leute heiraten, ein alter Mann stirbt“ - so ähnlich soll Fontane seinen letzten Roman beschrieben haben. Tatsächlich ließe sich die Handlung auf den Satz verknappen. Dennoch gelingt es Fontane, mit dieser Handlung 460 Reclam-Seiten zu füllen.
Das müsste eigentlich in gähnender Langeweile enden.
Davor wird der Roman jedoch von Fontanes detaillierten Beschreibungen bewahrt. Seitenlang nimmt er sich Zeit, um die verschiedensten Figuren einzuführen.
Da gibt es den alten Stechlin, der im Schloss Stechlin, im Dorf Stechlin, am See Stechlin wohnt. Da gibt es einen Musiklehrer in Berlin, der nur einen Doktor gemacht hat, um seinen skandinavischen Vornamen abzulegen, eigentlich Pole ist und bei jeder Erwähnung von etwas skandinavischem gleich ärgerlich wird.
Dann gibt es im Dorf Stechlin einen Pfarrer, der eigentlich die Konservativen (zu denen Stechlin gehört) unterstützt, andererseits aber auch sozialdemokratische Positionen vertritt und aus dem man nicht wirklich schlau wird.
Und in der Art gibt es noch mindestens zwei Dutzend weitere wichtige und unwichtige Personen, die teilweise skuril, teilweise langweilig aber immer authentisch beschrieben werden.
Immer gibt es dabei den Kontrast zwischen Alter und Neuer Zeit. Auf der einen Seite stehen die Konservativen, auf der anderen die Sozialdemokraten. Die einen wollen in der Region heiraten, die anderen sehen das als altmodisch an. Der eine macht sich wegen Standesunterschieden sorgen, der andere hat das schon überwunden.
Der Roman ist 1899 erschienen, also mitten in der Kaiserzeit. Nach der Lektüre hat man das Gefühl, ein außerordentlich gutes Bild der damaligen Gesellschaft zu haben. Freilich kann dieses Gefühl trügen, denn ein Roman ist keinesfalls der ausschließlichen Wahrheit verpflichtet. Doch viele der aufgeworfenen Themen und Fragen (und davon gibt es mehrere in dem Roman) werden die damalige Gesellschaft wohl wirklich bewegt haben.
Zu allem kommt noch ein extrem langsames Erzähltempo. Die Charaktere treffen sich an den verschiedensten Orten und unterhalten sich. Wenn keine Landschaft beschrieben wird oder das Innenleben von Charakteren erkundet wird, dann unterhalten sich die Menschen. Teilweise geht das seitenlang so. Das ist manchmal anstrengend. Meistens wird es durch Fontanes Stil aber relativ angenehm gemacht.
Dem Roman fehlt jedoch ein dicker roter Faden. Natürlich gehört alles zusammen und jedes Kapitel hat seine Funktion. Aber es fehlt eine Geschichte, die große Spannung erzeugt.
Darum geht es in „Der Stechlin“ aber auch gar nicht, dennoch fehlt es.
Und so ist „Der Stechlin“ keine Tragödie und auch keine Komödie. Zwar gibt es traurige und auch urkomische Momente, doch eigentlich ist es nichts weiter als eine Situationsbeschreibung. Allerdings eine Situationsbeschreibung die unglaublich authentisch und nah wirkt und Gegensätze herausarbeitet. Das Beides regt immer wieder zum Weiterlesen an.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
... ältere Einträge
