Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

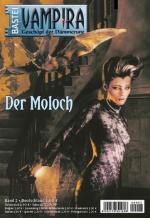 Der zweite Teil der Neuauflage von "Vampira" baut leider etwas ab. Von den drei aufgebauten Handlungssträngen überzeugt nur einer. Die anderen beiden sind zwar auch flott geschrieben, überzeugen inhaltlich aber nicht wirklich.
Der zweite Teil der Neuauflage von "Vampira" baut leider etwas ab. Von den drei aufgebauten Handlungssträngen überzeugt nur einer. Die anderen beiden sind zwar auch flott geschrieben, überzeugen inhaltlich aber nicht wirklich.Die gesamte Rezension findet man wie immer auf SF-Radio:
Vampira Band 2 - Der Moloch (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
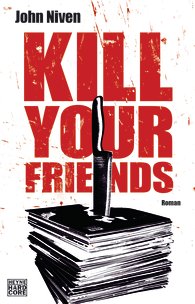 Steven Stelfox ist A&R-Manager einer großen britischen Plattenfirma. Sein Leben, das sich eigentlich um Musik drehen sollte, besteht hauptsächlich aus Koks, Nutten und Sauforgien. Auf diese Art und Weise ist er relativ erfolgreich, zumindest wurde er in dem schnelllebigen Business noch nicht abgesägt. Allerdings basiert sein bisheriger Erfolg rein auf Glück. Das wird Steven bewusst, als sein Vorgesetzter gefeuert wird, sondern ein Kollege, der zwar genau so viel kokst, aber etwas solider arbeitet. Mit diesem Kollegen beginnt Steven den Titel des Buches in die Tat umzusetzen...
Steven Stelfox ist A&R-Manager einer großen britischen Plattenfirma. Sein Leben, das sich eigentlich um Musik drehen sollte, besteht hauptsächlich aus Koks, Nutten und Sauforgien. Auf diese Art und Weise ist er relativ erfolgreich, zumindest wurde er in dem schnelllebigen Business noch nicht abgesägt. Allerdings basiert sein bisheriger Erfolg rein auf Glück. Das wird Steven bewusst, als sein Vorgesetzter gefeuert wird, sondern ein Kollege, der zwar genau so viel kokst, aber etwas solider arbeitet. Mit diesem Kollegen beginnt Steven den Titel des Buches in die Tat umzusetzen...„Kill Your Friends“ ist der erste Roman des Autors, der unter anderem auch Coma geschrieben hat. War Coma schon an einigen Stellen geschmacklos und unter der Gürtellinie, ist „Kill Your Friends“ es die ganze Zeit. Man erlebt Steven Stelfox eigentlich in einer Dauerorgie, die ihm nicht unbedingt gut tut. Die Momente, in denen Stelfox mal zur Ruhe kommt oder gar einen klaren Gedanken treffen kann, sind in dem Roman extrem rar gesäht. Stattdessen wird gekokst und mit vulgärer, teils stark pornographischer Sprache um sich gehauen. Es wird ein Bild von einem völlig moarllosen Business gezeichnet.
Der Roman ist eigentlich nur dadurch ertragenswert, dass der Autor ebenfalls einmal A&R-Manager gewesen ist. Daher lässt sich schließen, dass die Schilderungen Stelfox zumindest eine gewisse Authenzität besitzen. Der Leser erlebt alles rein aus Stelfox-Perspektive, den Niven auch in der Ich-Form auftreten lässst. Das sorgt für wenig Distanz zur Hauptfigur.
Der Titel „Kill Your Friends“ ist völlig falsch gewählt. Stelfox hat nämlich gar keine Freunde. Sein ganzes Leben besteht lediglich aus der Arbeit, den Parties und Nutten. Insofern besteht seine Opferliste auch lediglich aus seinem neuen Vorgesetzten, dessen Nachfolger und seiner Sekretärin. Obwohl Stelfox permanent auf Drogen ist, gelingt es ihm, fast perfekte Morde abzuliefern. Zumindest sorgt jeder einzelne dafür, dass er weiter aufsteigt. Je verruchter Stelfox wird, je weniger er sich auf die Musik seiner Künstler konzentriert, desto erfolgreicher wird er.
„Kill Your Friends“ ist an einigen Stellen kaum zu ertragen. Zu wirr ist die Hauptfigur, zu krass die Gedanken derselben und zu durchwachsen die Gesamtsituation. Aber genau das ist es dann auch, was den Roman überhaupt interessant macht. Hier gibt es eine verdorbene, morallose und chauvinistische Hauptfigur, die proportional erfolgreicher wird je ruchloser sie sich verhält. Dazu kommt ein Geschäft, dass sich die Zusatz „Musik-“ gibt, ohne dass irgendjemand sich ernsthaft mit Musik auseinandersetzen würde. Stattdessen ist der ganze Roman von Zynikern durchzogen, die zwar hinter Stelfox Zynismus verblassen, aber bei etwas Distanz noch immer verdammt zynisch sind. Dennoch ist „Kill Your Friends“ sicherlich nicht der „ultimative Roman zum Untergang der Musikindustrie“. Schließlich basiert die Schilderung noch auf den letzten Jahren des 20. Jahrhundert, also auf einer Zeit, in der die Musikindustrie das Internet mit vielen illegalen Downloads noch nicht wirklich gefürchtet hat. Nur irre hohe Profite bei Erfolg ermöglichen ja schließlich Stelfox Lebensstil. Zwar klagt auch Stelfox darüber, dass die Profite immer geringer werden, aber er müsste erst einmal das Download-Zeitalter erleben. „Kill Your Friends“ zeichnet ein zynisches Bild der Musikindustrie, das vermutlich in vielen Punkten authentisch ist.
Einerseits ist „Kill Your Friends“ wirklich nicht mehr schön. Viele Gedanken Stelfoxs sind so unnötig, so sexistisch und häufig so pervers, dass man sie eigentlich nicht wirklich wissen will. Auch wenn man zu Beginn des Romans noch über einiges schmunzelt, wird es zum Ende hin doch anstrengend. Andererseits zeigt der Roman, wie ein durchkapitalisierter Kunstzweig ohne Moral auskommt. Dabei sind die vielen sprachlichen Tiefpunkte notwendig, um Authentizität zu erzeugen. In „Kill Your Friends“ dürften nicht die Morde ein Problem für zart besaitete Leser sein, sondern die Sprache. Wer sich davon nicht stören lässt, findet in dem Roman einen kurzweiligen Einblick in eine anstandslose, zynische Person, die die Erfahrung machen darf, dass in einigen Strukturen schlechte Taten durchaus belohnt werden können.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

 Zum ersten Mal seit dem für die Kridan fatalen Ende des letzten Zyklus dreht sich das Geschehen wieder um die fanatischen Vögelabkömmlinge. Diesmal will das Militär verhindern, dass die Menschen zusammen mit den ehemaligen Kridan-Verbündeten Sharaan Geschäfte machen. Da die Menschen aber die Schutzverträge nicht brechen können, da sie sonst vor der ganzen Galaxie blamiert wären, kommt es zur Konfrontation. In diesem Fall geht es um das Torrent-System, wo ein seltenes Erz abgebaut wird. Die Sternenfaust ist das einzige Schiff in der Nähe und sieht sich auf einmal einer kleinen Kridan-Flotte gegenübergestellt.
Zum ersten Mal seit dem für die Kridan fatalen Ende des letzten Zyklus dreht sich das Geschehen wieder um die fanatischen Vögelabkömmlinge. Diesmal will das Militär verhindern, dass die Menschen zusammen mit den ehemaligen Kridan-Verbündeten Sharaan Geschäfte machen. Da die Menschen aber die Schutzverträge nicht brechen können, da sie sonst vor der ganzen Galaxie blamiert wären, kommt es zur Konfrontation. In diesem Fall geht es um das Torrent-System, wo ein seltenes Erz abgebaut wird. Die Sternenfaust ist das einzige Schiff in der Nähe und sieht sich auf einmal einer kleinen Kridan-Flotte gegenübergestellt.Die ganze Rezension findet man wie immer auf sf-radio:
Sternenfaust Band 164 - Kampf um Torrent (von Gerry Hanyaly und Michelle Stern)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
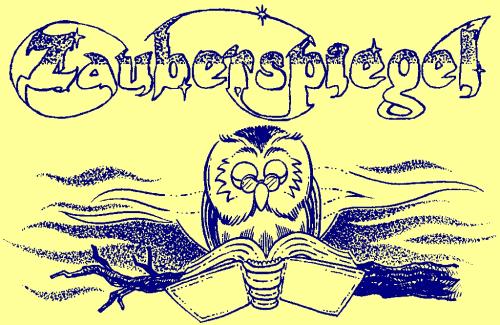
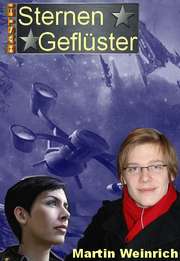 Vor einer Weile beschäftigte ich mich mit der Frage, wie die Brückencrew als zweite Charakterreihe in der Serie "Sternenfaust" an Bedeutung verloren hat, während andere Handlungsbögen außerhalb der Sternenfaust mehr Bedeutung gewannen. In der neuen Kolumnenfolge wiederum beleuchte ich ein Mitglied der Brückencrew hinter Dana Frost: Captain Cody Mulcahy.
Vor einer Weile beschäftigte ich mich mit der Frage, wie die Brückencrew als zweite Charakterreihe in der Serie "Sternenfaust" an Bedeutung verloren hat, während andere Handlungsbögen außerhalb der Sternenfaust mehr Bedeutung gewannen. In der neuen Kolumnenfolge wiederum beleuchte ich ein Mitglied der Brückencrew hinter Dana Frost: Captain Cody Mulcahy.Mulcahy kam im letzten Zyklus an Bord der Sternenfaust, hatte einen großen Moment und verschwand dann im Schatten von Admiral Taglieri. Als Dana Frost auf die Sternenfaust zurückkehrte, sah es erst einmal so aus, als bliebe Mulcahy im Hintergrund. Doch zwei neue Roman änderten dies:
Helden der zweiten Reihe (II): Cody Mulcahy
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Wahrscheinlich waren die Sendungen zu kompliziert für den deutschen Bürger, denn überraschenderweise hatten sie kaum gute Quoten. In den Medien wurde lediglich eine Sendung etwas diskutiert: Das Interview zwischen Frank Elstner und Lena.
Die besten Szenen hat Harald Schmidt zusammengestellt:
Die gezeigten Stellen machen wirklich Spaß, schließlich fragt man sich bei vielen "Showmastern" in Deutschland, ob die Interviewten nicht furchtbar genervt sind. Lena zeigt das an mehreren Stellen. Leider erbarmt sie Lena häufiger und beantwortet die Fragen Elstners tatsächlich. Dabei zeigt sie mit häufigen Ähms und sehr schwammigen Antworten, dass sie im Beantworten von Fragen leider nicht viel besser ist als Frank Elstner im Stellen derselben.
Daher ist die Frage nach einer eventuellen Zickigkeit tatsächlich berechtigt. Denn eigentlich müsste man sich entweder ganz auf einen bestimmten Moderator einlassen oder gar nicht. Beim Sehen der Sendung wurde ich jedoch an einen Politiker erinnert, der weitaus schlagfertiger einem nervigen Moderator begegnete: Willy Brandt. Kurz nach einer Sitzung wurde er von einem Tagesschau-Journalisten angehalten und ihm wurde gesagt, er habe lediglich eine Minute dreißig zum Beantworten von drei Fragen. Brandt war darüber so verärgert, dass er das Interview innerhalb von 30 Sekunden durchzog, indem er mit höchstens einem Wort antwortete.
Auf diese Weise wird wenigstens die Intention Brandts wirklich klar. Bei Lena bleibt Zickigkeit immer noch eine Option. Insgesamt wäre es aber durchaus wünschenswert, wenn Befragte auf oft unglaublich schlichte Interviewfragen genervter reagieren würden. Das mag zwar nicht die sympathischste Eigenschaft sein, aber vielleicht sterben dann irgendwann blöde Startfragen wie "Wie nervös sind sie jetzt?" aus.
Die meisten Lieder, die heute abend präsentiert werden, kenne ich noch nicht. Lediglich die von Google prognostizierten besten fünf habe ich mir angetan. Und eines davon hat es mir tatsächlich angetan: Frankreich sendet den weltjünsten proffessionellen Tenor, der auf Korsisch ein durchaus hörenswertes Lied präsentiert:
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
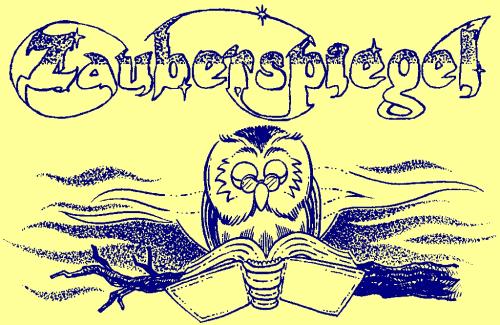
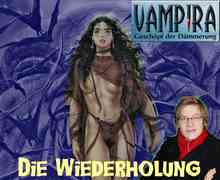 Dem Heftroman an sich geht es nicht unebdingt besonders gut. Die wenigsten neuen Serien schaffen es, sich lange zu halten, häufig setzen Verlage daher auf Wiederholungen. Die wiederum werden meist als kreativlos und als “Konserven” angesehen, nicht gekauft, was zur erneuten Einstellung führt.
Dem Heftroman an sich geht es nicht unebdingt besonders gut. Die wenigsten neuen Serien schaffen es, sich lange zu halten, häufig setzen Verlage daher auf Wiederholungen. Die wiederum werden meist als kreativlos und als “Konserven” angesehen, nicht gekauft, was zur erneuten Einstellung führt.Der “Bastei”-Verlag produziert jetzt wieder ein Neuauflage. Nur diesmal gibt es kein Genöle, sondern fast einstimmiges Lob für die Neuauflage der 90er-Jahre Serie “Vampira”. Da die Serie beinahe so alt ist, wie ich begleite ich die Neuauflage in einer Kolumne auf dem Zauberspiegel aus der Sicht desjenigen, der mit der Serie bisher absolut nichts am Hut hatte.
Der Text findet sich auf dem Zauberspiegel:
Juchu: Wiederholung
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
"Langatmig" trifft es in diesem Fall ganz gut. Mal wieder taucht ein Monster auf, das aber nicht abgedreht genug ist, um wirklich zu überzeugen. Zusammen mit zwei Bekannten kanadischen Nebenfiguren macht sich Kyles Bruder Ike auf den Weg, die Prinzessin zu befreien. Auch die Nebenhandlung um den psychisch angeknacksten Schulpsychologen, der ein Theaterstück in der Grundschule auf die Bühne bringt, sorgt nicht dafür, dass die Episode besser wird.
Lediglich zwei Punkte sind gelungen. Wieder einmal amüsiert die Darstellung des amerikanischen Bildes über Kanada zunächst. Die Kanadier benutzen nicht einmal Räder, so unterentwickelt werden sie von den "South Park"-Machern dargestellt. Wirklich überzeugend sind aber die beiden Hochzeitszeremonien. Ein relativ teilnahmeloser Sprecher hüllt sich permanent in Floskeln wie "A good day for Canada and therefore for the world". Außerdem ordnet er alle Ereignisse in "Tradition" und "Nicht-Tradition" ein. So fällt ihm zu der einstürzenden Kirche mit menschentötenden von der Decke fallenden Steinen lediglich ein, dass es nicht der Tradition entspricht, ein schlechter Tag für Kanada und somit ein schlechter für die Welt sei. Dennoch wundert man sich zunächst, warum abgesehen vom titelgebenden Pudding wenig komische Elemente in der Hochzeit liegen. Aber die Schlusszene, die die einzig gelungene, absurde Szene der Episode ist, macht dann deutlich, dass die Hochzeit doch gut auf den Arm genommen werden kann.
"Royla Pudding" sorgt für kaum einen Lacher, lediglich die Anspielungen auf die Kanada-Sicht der Amerikaner und die letzte Hochzeitsszene sind gelungen. Insgesamt ist die dritte Folge der 15. "South Park"-Staffel langatmig und langweilig.
Wer sie sich dennoch auf Englisch ansehen möchte, findet sie hier auf der "South Park"-Homepage.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
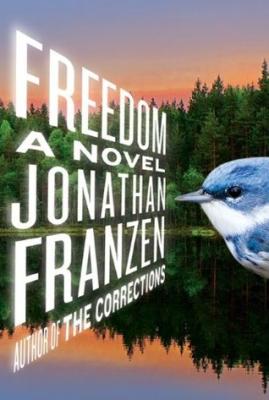 Wie in dem Vorgänger “The Corrections" steht eine amerikanische Familie im Mittelpunkt des Romans. Die Bertlunds sind die einzigen mit College-Abschluss in einer Straße. Patty Berglund ist eine gute Hausfrau, die ihren Sohn Joey viel zu sehr verwöhnt. Walter Berglund ist ein echter liberaler, der sich in seinem Job für den Naturschutz einsetzt und am Besten mit der Tochter Jessica auskommt. Die Berglunds wirken wie eine ganz normale Familie und sie sind es auch. Nur ist “normal” nun einmal nicht das, was man sich unter dem Begriff vorstellt.
Wie in dem Vorgänger “The Corrections" steht eine amerikanische Familie im Mittelpunkt des Romans. Die Bertlunds sind die einzigen mit College-Abschluss in einer Straße. Patty Berglund ist eine gute Hausfrau, die ihren Sohn Joey viel zu sehr verwöhnt. Walter Berglund ist ein echter liberaler, der sich in seinem Job für den Naturschutz einsetzt und am Besten mit der Tochter Jessica auskommt. Die Berglunds wirken wie eine ganz normale Familie und sie sind es auch. Nur ist “normal” nun einmal nicht das, was man sich unter dem Begriff vorstellt.Die “Times” hat vor kurzem ihre jährliche “100 most influencial people”-Ausgabe herausgebracht. Darin war auch Jonathan Franzen aufgelistet. Der Laudator schrieb (grob zusammengefasst), dass Franzen ungefähr jedes Jahrzehnt ein Buch rausbringe, was sowohl genial ist als auch den Leser ängstigt. Denn Franzen durchleuchte alles mit einem Blick, der selbst den letzten Winkel trifft. Genau das macht er in “Freedom”. 560 Seiten lang wird die Familie Berglund ausgeleuchtet und das ist fesselnd und berührend.
“Freedom” ist auf den ersten Blick nicht so strukturier aufgebaut wie “The Corrections”. Anstatt dass jedes Familienmitglied nacheinander seine Sicht der Dinge und sein Leben schildern kann, beginnt Franzen mit einem Außenblick durch Nachbarn. Dann lässt er Patty eine Art Tagebuch schreiben, um dann ausgiebig das Jahr 2004 aus den Augen von Walters bestem Freund, Joey und Walter zu betrachten. Zum Schluss zieht er noch einmal Patties Perspektive hinzu, um letztendlich wieder die Nachbarn – mittlerweile an einem anderen Ort – zu Wort kommen zu lassen.
Dabei werden Dinge durchaus zwei- oder drei Mal erzählt oder Kapitel setzen wieder deutlich vor den vorherigen an. Was normalerweise der absolute Spannungskiller ist und Bücher langweilig und unerträglich macht, sorgt bei Franzen für Antrieb. Denn jedes Familienmitglied nimmt Ereignisse natürlich anders war und viele Dinge, die zunächst gruselig wirkten, stellen sich später als harmlos raus.
Nachdem in “The Corrections” eine republikanische Familie durchleuchtet wurd, sind die Berglunds überzeugte Demokraten. Bis auf Joey, der sich im Lauf des Romans zum Republikaner entwickelt. Politik spielt aber auch in “Freedom” höchstens eine untergeordnete Rolle. Eigentlich dient sie nur dafür, für Absurdität zu sorgen. Führte der “politisch-kapitalistische”-Handlungsstrang in “The Correction” zu irren und doch glaubwürdigen Bürkerkriegsszenen im Baltikum, bringt er in “Freedom” krassen Umweltschutz und Turbokapitalismus par excellence. Walter verfällt im Laufe des Romans nicht nur einem Vogelschutzprojekt eines Kohle-Millionärs, sondern versucht auch gegen das eigentliche Umweltproblem vorzugehen: Überbevölkerung. Joey beutet den College Trust seiner Freundin völlig aus und beteiligt sich mit 50 000 Dollar an einem aberwitzigen Geschäft, das aus europäischen Augen nur scheitern kann.
Aber wie gesagt, stellen die beiden Handlungsstränge zwar die eigentliche Handlung dar, verstecken sich jedoch hinter den wieder äußerst gelungenen Charakteren. Durch die viele Zeit, die sich Franzen zuerst für Patty, dann für den Rocker-Richard und später für Walter und Joey nimmt, wirken alle vier extrem lebendig. Stereotyp kommen lediglich Jessica und eine Assistentin von Walter daher. Selbst Nebenfiguren wie der exentrischen Demokratin Jocelyne (Patties Mutter) und Walters alkoholsüchtigem Vater gewinnt Franzen im Laufe des Romans Facetten ab.
Und obwohl faktisch nicht viel passiert, schlägt Freedom enorme emotionale Wellen. Selbst mit dem arroganten und vor allem ignoranten Joey fiebert man mit, obwohl man ihn hasst, wie er seine Freundin Conney behandelt. Wie die meisten Charaktere des Buches muss Conney sich mit Andeutungen von Depressivität herumschlagen. Wieder einmal sind diese Darstellungen äußerst glaubwürdig und sehr eindringlich beschrieben. Conney ist dabei der Mensch, der zwar am schlichtesten aber auch am vernünftigsten wirkt. Ihre Sanftmut und Hingabe zu Joey sind bemerkenswert, ab dem zwölften Lebensjahr sind die beiden ein paar. Joey dankt es ihr mit unmöglichem Verhalten, was Conney in die Depressivität treibt. Im Gegensatz zu anderen gelingt es ihr aber, mit ihr zu leben und sie nicht lautstark an anderen auszulassen. Nur an einer Stelle merkt man die zerstörerische Kraft der psychischen Krankheit.
Die Beziehung Joey-Conney ist nur eine Komponente des wieder einmal dichten Beziehungsgeflechts, das Franzen aufbaut. Die gesamte Handlung so wiederzugeben, dass sie dem Roman im Ansicht gerecht wird und ein Bruchteil der Emotionen des Romans transportiert dürfte unmöglich sein. Am treffendsten ist die Metapher mit Franzens “durchleuchtendem Blick”. Die Berglunds werden auseinander genommen, ihre Fehler gnadenlos ans Tageslicht gebracht.
Dabei fügen sie sich viel gegenseitiges Leid zu. Und dabei kommt der Begriff “Freiheit” ins Spiel. Als überzeugter Liberaler ist für Walter die “Freiheit” das höchste Gut. Aber Patty muss schon als Kind erfahren, dass Freiheit nicht vor einer Vergewaltigung schützt. Auch bedeutet Freiheit nicht, dass man Recht zugesprochen bekommt. An vielen Stellen taucht so der Widerspruch zwischen der Sehnsucht nach Freiheit und dem was Freiheit mit sich bringen kann auf. Denn Freiheit bedeutet auch, dass die eigene Entscheidung viel größeres Gewicht hat. Nicht umsonst nennt Patty ihre “Autobiografie” “Mistakes have been made”. Außerdem schützt Freiheit ja bekanntlich nicht immer vor der Freiheit anderer.
“Freedom” fesselt über 560 Seiten lang nur mit einer Familie und dem besten Freund des Ehemanns, dabei bewegt der Roman einen teilweise bis zur Unerträglichkeit. Vor allem in den Momenten, in denen man bereits andere Perspektiven kennt, die der gerade beschrieben Charaktere nicht kennt. Wie die Lamberts werden auch die Berglunds und ihre Erlebnisse in Amerika nach 9/11, den Bush-Jahren und dem Boom vor 2007 einem noch lange in Erinnerung bleiben.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Jimmy Vollmer organisiert die ersten jährlichen Comedy-Awards an der “South Park”-Grundschule, eine furchtbar langweilige Veranstaltung. Doch er löst mit einem Award eine Katastrophe aus: die Deutschen werden als unwitzigstes Volk der Welt denunziert. Das kann die deutsche Reigerung natürlich nicht auf sich sitzen lassen und kurz danach erobern Angela Merkel, Christian Wulf und die gesamte Bundesregierung die Grundschule. Um zu beweisen, dass sie witzig sind, entwickeln die Deutsche einen Witz-Roboter: Funnybot!
Das Thema der letzten “South Park”-Folge ist natürlich gerade für Deutsche recht interessant. Allerdings bleibt die Episode hinter den Erwartungen, die der Trailer weckt, zurück. Sie beginnt sehr authentisch, die Award-Verleihung ist nämlich so langweilig wie sie bezeichnet wird. Erst mit dem “Angriff” der Deutschen wird die Episode skuril. Leider sprechen die Deutschen kein Deutsch, sondern eine Art Mischslang, der sich stark nach Swytzerdütsch anhört, aber auch viele Unsinnswörter beinhaltet. Das macht einem das Sehen fast unerträglich, denn man hört ab und zu deutsche Wörter gepaart mit viel Unsinn.
Dafür hat Cartman wieder einmal die größte Szene: Er will die Schule retten und möchte Kyle, den Juden, an die Deutschen “opfern”, damit sie abziehen. Der Moment kommt leider nicht besonders gut rüber, weil auch Cartman kein vernünftiges Deutsch redet. Leider bleibt das die einzig wirklich skurrile Szene der Folge.
Denn schnell tritt der titelgebende “Funnybot” auf die Bühne und dann wir die Folge langatmig. Es ist schnell klar, dass Funnybot eine eigene Agenda verfolgt. Schon seine Ähnlichkeit mit den Darleks aus Dr. Who.So wird sein “Aackward” immer mehr zum darlekschen “Exterminate”. Sein Plan, die Welt zu vernichten ist dementsprechend vorhersehbar.
Die Episode ruft bei mir aber wieder die Frage auf, wie kurzfristig die Folgen eigentlich produziert werden. “Human Centipad” ging auf den Apple-Skandal vergangene Woche ein, laut Wikipedia verarschen die Obama-Auftritte in dieser Folge seine Rede zum Tod Osamas. Wenn dem so wäre, wären die Auftritte gelungen. So wirkt Obama als schwächlicher, abgelenkter Präsident, als den man ihn seit vergangenem Montag ja nicht unbedingt mehr bezeichnen könnte. Sollte das tatsächlich – wie auf der englischen Wikipedia bemerkt – eine Paraodie auf die Montagsrede sein, wären “South Park”-Folgen extrem schnell produziert.
Trotz der schönen Idee, die “Deutschen”-Klischees (Aggressivität, Ingenieursleistungen) mal durch den Kakao zu ziehen, bleibt diese Episode stark hinter dem Vorgänger zurück und kann nur wenig Lacher und Skurrilität bieten. Das geht besser.
Die englische Episode kann man sich hier anschauen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
