 In einer Mietswohnung beobachtet eine Gruppe von Kindern Edward Billings durch Schlüsselloch. Der alte Mann arbeitet permanent an einer Art Bericht. Die Kinder fürchten zunächst, dass er ein kommunistischer Spion ist, sind dann jedoch der Ansicht, dass ihm dazu einfach der Bart fehle. Tommy ist ganz besonders mutig, er kehrt später zurück, um bei Billings einzubrechen. Der Bericht ist eine detaillierte Übersicht aller menschlicher Aktivitäten auf der Erde. Auf Billings Terasse findet Tommy dann jedoch eine Sensation: Billings hat dort kleine, menschenähnliche Lebewesen. Als Tommy sie sich genauer betrachtet, tritt Billings dazu. Er eröffnet Tommy, dass es sich bei den kleinen Lebewesen um Projekt C handelt. Nachdem Projekt A (Flugkreaturen) und Projekt B (die Menschen) gescheitert sind, musste ein neues Projekt her. Wichtig ist dabei nur, dass das dritte Projekt nicht wie das zweite von dem vorherigen Projekt korrumpiert wird. Das interessiert Tommy aber herzlich wenig, er sieht in den kleinen Männchen Spielfiguren, die er haben muss. Daher stiehlt er den Kasten kurzerhand...
In einer Mietswohnung beobachtet eine Gruppe von Kindern Edward Billings durch Schlüsselloch. Der alte Mann arbeitet permanent an einer Art Bericht. Die Kinder fürchten zunächst, dass er ein kommunistischer Spion ist, sind dann jedoch der Ansicht, dass ihm dazu einfach der Bart fehle. Tommy ist ganz besonders mutig, er kehrt später zurück, um bei Billings einzubrechen. Der Bericht ist eine detaillierte Übersicht aller menschlicher Aktivitäten auf der Erde. Auf Billings Terasse findet Tommy dann jedoch eine Sensation: Billings hat dort kleine, menschenähnliche Lebewesen. Als Tommy sie sich genauer betrachtet, tritt Billings dazu. Er eröffnet Tommy, dass es sich bei den kleinen Lebewesen um Projekt C handelt. Nachdem Projekt A (Flugkreaturen) und Projekt B (die Menschen) gescheitert sind, musste ein neues Projekt her. Wichtig ist dabei nur, dass das dritte Projekt nicht wie das zweite von dem vorherigen Projekt korrumpiert wird. Das interessiert Tommy aber herzlich wenig, er sieht in den kleinen Männchen Spielfiguren, die er haben muss. Daher stiehlt er den Kasten kurzerhand...Die Menschheit als Projekt von Außerirdischen, das außer Kontrolle geraten ist.Dicks Fantasie rüttelt auf wenigen Seiten an manchem Weltbild. Es ist zwar unvorstellbar, dass es vor den Menschen eine fliegende Spezie auf der Erde gab, doch die Außerirdischen hätten ja leicht alle Spuren beseitigen können. Interessant ist hierbei vor allem das Verhalten von Tommy. Billings eröffnet ihm recht direkt, dass die Zeit der Menschheit abgelaufen ist. Das Projekt B ist gescheitert, die Menschen bekriegen sich zu sehr. Das ist Tommy aber völlig egal, ihm geht es nur um den Besitz der kleinen Lebewesen.
Er rettet die Menschheit also damit, dass er aus reiner Gier handelt. Denn sein "Spiel" mit dem Projekt C korrumpiert dieses natürlich. Tommy beginnt, den kleinen Lebewesen Kleidung zu basteln. Außerdem zeigt er ihnen gewisse soziale Konventionen, die eigentlich menschlich sind.
Es wird in der Geschichte nicht angesprochen, wie die Aktionen auf die Lebewesen wirken. Aber man kann sich gut vorstellen, dass Tommies Verhalten gottähnliche Eindrücke erschaft. Schließlich "gibt" er ihnen die Kleidung und andere Gegenstände. Wenn die Menschheit auf ähnlich Weise "korrumpiert" wurde, ist es das auch eine Erkärung, wie sich religiöse Mythen bilden konnten.
Der Film "Matrix" begeisterte 1999 viele mit der Idee, dass die Welt, in der wir Leben nicht die ist, die sie scheint. Zwar lebt die Menschheit in "Projekt: Ende" auf einem realen Planeten und nicht in einer Art Cyber-Space, dennoch gibt es gewisse Paralllelen. Denn das Schicksal der Menschheit ist relativ verplant. Eigentlich war das Projekt gesteuert geplant. Die Menschheit konnte sich zwar der fremden Kontrolle entziehen und autonom werden, zieht dabei aber die Zerstörung auf sich. Letztendlich ist die Menschheit also doch nicht unabängig, sondern gelenkt. Dieser auch nach beinahe 60 Jahren noch immer moderne Gedanke, macht die Kurzgeschichte zu einer vergnüglichen und dennoch etwas nachdenklichen Lektüre.
Etwas ärgerlich ist die Übersetzung des Titels. Wie man von "Project: Earth" auf "Projekt: Ende" kommt, ist für mich relativ unverständlich.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

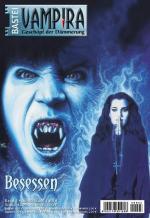 Der dritte Roman der Neuauflage von “Vampira” ist wieder deutlich besser als der Vorgänger. Lilith wird in einer Kirche gefangen gehalten, ein katholischer Priester versucht sich mit einem Exorzismus an ihr. Derweil muss der Polizist Warner feststellen, dass ihn immer mehr Parteien umbringen möchten. Irgendjemand will also verhindern, dass er dem Geheimnis der Vampir-Opfer auf die Spur kommt.
Der dritte Roman der Neuauflage von “Vampira” ist wieder deutlich besser als der Vorgänger. Lilith wird in einer Kirche gefangen gehalten, ein katholischer Priester versucht sich mit einem Exorzismus an ihr. Derweil muss der Polizist Warner feststellen, dass ihn immer mehr Parteien umbringen möchten. Irgendjemand will also verhindern, dass er dem Geheimnis der Vampir-Opfer auf die Spur kommt.Nach dem etwas müden “Moloch” ist “Besessen” wieder ein spannendes und unterhaltendes Heft, das zudem einige Weichenstellungen für die weitere Handlung bereitstellen dürfte.
Die ganze Rezension findet man auf SF-Radio:
Vampira Band 3 – Besessen (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

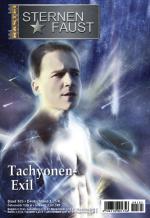 Der Zyklus startete damit, dass Dana Frost die relative Unsterblichkeit gegeben wurde. Doch gab es immer Zweifel, ob Dana wirklich ein ungewöhnlich langes Leben beschieden ist oder ob die Behandlung durch Naniten irgendwelche Nebenwirkungen mit sich bringt.
Der Zyklus startete damit, dass Dana Frost die relative Unsterblichkeit gegeben wurde. Doch gab es immer Zweifel, ob Dana wirklich ein ungewöhnlich langes Leben beschieden ist oder ob die Behandlung durch Naniten irgendwelche Nebenwirkungen mit sich bringt.Der aktuelle "Sternenfaust"-Roman fügt Dana Frosts bisherigem Leben hundert weitere hinzu. Denn auf einem Planeten, über dem sie abstürzt geht die Zeit langsamer als normal. Die paar Tage, die die Sternenfaust zur Rettung braucht, bedeutetn für sie 100 Jahre auf einem rückständigen Planeten.
Die Rezension zu dem Roman findet man auf SF-Radio:
Sterenenfaust Band 165 - Tachyonen Exil (von Simon Borner)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
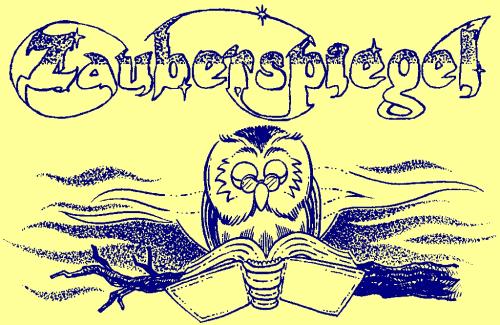
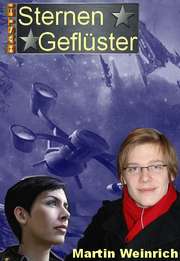 Manchmal macht es die Handlung der Serie “Sternenfaust” notwendig das Charaktere sterben. Das ist immer eine heikle Sache: Wählt man eine bekannte Person, riskiert man zukünftiges Potential zu verschenken. Außerdem ist es nicht immer einfach, einen bekannten Charakter “vorzuweisen”, schließlich muss man diesen ja erst einmal aufbauen. Wählt man jedoch eine bisher völlig unbekannte Person, riskiert man, dass deren Tod den Leser einfach kalt lässt. Schon wieder ein Marine/Jäger mit einem seelischen/Mobbing-Problem gestorben? Und?
Manchmal macht es die Handlung der Serie “Sternenfaust” notwendig das Charaktere sterben. Das ist immer eine heikle Sache: Wählt man eine bekannte Person, riskiert man zukünftiges Potential zu verschenken. Außerdem ist es nicht immer einfach, einen bekannten Charakter “vorzuweisen”, schließlich muss man diesen ja erst einmal aufbauen. Wählt man jedoch eine bisher völlig unbekannte Person, riskiert man, dass deren Tod den Leser einfach kalt lässt. Schon wieder ein Marine/Jäger mit einem seelischen/Mobbing-Problem gestorben? Und?Die Kolumne im Zauberspiegel stellt die Probleme des “Töten” in Heftromanserien dar. Denn letztendlich kann man Betroffenheit ja auch durch andere Mittel erreichen.
One Hit Wonder – Die Schwierigkeit, es beim “Töten” allen recht zu machen
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
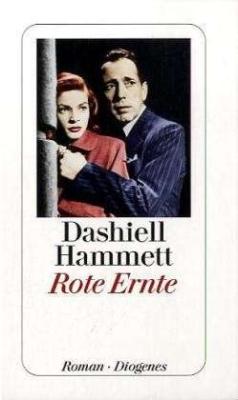 "Rote Ernte" wurde 1929 veröffentlicht. Ich wurde auf den Roman aufmerksam, weil Jakob Ajourni, von dem ich vor kurzem einen Roman gelesen habe, den Krimi pries. "Rote Ernte" war wohl ein kleiner Meilenstein und wurde von der "TIME" sogar in die Liste der besten englischsprachigen Romane von 1923 bis 2005 aufgenommen.
"Rote Ernte" wurde 1929 veröffentlicht. Ich wurde auf den Roman aufmerksam, weil Jakob Ajourni, von dem ich vor kurzem einen Roman gelesen habe, den Krimi pries. "Rote Ernte" war wohl ein kleiner Meilenstein und wurde von der "TIME" sogar in die Liste der besten englischsprachigen Romane von 1923 bis 2005 aufgenommen.Der Roman handelt von einem namenlosen Detektiv einer privaten Agentur in San Francisco, der den Mord an dem Sohn eines Großindustriellen in der Mienenstadt Peaceville aufklären soll. Der Detektiv, dessen Erlebnisse dem Leser durch die Ich-Perspektive näher gebracht werden, merkt schnell, dass der Spitzname "Pissville" absolut angebracht ist. Seit einem Streik, für den sein Auftraggeber Streikbrecher brauchte, wird die Stadt von Banden und korrupten Polizisten beherrscht. Obwohl der Detektiv den Mord, für den er eigentlich angeheurt ist, blitzschnell löst, bleibt er länger. Durch einen Trick luckst er seinem Auftraggeber den Auftrag ab, in "Pissville" aufzuräumen. Das tut er mit einer nicht ganz moralisch korrekten Methode: Er sorgt dafür, dass die vielen Machtpositionen in Peaceville sich gegenseitig ausschalten.
Zunächst wirkt der Roman überraschend schlicht und stereotyp. Der Ton der Geschichte ist so typisch Gangster-Roman haft, dass es fast schon witzig ist. Aber das wirkt halt aus heutiger Perspektive so, wo man die Sprache aus dem Off von schlechten Gangsterfilmen kennt. Zum Veröffentlichungszeitraum war der Ton vermutlich erfrischend.
Die Hauptfigur kann man nicht als Charakter bezeichnen. Sie ist intelligent, trickreich und hat einen perfekten Instinkt. Ständig überrascht sich nicht nur den Leser, sondern auch ein wenig sich selbst mit dem Überführen verschiedener Übeltäter. Mehr kann man über die Person allerdings nicht sagen. Die Motive, die Herkunft und die eigene Gefühlswelt bleiben dem Leser verschlossen. Durch die vielen Geistesblitze bleiben die Überführungsgedanken ebenfalls verschlossen. Stattdessen erlebt man einen selbstsicheren Detektiv, der vor nichts Angst hat und sich in jede gefährliche Situation ohne zu zögern stürzt. Es wirkt in diesem Zusammenhang beinahe komisch, dass die Hauptfigur zum Schluss doch noch etwas Angst entwickelt: Nämlich vor dem Chef, der Detektiv-Agentur, der mit den angewandte Methoden nicht zufrieden sein könnte.
Die Methoden führen neben etwas Angst auch zu der einzigen Gefühlsregung des Protagonisten. Sein Plan geht besser auf, als er es sich erhofft hat. Im Laufe des Romans bringen sich vier Gangstergruppen und die Polizeiführung gegenseitig um, ohne dass der Detektiv auch nur ein einziges Mal selbst eingreifen müsste. Gegenüber einer Gespielin (oder auch: einer besseren Nutte) eines Verbrecherkönigs gibt er kurz vor Schluss zu, dass ihn die angewandten Mittel beschäftigen, dass ihm zu viel Blut vergossen wurde. Da sie kurz darauf ebenfalls das Zeitige segnet, kann darauf nicht weiter eingegangen werden. Immerhin zeigt sich dadurch aber, dass auch dem Protagonisten die moralische Fragwürdigkeit seiner Methoden klar ist.
Die Handlung wirkt dann auch nur auf den ersten Eindruck und durch die Sprache etwas plump. Denn auch wenn die Verbrecherlandschaft von Peaceville zunächst sehr eindeutig wirkt, kommen immer wieder neue Dinge zutage. Mal wird ein früherer Verbrecher aus dem Knast entlassen und stellt sich als neue Macht heraus, mal formt sich eine neue Allianz zwischen zwei Verbrecherführern. Der Detetktiv ahnt durch seinen Instinkt das meiste schon im Vorraus, der Leser bekommt es dann erst ein Stück später mit. Zumal einem bei den vielen Spitznamen von "Flüster-Max" bis "Pete der Finne" auch etwas schwindelig wird.
Der Roman verschenkt an zwei Stellen allerdings etwas Komplexitätspotential. Die kriminellen Machenschaften des Auftraggebers sowie die Umtriebe eines radikalen Gewerkschaftsführers werden zu Beginn erwähnt, aber im Verlauf des Romans nicht ausgebaut. Daraus hätte man noch etwas machen können.
Ansonsten entfaltet der Roman mit schlichter Sprache und einem Ich-Erzähler, dessen Persönlichkeit im Hintergrund steht, eine fesselnde Dynamik, die nicht die hektische, auf Widerlichkeiten ausgerichtete Spannung heutiger "Thriller" entwickelt, sondern Spannung erzeugt, die durch die Aufdeckung immer tiefergehdner Korruptionsabgründe und der überraschenden Aktionen der Hauptfigur basiert.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Erinnert sich noch jemand an das “Bild – Die Brandstifter”-Titelbild des Spiegels? Damals beschäftigte man sich in der Prinzausgabe im typisch ausführlichen Spiegelstil mit der Niveaulosigkeit der “Bild”-Zeitung. Unglücklicherweise fragt man sich immer mehr, ob das denn überhaupt berechtigt ist.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
"Crack Baby Athletic Association" überschreitet die Grenze zum guten Geschmack mal wieder mehrmals. Die Idee der Crack Babies ist abartig, Cartmans Skruppellosigkeit mal wieder nicht zu überbieten. Daher ist die Episode auch selten "lachhaft" komisch.
Andererseits spielt die Folge auf viele Missstände an. Cartman macht aus den Babies eine "Crack Baby Athletic Association", um daraus ein "EA-Games"-Spiel zu machen und viel Profi zu schlagen. Er will den Kindern jedoch nichts zahlen. Daher orientiert er sich an dem amerikanischen Universitätssport. Bei dem machen die Unis auch viel Geld mit ihren Athleten, zahlen ihnen aber ebenfalls nichts. Das liegt daran, dass sie eine Regel haben, dass die Studenten kein Geld erhalten dürfen, weil nur der Sport zählen sollte. Also übernimmt Cartman dieses ausbeutende Prinzip einfach. Die Szene, in der er Universitätspräsidenten befragt, wie sie mit "ihren Sklaven" umgehen, ist dann auch die witzigste.
Der beste Spruch kommt allerdings in einer anderen Szene. Cartman versucht einer werdenden, cracksüchtigen Mutter ein Kind "abzukaufen". Als sie erfährt, dass das Kind nicht erhält, findet sie das etwas unfair ist. Cartman dazu: "I don't make the rules ma'am. I'm just the one who thinks them up and writes them down." - und er bekommt was er will.
Außerdem spielt die Episode auf die Dekadenz an, die einige Hilfsorganisationen befällt, wenn sie erst einmal Erfolg haben. Die Zahl der Spendenskandale, die aufgedeckt werden, deutet das ja auch in der Realität an. "South Park" übertreibt das natürlich maßlos und lässt Cartman von dem eingeworbenen Geld einen Whirlpoll bauen, der mit Kentucky Fried Chicken-Chicken Wing-Soße befüllt ist und um den lauter McDonalds Pommes liegen. Ein Traum für Cartman, keine Hilfe für die Babies.
Hinzu kommt noch eine Nebengeschichte, in der der Gitarrist einer Band, als eine Art Santa Clause verklärt wird.
So nachdenklich die Episode mit ihren Anleihen an erfolgreiche, egoistische Start-Ups und an die kurzfristige Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Probleme auch ist, wirklich witzig ist sie - wie bereits erwähnt - nicht. Zwar langweilt die Episode nicht, aber meistens sitzt man eher ungläubig v0r dem Bildschirm als lachend. "Crack Baby Atheltic Association" regt also eher zum Nachdenken an, als dass es zusätzlich noch amüsiert.
Die gesamte Episode kann man sie wie immer auf der deutschen South-Park-Seite auf Deutsch angucken.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Inhalt: Odo, Garak, Dax und Sisko kehren von einer Konferenz mit Bajoranern zurück. Doch plötzlich schwinden ihre Lebenszeichen. Bashir ist ratlos. Die vier Betroffenen sind derweil in der Zeit zurückversetzt und befinden sich auf Deep Space Nine während der cardassianischen Besatzungszeit...
Kritik: Zunächst scheint es so, als wäre diese Episode eine der eher langatmigen „Erinnerungsfolgen“ der Serie. Dem ist aber nicht ganz so. Relativ schnell wird klar, dass Odo etwas mit der Situation zu tun hat. Er kennt die Namen der Bajoraner, in die sich Sisko, Garak, Dax und er verwandelt haben. Vor allem aber weiß er, dass drei von ihnen demnächst exekutiert werden.
Da Odo immer wieder Blut sieht, ist ebenfalls schnell klar, dass er irgendwie Schuld auf sich geladen hat. Trotzdem ist die Episode interessant, da man das Verhalten einiger bekannter Cardassianer während der Besatzungszeit erleben kann. Da merkt man dann auch, dass das Ganze nichts mehr mit der „edlen Hilfe“ zu tun hatte, von der die Cardassianer später sprechen.
Es stellt sich heraus, dass Odo während der Besatzungszeit drei Bajoraner zu Unrecht zum Tode verurteilt hat. Er wollte für Recht und Ordnung sorgen und hat die falschen gefasst und hingerichtet, obwohl anderlautende Beweise vorlagen. Viele Bajoraner und auch Kira nehmen ihm das sehr übel. Das ist unverständlich. Denn wie sollte er als cardassianischer Polizeichef nicht Unrecht in dieser Zeit begehen? Um Recht und Ordnung aufrecht zu erhalten, wird er sicher auch Freiheitskämüfer hingerichtet haben müssen. Daher ist sowohl die vorherige Verehrung als auch die jetzt folgende Ablehnung unverständlich.
Trotzdem ist die Tat bewegend. Denn man merkt deutlich, wie Odo unter seiner „Fehlerhaftigkeit“ leidet. Gerade für ihn, der Recht und Ordnung über alles setzt, ist das Eingeständnis eines solchen fatalen Fehlers sehr schwierig.
Leider hat die Episode aber auch zwei Schwächen. Die Erklärung für die Erinnerung ist extrem schwach. Dass Odo durch einen Weltraumsturm eine eigene „Dominion-Verbindung“ aufgebaut haben soll, ist nicht besonders glaubwürdig.
Und leider erfährt man nichts über Garaks Kommentar zu der Besatzungszeit, nachdem er sie aus der Sicht der Bajoraner erlebt hat. Zuvor hat er sich noch so über die Bajoraner aufgeregt, die die Besatzungszeit nicht objektiv bewerten würden und als „Leidenszeit“ bewerteten. Nun da er sie selbst erlebt hat, hätte man seine Meinung ändern können.
Insgesamt ist „Die Schuld“ eine sehr gute Episode, die besonders Odo noch ein paar Facetten hinzufügt. Kleinere Schwächen verhindern, dass die Episode die Höchstwertung bekommt. 4,5 von 5 Punkten.
Die Gedankenecke-Serienübersicht zu Deep Space Nine
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Der Jungbrunnen, der schon zum Ende des letzten Teils der Serie erwähnt wurde, sorgt für Ärger. Nicht nur Jack Sparrow, auch die Spanier, die Engländer und der Pirat Blackbeard mit seiner Tochter suchen nach dem Brunnen. So kommt es zu einem Wettlauf, der den Zuschauer neben einem holprigen Start in London zu Meerjungfrauen, verschollenen Expeditionen und vor allem viel, viel Urwald führt.
Vom vierten Teil der Reihe habe ich nicht viel erwartet. Der erste Teil war klasse, der zweite überhaupt nicht und der dritte Teil der Serie konnte das Niveau nicht besonders steigern. Da ich mit extrem niedrigen Erwartungen in “On Stranger Tides” gegangen bin, war ich dann doch eher positiv überrascht.
Die Story ist etwas langatmig. Es gibt viele Ortswechsel, obwohl das meiste in irgendwelchen Urwäldern spielt. Der Start ist relativ amüsant, nur leider macht es wenig Sinn, dass die Handlung zunächst nach London gelegt wurde. Man hätte eben so gut eine britische Hafenstadt in der Karibik nehmen können. Danach zieht sich die Handlung etwas hin. Es passiert viel, doch wird meist viel gekämpft anstatt dass die Handlung auf einen dramatischen Höhepunkt hinsteuert.
Der Humor kommt leider auch in diesem Teil wieder sehr kurz. Es gibt nur wenige witzige Sprüche und auch die sorgen für keine ausgiebigen Lacher, die im Gedächtnis bleiben. Stattdessen plätschert die Handlung so vor sich hin, ohne besonders zu langweilen und ohne besonders zu unterhalten.
Die neuen Charaktere sind recht stereotyp. Blackbeard ist einfach böse und somit recht vorhersehbar. Er hat extrem viel Angst um seine Seele, zumindest wird das angedeutet. Allerdings tut er nicht, um sich in irgendeiner Form zu bessern. Dafür hat er ein magisches Schwert, mit dem er sein Schiff und andere Schiffe kontrollieren kann. Durch eine Handbewegung verändern sich Seile und Planken. Diese Fähigkeit ist eine weitere Steigerung der “Magie” in der Serie und wird diesmal in keiner Art und Weise erklärt. Dabei hätte man sich wenigstens Aufklärung über die Herkunft des Schwertes gewünscht.
Seine Tochter hatte einst eine Beziehung mit Jack, jetzt möchte sie ihrem Vater ein langes Leben ermöglichen. Sie soll etwas verschlagen wirken, ist aber letztendlich wohl der Charakter, auf den am meisten das Prädikat “gut” zutrifft. Das wird auf Dauer etwas stereotyp. Jack scheint sie aber tatsächlich zu lieben, zumindest setzt er sich mehrmals selbstlos für sie ein, was eigentlich nicht seine Art ist. Da aber eine Beziehung nicht zu Jack passt, darf sie natürlich auch im Film nicht geschehen. Von der Tochter Blackbeards kommt aber der beste Spruch des Films. Sie gibt sich zu Beginn als Jack Sparrow aus und begründet dass später gegenüber Jack damit, dass er nun einmal der einzige Pirat ist, den sie als Frau glaubhaft spielen kann.
Die Rolle des Missionars Swift ist Beiwerk und eher überflüssig. Er soll etwas den Kampf um Blackbeards Seele darstellen. Während der Mission verliebt er sich in eine Meerjungfrau. Meerjungfrauen sind eigentlich verdammt böse und beschäftigen sich in erster Linie damit, Seefahrer zu fressen. Diese aber ist – wie es der Zufall nun einmal will – herzensgut und verliebt sich ebenfalls in Swift. Zum Schluss ist er stark verwundet und wird von ihr ins Meer gezogen. Ob sie ihn damit durch den Tod “erlöst” oder ob er jetzt ein Meerjungmann wird, ist nicht klar. Diese Handlung ist aber eher kitschig und es wirkt so, als bräuchte man unbedingt einen Orlando Blook-Körperersatz, um ein paar Mädchen ins Kino zu locken.
Insgesamt ist der Film also nicht langweilig. Abgesehen von dem Ausflug nach London und Blackbeards Magie ist er sogar verhältnismäßig logisch. Am gelungensten im ganzen Film ist die Expedition der Spanier, die gerade zum Schluss des Filmes für einige der besten Szenen sorgt. “On Stranger Tides” ist kein Meisterwerk. Aber je geringer die Erwartungen beim Filmbesuch sind, desto mehr Spaß wird man haben. Wer von dem dritten Teil der Reihe also richtig genervt war, dürfte hier positiv überrascht werden.
Man sollte sich den Film aber unbedingt auf Englisch und nicht in 3D ansehen. Ich habe ihn in der Originalfassung gesehen und bin damit aus Versehen in einer 3D-Vorstellung gelandet. Das war das erste Mal, dass ich einen Film in 3D gesehen habe und es lohnt sich überhaupt nicht. Zwar hat man sich schon bemüht, mal eine Pflanze vor den Köpfen fallen zu lassen, aber es gibt keine einzige beeindruckende 3D-Szene, die überrascht. Dabei hat eine Haribo-Werbung zuvor gezeigt, dass man mit 3D wirklich tolle Dinge machen kann. Aber dafür bedarf es halt auch eines Films, der für 3D gemacht wurde.
Warum man sich den Film auf keinen Fall auf Deutsch sehen sollte, zeigt bereits der deutsche Trailer. Die deutsche Stimme von Jonny Depp wurde nämlich ausgetauscht und die neue passt überhaupt nicht zu der Figur von Jack Sparrow:
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Die Episode nimmt die "Tea Party" Bewegung in den Vereinigten Staaten auf den Arm. Die Aktivisten haben dabei kein erklärtes Ziel, sie agitieren einfach nur gegen die Obrigkeit. In einem herrlich übertriebenen Interview stellt der ärgerliche Randy March Forderungen auf, die immer kruder werden. Geht es zunächst um den noch nachvollziehbaren Rücktritt einer Offiziellen, gesellen sich kurz darauf "Mütter", "Kyle" und die "Juden" dazu. Und natürlich darf die Forderung nach Obamas "echtem" Birth-Certificate nicht fehlen. Das Ganze findet statt, nachdem Cartman, Randy und andere ein FedEx-Büro erobert haben, die Mitarbeiter als Geiseln genommen haben und ankündigen mit der Besetzung von "Federal Express" den "Federal State" mal richtig zu schaden. Als der Interviewer fragt, ob den Besetzern eigentlich klar ist, dass "FedEx" mit dem Staat nichts zu tun hat, herrscht einmal große Ahnungslosigkeit.
Ähnlich gelungen wie die Falscheinschätzung eines staatlichen Unternehmen ist die Auflösung der vielen verärgerten Menschen in den USA. Nach Cartmans Penismessaktion wird Randy March nämlich in die vierte Staffel geschickt, um die Kinder über die Wichtigkeit der "Penisgröße" aufzuklären. Anstatt das Thema als unwichtig zu reklamieren, stellt er eine absurd kopmlizierte Formel auf, die Gewicht, Winkel, Durchmesser und ein paar weitere Variablen berücksichtigt, woraus der T.M.I. entsteht. Als die Regierung die offizielle Formel für den T.M.I. ändert, fallen auf einmal viele amerikanische Männer unter den nationalen Durchschnitt und müssen ihre Minderwertigkeitsgefühle mit dicken, fetten Autos und überbordender Agression kompensieren. Dieser durch und durch bescheuerte Handlungsstrang, der "Tea Party"-Anhänger krasse Minderwertigkeitsgefühle unterstellt, hebt sich angenehem von der durchschnittlichen und keineswegs abgedrehten Handlung der müden Vorgängerfolge ab.
Die englische Wikipedia weist zudem daraufhin, dass T.M.I. sehr nah an der Abkürzung für den Body Mass Index (B.M.I.) ist, der aus einer etwas simpleren, aber immer noch ähnlichen Formel besteht wie die in der Episode dargelegten. Somit wäre noch ein zweiter gesellschaftliche Fetisch in die Episode eingebunden.
"Tea Party"-Satire, aufgebaut auf Cartmans-Cholerik und auf dem Genital-Wahn von Jugendlichen, "T.M.I." bietet zumindest eine gute, unterhaltsame und in vielen Punkten angenehm abgedrehte Grundhandlung. Leider fehlt es der Episode dennoch an einigen Stellen am Notwendigen Pepp. Die gewünschte Kritik wird aber unterhaltsam und maßlos übertrieben rübergebracht, was für eine gute "South Park"-Folge reicht.
Die komplette (englische) Episode kann man dank des großartigen Service der Hersteller der Serie seit gestern hier kostenlos ansehen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

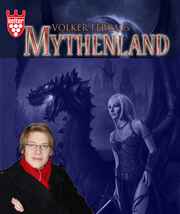 Im vergangenen September endete der erste Zyklus der Fantasy-Taschenheftserie "Mythenland", die zum größten Teil von Volker Ferkau geschrieben wurde. Der Serie wurde eine Pause verordnet, sie sollte im Januar diesen Jahres zurückkehren. Der zweite Zyklus lässt immer noch auf sich warten.
Im vergangenen September endete der erste Zyklus der Fantasy-Taschenheftserie "Mythenland", die zum größten Teil von Volker Ferkau geschrieben wurde. Der Serie wurde eine Pause verordnet, sie sollte im Januar diesen Jahres zurückkehren. Der zweite Zyklus lässt immer noch auf sich warten.Doch da er immer noch geplant zu sein scheint, muss man die bisherigen Fans an der Stange halten. Ferkau hatte dafür eine nettte Idee: Er konzipierte eine Fan-Edition, mit Kurzgeschichten von "Mythenland"-Lesern.
Das Ergebnis kann sich durchaus lesen lassen und schürt die Hoffnung, dass "Mythenland" bei der Rückkehr vielleicht mit zwei Schwächen des letzten, teilweise durchwachsenen Zyklus aufräumt.
Den ganzen Artikel gibt es auf dem Zauberspiegel zu lesen:Fans im Land der Mythen
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Inhalt: Der erste Teil endete mit einem bösen Cliffhangar. Dieser wird in dieser Episode relativ schnell abgarbeitet, Scully wird entführt, Mulder tauscht sie gegen seine Schwester aus, Entführer und Mulders Schwester verschwinden. Und da fängt die Episode erst an…
Kritik: Im zweiten Teil passiert enorm viel. Mulder und Scully erfahren die Hintergründe des außerirdischen Attentäters. Wobei Hintergründe etwas hochgestochen ist. Sie erfahren, dass er ein außerirdischer Attentäter ist und das ist schon einiges.
Außerdem wird die Existenz Außerirdischer unter den Menschen enthüllt. Mulder wird tatsächlich mit einer wahren Kolonie an Außerirdischen konfrontiert. Deren Problem: Sie sehen alle gleich aus. Mulders Schwester diente aber als Hilfe. Durch sie konnte auch eine weibliche Form mit ihrem Aussehen erschaffen werden. Das ist nicht gerade leicht für Mulder.
Nicht leicht für Mulder ist aber auch, dass alle Beweise für diese Kolonie wieder vernichtet werden. Der Attentäter erwischt alle Außerirdischen, Mulder überlebt nur knapp. Auch in der darauffolgenden Expedition an den Nordpol kann Mulder keine Beweise finden. Dafür hat er zum Ende aber wieder seinen „gestärkten Glauben“ aus der ersten Staffel und zweifelt nicht mehr an der Existenz seiner Mission wie zu Beginn der zweiten Staffel.
Zum Schluss ist Scully leider nicht überzeugt von der Geschichte. Das ist schade, schließlich hat sie mittlerweile genug gesehen, um die Ereignisse zu glauben. Außerdem war sie es doch, die zuerst etwas an dem grünen Schleim und dem CIA-Agenten merkwürdig fand. Ihr Verhalten ist hier mehr als merkwürdig.
Der Zweiteiler zeigt, wie viel Unterstützung Mulder mittlerweile durch FBI-Chef Scinner erfährt. Er setzt sich hier mehrfach für das Team Mulder/Scully ein. Teilweise geht er dabei herbe Risiken ein. Diese – logische – Weiterentwicklung ist schön. Auch für Scinner muss es ätzend sein, dass viel um ihn herum vorgeht, ohne dass er etwas dagegen tun kann.
Viel scheint in den USA nämlich vorzugehen. Das Raumschiff des Fremden wird mal eben beschossen, ohne überhaupt Kontakt aufzunehmen. Dabei wird ein U-Boot der Strom genommen, alle Besatzungsmitglieder sterben. Trotzdem werden mehr Einheiten dahin geschickt. Hier geht ein Krieg vor, ohne dass die Beteiligten überhaupt wissen, gegen wen sie kämpfen.
Leider ist diese Episode extrem überlastet. Es geschieht soviel – Mulders Familientragödie ist noch nicht einmal erwähnt – dass kaum Spannung aufkommt. So werden zwar viele Informationen in der Episode rübergebracht und die Handlung ist wirklich gut, aber diesmal schwächelt die Inszenierung. Daher kommt die Episode „nur“ auf eine sehr gute Wertung, obwohl sie vom Inhalt eigentlich die Höchstpunktzahl verdient hätte. 4 von 5 Punkten.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
