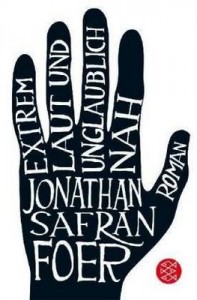 Oskar hat eine sehr innige Beziehung zu seinem Vater. Dieser fällt den Anschlägen des 11. September 2001 zum Opfer. Oskar weiß und versteht nicht, warum sein Vater sich an diesem Tag im World Trade Center befand. Außerdem hört er auf dem Anrufbeantworter einige Nachrichten, die sein Vater wenige Momente vor seinem dort hinterlassen hat. Er versteckt sie vor allen anderen und durchsucht die Sachen seines Vaters nach einem Grund für den Aufenthalt im World Trade Center. Oskar zerstört dabei versehentlich eine Vase, in der sich ein Schlüssel und der Hinweis "Black" befinden. Oskar sucht von nun an nach dem Schloss für den Schlüssel. In New York ist das keine einfache Aufgabe.
Oskar hat eine sehr innige Beziehung zu seinem Vater. Dieser fällt den Anschlägen des 11. September 2001 zum Opfer. Oskar weiß und versteht nicht, warum sein Vater sich an diesem Tag im World Trade Center befand. Außerdem hört er auf dem Anrufbeantworter einige Nachrichten, die sein Vater wenige Momente vor seinem dort hinterlassen hat. Er versteckt sie vor allen anderen und durchsucht die Sachen seines Vaters nach einem Grund für den Aufenthalt im World Trade Center. Oskar zerstört dabei versehentlich eine Vase, in der sich ein Schlüssel und der Hinweis "Black" befinden. Oskar sucht von nun an nach dem Schloss für den Schlüssel. In New York ist das keine einfache Aufgabe."Extrem laut und unglaublich nah" erzählt die Geschichte einer ziemlich verstörten Familie. Oskar und seine Mutter leiden unter dem Verlust des Vaters. Dabei gelingt es Oskar über lange Zeit nicht, seiner Mutter offen gegenüber zu treten. Stattdessen nimmt er es ihr übel, dass sie überlebt hat und das lässt er sie an einigen Stellen deutlich spüren. Die Großmutter hat ihren Sohn verloren. Im Lauf des Romans stellt sich jedoch heraus, dass ihr Leben schon immer schwierig war. Oskars Großvater verließ die Familie noch vor der Geburt seines Sohnes. Bei ihm handelt es sich um eine sehr verletzte und dadurch sehr verstörte Person. In Deutschland war er in die Schwester von Oskars Großmutter verliebt, die bei dem Bombenangriff auf Dresden umkam. Seitdem redet er nicht mehr. Stumm lernte er Oskars Großmutter kennen und führt mit ihr eine äußerst merkwürdige Beziehung.
Diese Zusammenhänge in der Familie bekommt man erst im Verlauf des Romans mit. Dabei werden die Kapitel aus Oskars Perspektive erzählt. Zwischendurch gibt es jedoch immer wieder Briefe des stummen Großvaters und der Großmutter, die zusammen vermutlich die Hälfte des Romans ausmachen. Aus diesen drei Perspektiven kann man sich im Lauf des Romans einen Großteil der etwas traurigen Familiengeschichte konstruieren.
Oskars Suche ist dennoch das Spannendste an dem Roman. Die Geschichte der Großeltern um Krieg und unausgesprochene Gefühle bleibt zu fantastisch, als dass sie wirklich mitreißen würde. Die ständigen Besuch Oskars bei fremden Leuten, denen er mit seinen kindlichen Gedanken gegenübertritt, sind hingegen sehr gelungen. Seine Perspektive ist sehr gut dargestellt und es ist häufig amüsant, wie er die Gespräche mit fremden Menschen führt.
Der Roman ist sehr interessant gestaltet Foer spielt mit vielen Fotos, farblichen und textlichen Elementen. Das lockert die Lektüre auf und hilft über die teilweise anstrengenden Stellen der schweigsamen, artikulationsarmen Großeltern hinweg. Doch obwohl die Deutschland-Geschichte der Großeltern etwas übertrieben wirkt, sind die Gefühle vor allem der Großmutter sehr überzeugend dargestellt. Die Beziehung zwischen ihr und Oskar ist sehr gelungen.
Foer bietet mit "Extrem laut und unglaublich nah" einen berührenden Roman, der einen kreativen Jungen bei der Verarbeitung seiner Trauer zeigt. Der Roman kann kein Happy End aufweisen, weil sowohl der Tod Oskars Vater als auch die Stille zwischen den Großeltern nicht rückgängig zu machen sind. Stattdessen müssen sowohl Oskar als auch seine Großeltern damit Leben lernen, wie die Dinge gelaufen sind. Auch das kann selbstverständlich nicht zur Gänze gelingen, es kann nur ertragen werden. Dies schildert Foer auf unterhaltsame und lesbare Art und Weise.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Maik Klingenberg ist 14 und in der Schule eher unauffällig. Er wohnt mit seinen Eltern in Ostberlin, sein Vater scheint sich gerade auf dem Immobilienmarkt verspekuliert zu haben. Seine Mutter ist Alkoholikerin und muss deswegen regelmäßig Therapien besuchen. Die Beziehung zwischen den Eltern scheint recht zerrüttet. Da Maik mit der Sucht seiner Mutter relativ offen umgeht, erhält er von seinen Mitschülern den Spitznamen "Psycho". Er schwärmt, ohne sie richtig zu kennen, von seiner Mitschülerin Tajana. Für sie ändert er seinen Musikgeschmack und bereitet sich mit einem aufwendigen Geschenk auf ihre Feier vor. Um so größer ist daher die Enttäuschung als er nicht eingeladen wird. In seiner Klasse befindet sich ein Mitschüler, der aus Russland gekommen ist. Er wird von allen Tschick genannt. In den Ferien klaut Tschick ein Auto und fordert Maik auf, mit ihm mitzufahren. Maik, der wegen der nicht erfolgten Einladung und der Abwesenheit seiner Eltern sehr frustriert ist, folgt Tschick und gemeinsam wollen sie in die Walachei fahren.
Maik Klingenberg ist 14 und in der Schule eher unauffällig. Er wohnt mit seinen Eltern in Ostberlin, sein Vater scheint sich gerade auf dem Immobilienmarkt verspekuliert zu haben. Seine Mutter ist Alkoholikerin und muss deswegen regelmäßig Therapien besuchen. Die Beziehung zwischen den Eltern scheint recht zerrüttet. Da Maik mit der Sucht seiner Mutter relativ offen umgeht, erhält er von seinen Mitschülern den Spitznamen "Psycho". Er schwärmt, ohne sie richtig zu kennen, von seiner Mitschülerin Tajana. Für sie ändert er seinen Musikgeschmack und bereitet sich mit einem aufwendigen Geschenk auf ihre Feier vor. Um so größer ist daher die Enttäuschung als er nicht eingeladen wird. In seiner Klasse befindet sich ein Mitschüler, der aus Russland gekommen ist. Er wird von allen Tschick genannt. In den Ferien klaut Tschick ein Auto und fordert Maik auf, mit ihm mitzufahren. Maik, der wegen der nicht erfolgten Einladung und der Abwesenheit seiner Eltern sehr frustriert ist, folgt Tschick und gemeinsam wollen sie in die Walachei fahren.Herrndorf trifft den Ton seines Ich-Erzählers sehr gut. Man hat tatsächlich das Gefühl, die Welt aus den Augen eines nicht sonderlich hellen 14-jährigen zu erleben. Dabei ist Maik in vielen Dingen verrückt genug, um tatsächlich mit einem geklauten Auto durch Ostdeutschland zu fahren, Benzin zu klauen und sich bei fremden Leuten durchzuschnorren. Auch seine Einstellung gegenüber seinen Eltern und den Menschen, denen sich begegnen, wirkt sehr glaubwürdig und ist eine große Stärke des Romans.
Auf ihrer Reise begegnen Tschick und Maik eine Reihe skurriler Gestalten. Die kurzen Kapitel sorgen dafür, dass die Begegnungen immer kurzweilig bleiben und bis zum Schluss unterhaltsam bleiben. Dabei erstaunt der Einfallsreichtum, der teilweise etwas ungeschickt agierenden Jungen. Auch die Hilfsbereitschaft vieler Menschen überrascht ein wenig. Der Buchrücken verspricht, dass man ein unbekanntes Deutschland kennenlernt. Das ist leider eines der Versprechen, die für einen Roman völlig unangebracht ist. Denn da er nichts dokumentarisches hat, bleibt es eine Phantasie. Die mag an reale Begebenheiten angelehnt sein, es ist jedoch nicht so, dass man nach dem Roman mehr über die durchfahrene Gegend weiß. Stattdessen wirkt es eher befremdlich, mit welcher Selbstverständlichkeit die beiden 14(!)-jährigen durch verlassene Dörfer fahren können, ohne bemerkt zu werden.
Das ist dann jedoch wieder das sympathisch anarchische, was dem Roman anheftet. Was gerade notwendig ist, tun die Jungen, ansonsten machen sie sich nicht viele Gedanken. Es ist schön herausgearbeitet, wie Maiks Selbstbewusstsein mit der Fahrt zu nimmt. Bei Tschick erlebt er zum ersten Mal, dass ein Mensch ihn nicht für langweilig und feige hält - ein Bild, das Maik von sich selbst hat. Die letzten Szenen machen deutlich, dass Maik dadurch an Stärke gewinnt und sich besser gegen die Welt und vor allem seine ihn nicht verstehenden Mitschüler behaupten kann. Gerade diese Entwicklung ist sehr schön dargestellt und wirkt länger an, als die teilweise etwas bemüht witzigen Szenen. Ob
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

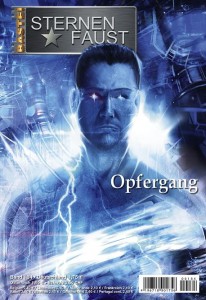 Das Finale des "Gemini"-Zyklus weist leider etwas zu viele "Opfergänge" auf, wodurch die Spannung etwas leidet. Dafür wird der Leser aber ausreichend mit einer Überraschung entschädigt, die die Serie wohl eine ganze Weile in Atem halten wird: Die Serie verlässt die heimatliche Galaxie und bricht zu neuen Ufern auf.
Das Finale des "Gemini"-Zyklus weist leider etwas zu viele "Opfergänge" auf, wodurch die Spannung etwas leidet. Dafür wird der Leser aber ausreichend mit einer Überraschung entschädigt, die die Serie wohl eine ganze Weile in Atem halten wird: Die Serie verlässt die heimatliche Galaxie und bricht zu neuen Ufern auf.Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Sternenfaust Band 184 - Opfergang (von Andreas Suchanek)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Eine alte Frau wünscht sich vor ihrem Tod nichts sehnlicher, als die Erde noch einmal zu sehen. Das ist jedoch unmöglich. Denn schon vor vielen Jahren wurde die Erde als Legende eingestuft und Wissenschaftskommissionen haben herausgefunden, dass die Menschheit gleichzeitig auf vielen verschiedenen Planeten entstanden ist. Doch da die Frau viel zahlen kann, nimmt sie Captain Andrews mit. Zusammen mit seinem Mannschaftsmitglied Norton fliegen sie einen Planeten an, der die Erde sein könnte. Es ist der dritte Planet in einem 9-Planeten-System. Der Planet ist völlig leblos. Die alte Frau ist deutlich enttäuscht und stirbt dort. Norton ist ob des Betruges sehr erzürnt und verlässt die Mannschaft, verzichtet sogar auf seinen Anteil an dem großen Beförderungsgeld der alten Dame. Bevor Andrews den Planeten verlässt, findet er noch eine alte Münze - mit einem lateinischen Spruch.
Eine alte Frau wünscht sich vor ihrem Tod nichts sehnlicher, als die Erde noch einmal zu sehen. Das ist jedoch unmöglich. Denn schon vor vielen Jahren wurde die Erde als Legende eingestuft und Wissenschaftskommissionen haben herausgefunden, dass die Menschheit gleichzeitig auf vielen verschiedenen Planeten entstanden ist. Doch da die Frau viel zahlen kann, nimmt sie Captain Andrews mit. Zusammen mit seinem Mannschaftsmitglied Norton fliegen sie einen Planeten an, der die Erde sein könnte. Es ist der dritte Planet in einem 9-Planeten-System. Der Planet ist völlig leblos. Die alte Frau ist deutlich enttäuscht und stirbt dort. Norton ist ob des Betruges sehr erzürnt und verlässt die Mannschaft, verzichtet sogar auf seinen Anteil an dem großen Beförderungsgeld der alten Dame. Bevor Andrews den Planeten verlässt, findet er noch eine alte Münze - mit einem lateinischen Spruch.Andrews ist ein skruppelloser Geschäftsmann, der nicht davor zurückschreckt, einer alten, sterbenden Frau gegen viel Geld alles zu versprechen. So belügt er sie und präsentiert ihr eine Erde, von der er nicht weiß, ob es wirklich die Erde ist. Ohne Gewissensbisse versichert er der Frau mehrfach, dass sie sich auf der Erde befindet. Erst als sie stirbt, regen sich auch in ihm Gefühle. Norton wiederum hat von vornherein Probleme mit seinem Gewissen, lässt sich jedoch von Andrews leicht in die Sache mit hineinziehen. Zumal man stellenweise das Gefühl hat, dass Nortons Gewissensbisse zunächst lediglich vorgeschoben sind. Er erwähnt nämlich auch, dass es rechtliche Probleme geben könnte, wenn man einem zahlenden Gast etwas verspricht, was man gar nicht leisten kann.
In wenigen Sätzen gelingt es Dick auch in dieser Kurzgeschichte wieder ein Universum zu erschaffen, das neugierig macht. Die Menschheit ist offensichtlich weit zu den Sternen gereist, sie denkt sogar, sie käme aus mehreren Sonnensystemen. Außerdem wird angedeutet, dass es sowohl eine strikte Wirtschaftsregulierung gibt als auch Kriege zwischen verschiedenen menchschlichen Fraktionen. Wie so oft, bleibt es jedoch bei den Andeutungen. Die Hinweise dienen lediglich dazu, der Kurzgeschichte ein Fundament zu geben.
Die Kurzgeschichte wird beinahe etwas witzig dadurch, dass Andrews die Erde tatsächlich gefunden hat. Zumindest deutet die Münze stark darauf hin. Letztendlich hat Andrews also genau das getan, wofür er bezahlt wurde. Nur scheint die Menschheit die Erde völlig zerstört zu haben. Dies wiederum ist ein bekanntes Motiv aus vielen von Dicks Kurzgeschichten.
"Der unmögliche Planet" spielt ein wenig mit der Vorstellung, dass die Menschheit ihre (zerstörte) Heimat vergessen hat. Das liest sich ganz nett, vor allem weil es offensichtlich genügend Menschen gibt, die ihre Gier nicht vergessen haben. Die Geschichte ist jedoch weniger unterhaltend und vielschichtig als vorherige Kurzgeschichten.
“Der unmögliche Planet", 13 Seiten, 1953, erschienen in der Zweitausendeins Anthologie “Variante Zwei”.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
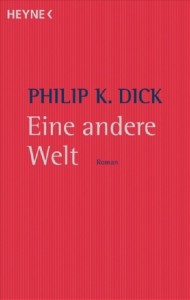 Jason Taverner hat eine erfolgreiche Fernsehshow in einem Polizeistaat. Außerdem ist er ein genau so erfolgreicher Sänger und wird von den Frauen geliebt. Eine Frau, die er ausnutzt, rächt sich jedoch an ihm und verletzt ihn. Anstatt im Krankenhaus wacht er in einem heruntergekommenen Hotel auf. Dort muss er feststellen, dass seine Ausweispapiere verschwunden sind. Das bedeutet in dem Staat automatisch eine Einweisung in ein Zwangsarbeitslager. Doch Taverners Akte ist ebenfalls verschollen. Somit dürfte er in der autoritären Bürokratie gar nicht existieren.
Jason Taverner hat eine erfolgreiche Fernsehshow in einem Polizeistaat. Außerdem ist er ein genau so erfolgreicher Sänger und wird von den Frauen geliebt. Eine Frau, die er ausnutzt, rächt sich jedoch an ihm und verletzt ihn. Anstatt im Krankenhaus wacht er in einem heruntergekommenen Hotel auf. Dort muss er feststellen, dass seine Ausweispapiere verschwunden sind. Das bedeutet in dem Staat automatisch eine Einweisung in ein Zwangsarbeitslager. Doch Taverners Akte ist ebenfalls verschollen. Somit dürfte er in der autoritären Bürokratie gar nicht existieren.Philip K. Dick macht an vielen Stellen deutlich, dass die Geschichte in den USA spielt. Der Polizeistaat sei zwar weltumspannend, doch sein Ausgangspunkt waren die Vereinigten Staaten. Der Klappentext verkündet, dass der Roman eine Reaktion auf die Machenschaften der Nixon-Regierung waren und dass das FBI Dick sogar wegen des Manuskripts beschattete. Dafür birgt der Text relativ wenig Sprengkraft. Denn das Regime ist zwar glaubwürdig geschildert, aber doch so ausgefeilt, dass viel geschehen muss, damit so etwas geschieht.
Der Roman ist, wie die meisten Kurzgeschichten Dicks auch, spannend und gut zu lesen. Von der ersten bis zur letzten Seite fiebert man mit Taverner mit, der sich durch einen Dschungel aus Überwachung, Korruption und skurrilen Gestalten kämpfen muss. Obwohl der Roman auf den ersten Blick leicht und etwas oberflächlich wirkt, beweist er an vielen Punkten Vielschichtigkeit.
Noch heute aktuell ist die Frage, was ein Mensch ohne Papiere eigentlich wert ist. Geschichten Staatenloser Menschen, die von einem Land ins andere abgeschoben werden, gibt es noch heute. Das Entsenden in ein Zwangsarbeitslager wirkt zwar brutal, ähnelt in gewisser Weise aber dem Umgang, den auch die BRD mit Immigranten ohne gültige Papiere betreibt. Interessant ist, dass das Regime bewusst anti intellektuel eingestellt ist. Studenten und Dozenten werden in den Universitäten quasi eingesperrt. Der Umgang mit ihnen ist allen anderen verboten. Daher hat jeder Angst vor diesen Menschen. Unklar ist jedoch, wie die Universitäten so lange überleben konnten, wenn sie doch von der Außenwelt abgeschnitten sind. Wahrscheinlich sind die Forschungsergebnisse für den Staat trotz allem wichtig, er will nur verhindern, dass die freie Atmosphäre, die für Forschungen notwendig ist, auf den Rest des Landes überschwappt.
Der Roman ist auch deswegen interessant, weil er gar nicht erst die Überlegung anstellt, dass das System verändert werden könnte. Nach einem Bürgerkrieg erlangte die Polizei so viel Macht, dass sie de Kontrolle übernahm. Mithilfe von Daten erfassenden Computern kontrolliert sie das ganze Land und jedes Individuum. Jason Taverner ist ein sehr egozentrischer Mensch, dem es in erster Linie darum geht, seine frühere Bekanntheit wieder herzustellen und zu seinen Frauen zurückzukehren. Er verschwendet daher nie einen Gedanken daran, dass das System nicht in Ordnung ist. Diese Überlegungen wurden der Bevölkerung scheinbar erfolgreich ausgetrieben, da sie die derzeitige Ordnung als völlig normal und richtig ansehen. "Eine andere Welt" setzt also dort an, wo das Regime in "1984" erst noch hin wollte.
Stattdessen entpuppt sich zum Schluss die Drogeneinnahme als wichtiges Thema des Buches. Hier sind genetische und biologische Experimente so weit, dass Drogen ganze Alternativwelten erschaffen können, die nicht nur den Einnehmer der Droge mitreißen, sondern auch sein gesamtes Umfeld. Dieser Handlungsstrang wirkt gering, ist aber letztendlich die Erklärung für die fantastischen Vorgänge um den Verlust Taverners Existenz. Es dauert eine Weile, bis man realisiert, einem Drogenrausch beigewohnt zu haben.
Zusätzlich gibt es noch eine Reihe versteckter Nebenhandlungen. So werden am Rande genetische Experimente, deren Produkt Taverner ist, genau so erwähnt, wie die Art, wie in der "anderen Welt" gewirtschaftet wird.
Wirklich gelungen ist das Ende. Denn es ist eigentlich - für Dick völlig untypisch - gut für Jason Taverner. Es kommt dorthin zurück, wo er begonnen hat. Er hat sein Ziel also erreicht. Ein Epilog beschreibt jedoch das weitere Schicksal der Charaktere und dadurch wird deutlich: In dem System kann niemand glücklich werden. Lediglich eine Ausnahme bestätigt diese Regelung. So präsentiert Dick einen spannenden und ausgefeilten Roman, der eindringlich davor warnt, die bürgerlichen Freiheiten zu achten und zu bewahren.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
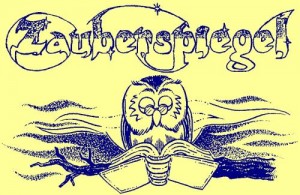
Um die Große Leere zu verhindern, rebootete Dana Frost am Ende des letzten Zyklus quasi das Universum. Das war ein schwerer Schock. Denn die Erlebnisse aus 75 Heften waren vorerst aus der Serie getilgt.
Mit der Rückkehr zur Sternenfaust II schien es jedoch auch so, dass die Handlung der Serie wieder etwas bodenständiger wird. Daraus ist nichts geworden. Dafür hat sich die Serie in einer anderen Art stark verändert: Sie ist persönlicher geworden. Die Große Leere hält das bisher allerdings nicht auf.
Weiterlesen auf dem Zauberspiegel
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

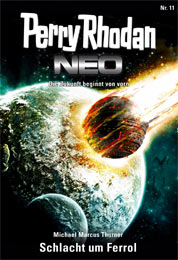 "Schlacht um Ferrol" lässt den Leser die Ereignisse nach Perry Rhodans Absturz über Ferrol erleben. Dabei geschieht eigentlich gar nichts, außer, dass Rhodan die Hauptstadt erreicht und ein paar Menschen von Topsidern gefangen genommen werden. Stattdessen darf man sich über einen eitlen, überheblichen und doch irgendwie unfähigen Rhodan ärgern. Eine Nebenhandlung auf der Erde ist ganz gelungen, bringt in der Fantan-Geschichte jedoch ebenfalls keine Fortschritte. Immerhin zeigt dieser Handlungsstrang, dass die Menschheit noch für nichts bereits ist, was Rhodan für sie plant.
"Schlacht um Ferrol" lässt den Leser die Ereignisse nach Perry Rhodans Absturz über Ferrol erleben. Dabei geschieht eigentlich gar nichts, außer, dass Rhodan die Hauptstadt erreicht und ein paar Menschen von Topsidern gefangen genommen werden. Stattdessen darf man sich über einen eitlen, überheblichen und doch irgendwie unfähigen Rhodan ärgern. Eine Nebenhandlung auf der Erde ist ganz gelungen, bringt in der Fantan-Geschichte jedoch ebenfalls keine Fortschritte. Immerhin zeigt dieser Handlungsstrang, dass die Menschheit noch für nichts bereits ist, was Rhodan für sie plant.
Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Perry Rhodan Neo 11 - Schlacht um Ferrol (von Michael Marcus Thurner)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
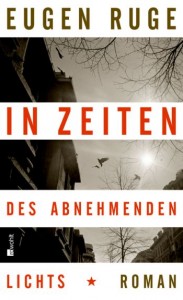 2001 stielt Alexander kurz nach seiner Krebsdiagnose seinem pflegebedürftigem Vater eine Menge Geld und fliegt nach Mexiko. Der Leser darf währenddessen die Geschichte Alexanders Familie erleben. Die Großeltern kehren aus dem mexikanischen Exil in den 50er Jahren in die DDR zurück. Alexanders Eltern kehren aus Russland, wo sein Vater interniert war, kurz darauf ebenfalls in die DDR zurück, wo Alexander aufwächst. Zwischen den einzelnen Episoden taucht immer wieder der 1. Oktober 1989 auf. Dies ist Willhelms 90. Geburtstag. Willhelm ist der Stiefgroßvater Alexanders. Dieser Tag wird aus der Sicht verschiedener Familienmitglieder gleich mehrfach geschildert.
2001 stielt Alexander kurz nach seiner Krebsdiagnose seinem pflegebedürftigem Vater eine Menge Geld und fliegt nach Mexiko. Der Leser darf währenddessen die Geschichte Alexanders Familie erleben. Die Großeltern kehren aus dem mexikanischen Exil in den 50er Jahren in die DDR zurück. Alexanders Eltern kehren aus Russland, wo sein Vater interniert war, kurz darauf ebenfalls in die DDR zurück, wo Alexander aufwächst. Zwischen den einzelnen Episoden taucht immer wieder der 1. Oktober 1989 auf. Dies ist Willhelms 90. Geburtstag. Willhelm ist der Stiefgroßvater Alexanders. Dieser Tag wird aus der Sicht verschiedener Familienmitglieder gleich mehrfach geschildert."In Zeiten des abnehmenden Lichts" ist ein großartiger, vielschichter Familienroman. Die einzelnen Szenen liegen häufig mehrere Jahre auseinander. Dadurch bleiben viele Lücken zurück, die der Leser sich selbst erschließen muss. Jede Szene wird strikt aus der Sicht eines einzelnen Charakters erzählt. Doch obwohl die Ereignisse nicht linear geschildert werden, fühlt man sich jedem Familienmitglied nach wenigen Zeilen sehr nah.
Der Roman erweckt dabei den Eindruck, ein "normales" Bild der DDR zu schildern. Das ist natürlich schwierig zu beurteilen, wenn man den DDR-Alltag nicht selbst erlebt hat. Da der Autor jedoch selbst in der DDR aufwuchs und wie Alexander kurz vor der Wende floh, dürften einige authentische Merkmale in dem Roman enthalten sein. Außerdem erweckt der Roman einen differenzierten Eindruck, da er sowohl glühende Regimeanhänger (Willhelm), Mitläufer mit stummer kritischer Einstellung (Alexanders Vater) als auch Kritiker (Alexander) darstellt.
Dabei werden ernste und in der Öffentlichkeit noch immer unbekannte Themen in beeindruckender Einfachheit erzählt. Die Familie besteht nämlich nicht nur aus starken männlichen Persönlichkeiten, sondern auch aus eben so starken weiblichen Familienmitgliedern. In allen Fällen ist es jedoch so, dass die Männer die Anerkennung und die Karriere machen, während die Frauen zurückbleiben. Gleichzeitig müssen sie die ganze Zeit das Lob über die ach so emanzipierte DDR über sich ergehen lassen. Dabei ist sich vor allem die Großmutter Charlotte dieser widersprüchlichen Dialektik bewusst. Sie ist auch die einzige, die zwar eine steile Karriere im Wissenschaftsbetrieb macht, aber dennoch immer hinter ihrem im Berfusleben versagenden Mann zurückstecken muss, der als Parteifunktionär viel mehr Anerkennung findet als sie, die doppelte Arbeit (Wissenschaft und Haushalt) leisten muss. Sie ist darüber sehr verbittert, würde es jedoch nie laut äußern, da sie von der kommunistischen Ideologie sehr eingenommen ist. Dennoch wird im Laufe des Romans deutlich, dass sie zunehmend verbittert. Dass jedes männliche Familienmitglied notorisch untreu zu sein scheint, ist der einzige Punkt, der in dem Roman etwas übertrieben wirkt. Er unterstreicht die Ungerechtigkeit, die den Frauen geschieht jedoch noch.
Alle Charaktere erleben die Sinnlosigkeit des DDR-Staates an bestimmten Punkten. Und zum Schluss erkennen dies auch alle, selbst wenn sie es nach außen nicht wahrhaben wollen. Lediglich der Großvater Willhelm, ein großer Egozentriker, hetzt noch wenige Momente vor seinem Tod gegen angebliche Verräter am Sozialismus.
Obwohl der Roman an vielen Stellen amüsant ist, weil er zum Beispiel im DDR-Alltag oder in Familienbegegnungen skurile Situationen herausarbeitet, bleibt er doch eine Familientragödie. Denn glücklich ist in der Familie niemand. Untereinander gelingt es den Familien nicht, ein verständnisvolles Verhältnis zueinander aufzubauen, was in erster Linie daran liegt, dass die Lebenserfahrungen enorm unterschiedlich sind. Die stärksten und berührendsten Szenen des Romans sind daher auch die, an denen der gerade "erzählte" Charakter ein anderes Familienmitglied einfach nicht verstehen kann, sich jedoch nicht in der Lage sieht, mit diesem darüber zu reden.
"In Zeiten des abnehmenden Lichts" ist die Geschichte einer Familie, die sich mit jeder Generation weiter von einer Ideologie entfernt, nie zusammenfindet und in der letztendlich jeder alleine unglücklich ist. Das ist auf berührende, teils skurrile aber immer authentisch wirkende Art erzählt und fesselt daher von Anfang bis Ende.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
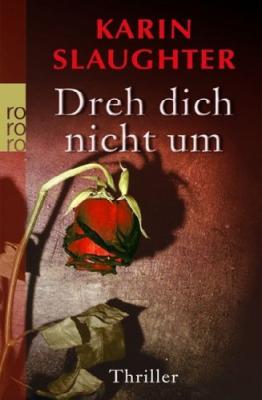 Auf dem Campus der Universität von Grand County wird die Leiche eines Studenten gefunden. Alles deutet darauf hin, dass er sich von einer Brücke gestürzt hat. Als Gerichtsmedizinerin Sarah Linton eintrifft, wird jedoch ihre schwangere Schwester Tesse auf dem Weg zur Toilette von einem Unbekannten schwer verletzt. In den Tagen darauf mehren sich die Selbstmorde an der Universität. Jeffrey Tolliver, der Polizeichef, will bald nicht mehr an Zufälle glauben und geht von Mord aus.
Auf dem Campus der Universität von Grand County wird die Leiche eines Studenten gefunden. Alles deutet darauf hin, dass er sich von einer Brücke gestürzt hat. Als Gerichtsmedizinerin Sarah Linton eintrifft, wird jedoch ihre schwangere Schwester Tesse auf dem Weg zur Toilette von einem Unbekannten schwer verletzt. In den Tagen darauf mehren sich die Selbstmorde an der Universität. Jeffrey Tolliver, der Polizeichef, will bald nicht mehr an Zufälle glauben und geht von Mord aus."Dreh Dich nicht um" weist einen schwachen Plot auf. Studenten werden umgebracht, sie alle gehören irgendwie zusammen. Der Leser weiß rasch, dass es sich nicht um Zufälle handeln kann. Daher ist es keine Überraschung, als auch Beweise dafür auftauchen. Die vermeintlichen Selbstmorde sind skurril und gruselig. Hier setzt Karin Slaughter auf das bewährte Konzept, das ihren Nachnamen zum Programm macht.
Wie die vorherigen Bände wird auch diese Handlung durch die gelungenen Charaktere getragen und gerettet. Die ehemalige Polizistin Lena Adams arbeitet nun bei der Campuspolizei. Seit schweren Verwundungen und der Ermordung ihrer Schwester im ersten Roman der Reihe hat sie ernsthafte psychische Probleme. Dieser Roman konzentriert sich stark auf Lena. Deren irrationales und häufig selbstschädigendes Verhalten, ärgert häufig beim Lesen, wirkt im Rahmen dessen, was Lena durchgemacht hat, jedoch sehr glaubwürdig.
Auch die Beziehung zwischen Jeffrey und Sarah bleibt weiter spannend. Slaughter gelingt es, in mitten des Ganzen Wahnsinns noch Platz für Normalität zwischen den beiden zu schaffen. Die Versuche von Jeffrey und Sarah, so etwas wie Alltag zwischen den schrecklichen Ereignissen zu erleben, sind sehr gut zu lesen. Auch der Zorn, der in Sarahs Familie über Tessas Verletzung und den damit verbundenen Verlust des Kindes ausbricht, ist sehr überzeugend geschrieben.
Neben den drei wichtigsten Figuren, nimmt sich Slaughter auch die Zeit, sich mit den Nebenfiguren Grant Counties auseinanderzusetzen. In diesem Roman geht es dabei vor allem um häusliche Gewalt und wie damit umzugehen ist. Gerade die Schilderungen einer Psychologin, die sich selbst zu Hause dem Einfluss eines gewalttätigen, männlichen Arschloches nicht erwehren kann, sind dabei besonders eindringlich. Neben Sarah, Jeffrey und Lena wird der Roman also um die Schicksale vieler Bewohner und Kleinkrimineller des Counties angeheizt.
"Dreh dich nicht um" kann nicht mit einem klugen Fall überzeugen. Es ist zwar ein ordentliches Maß an Spannung vorhanden, doch die Idee kommt nicht an die vorherigen Romane heran. Überzeugende und sympathische Charaktere, ein Geflecht aus Nebencharakteren und eine intensiv geschilderte Behandlung des Themas häusliche Gewalt machen den Roman dennoch zu einer spannenden und erschreckenden Lektüre.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
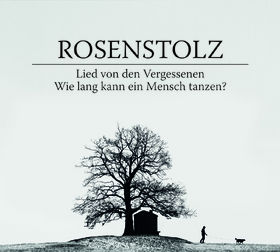 Seit Freitag ist die neue Rosenstolz-Single "Lied von den Vergessenen" im Handel. Das Single-Lied selbst ist bereits von dem Album "Wir sind am Leben" bekannt. Spannend ist hingegen - wie bei jeder Rosenstolz-Single, das neu geschriebene Lied, das in diesem Fall den Titel "Wie lang kann ein Mensch tanzen?" trägt.
Seit Freitag ist die neue Rosenstolz-Single "Lied von den Vergessenen" im Handel. Das Single-Lied selbst ist bereits von dem Album "Wir sind am Leben" bekannt. Spannend ist hingegen - wie bei jeder Rosenstolz-Single, das neu geschriebene Lied, das in diesem Fall den Titel "Wie lang kann ein Mensch tanzen?" trägt.Das Lied beginnt mit sanften Klavierklängen. Später werden Schlagzeug und Bass durch sanft eingesetzte Bläser ergänzt. Die Bläser werden an einigen Stellen betont eingesetzt, um bestimmte Textausschnitte zu betonen. Die Hintergrundmusik würde sich für sich wohl ganz gut zum Tanzen eignen, wodurch sie zu dem Motto des Liedes passt.
"Wie lang kann ein Mensch tanzen?" greift die Frage auf, was Menschen mit Ablenkung bezecken. Wenn ich morgens nach Haus komm, dann fall ich in ein Loch, sind die ersten Zeilen des Liedes. Das Zuhause-, das Alleinsein scheint hier eine große Schwierigkeit zu sein, auch wenn kurz darauf beteuert wird, dass dieses Loch noch immer überwunden werden kann. In der zweiten Strophe wird dann eine andere Seite skizziert: Viel reden, immer da sein. So wird der vermutlich fröhlich wirkende Auftritt beim Ausgehen beschrieben.
Darauf folgt der nachdenkliche Refrain. Wie lang kann ein Mensch tanzen? Wie viel Kraft hat ein Lied?. Daran schließt sich der Wunsch ein Stück vom Ganzen zu erhalten an. Die folgenden Zeilen erstellen ein wenig einen Bogen zu dem "Lied von den Vergessenen". Hier geht es nämlich um die Frage, ob überhaupt jemand etwas davon mitbekommt, was man gerade tut. Ob das jemand hier sehn kann, ob das jemals einer erkennt.
Die dritte und vierte Strophe beschäftigen sich mit Selbstzweifeln. Vielleicht hab ich zu lang getanzt, vielleicht hab ich den Zug verpasst. Tanzen wird auch hier wieder als zeitlich begrenzte Aktivität aufgefasst, die zwar noch ausgeübt wird, aber irgendwann beendet werden muss. Der richtige Moment für den Absprung ist jedoch unklar, dürfte aber mit dem persönlichen Wunder, das im Refrain gewünscht wird zusammenhängen. In der vierten Strophe gesellt sich Angst zu den Selbstzweifeln. Ich fürchte mich, die Nacht verinnt. Dies greift den Eingang des Liedes auf, in dem die Situation des "Nachhausekommens" skizziert wird. Die vierte Strophe endet mit der Aussage: Meine Waffen sind stumm - da löst sich kein Schuss. Was verdeutlicht, wie wenig Handlungsoptionen zur Verfügung stehen. Das Ganze Arsenal ist erschöpft.
Nach einem musikalischen Zischenspiel und der Wiederholung des Refrains werden eine Reihe von Fragen gestellt, die alle mit Wie will mich beginnen. An die Einleitung reiht sichunter anderem wenn ich nicht lustig bin? ... wenn ich nicht zu sagen hab? ... wenn ich mich nicht ertrag? an. All diese Fragen verdeutlichen noch einmal die Unsicherheit und Unzufriedenheit, die durch das "Tanzen" kaschiert werden sollen und immer wieder ausbrechen, wenn alles zum Stillstand kommt. An diesen sehr guten Moment und Höhepunkt des Liedes schließt sich leider die Aussage Sie nahm mich nur, weil es keine andre gab an. Dies ist im Kontext schwer zu erklären, für mich unverständlich und stört. Glücklicherweise schließt sich daran noch kurz die ersten Zeilen des Refrains an, was das Ende etwas rettet.
"Wie lang kann ein Mensch tanzen?" ist ein nachdenkliches Lied mit tanzbarem Rhythmus über das Kaschieren der eigenen Einsamkeit und der eigenen Probleme durch permanentes Verstellen oder wegtanzen des eigenen negativen Gemütsstatus. Dadurch wird kurzfristige Freude erzeugt, die der Gewinnung langfristiger Glückszustände jedoch im Weg steht. Insofern ist das Lied nicht nur sehr gelungen, sondern passt auch sehr gut zu der Single-Veröffentlichung "Lied von den Vergessenen".
Zu dem Lied wurde ein Kurzfilm in Barcelona produziert, von dem leider nur ein kleiner Ausschnitt frei verfügbar ist:
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Die CDU beginnt nun zusätzlich zu der Hetze auf den politischen Gegner, ihren eigenen Kandidaten Jost de Jager zu bewerben. Und weil der Name des Kandidaten noch nicht als Alliteration ausreicht, wird für ihn eine noch bessere geschaffen: Ja jetzt de jager! Klasse.
Dazu produziert die inhaltsreichste aller schleswig-holsteinischen Parteien einen unglaublich überzeugenden Werbespot. Dieses einminütige Meisterwerk hat einfach alles, was auch schon Peter Harry Carstensen aufbot, um Schleswig-Holstein zu gewinnen. Einen ländlichen Ausschnitt, einen Kandidaten, der keine politischen Themen anspricht, sondern sich nur selbst beweihräuchert und vor allem: Kinder. Dank dieser gelungenen Kombination kann man den Clip immer wieder angucken, wenn man über die politische Situation gerade verzweifelt ist. Vor allem die letzten Sekunden machen deutlich: Schlimmer kann es eigentlich nicht mehr kommen.
Der Spruch "Wählen Sie am 6. Mai den Besseren zum Ministerpräsidenten" verwirrt dann jedoch. Denn was der Jost außer mehr Alliterationen Schleswig-Holstein bescheren kann, bleibt offen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

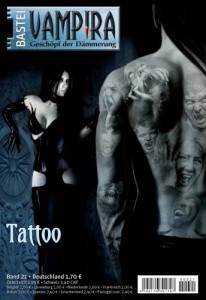 "Tatoo" spielt mit einem bekannten Bösewicht, dessen Chancen jedoch überhaupt nicht ausgenutzt werden. Das ist schade. Ansonsten werden eine Reihe von Nebenhandlungen fortgeführt, während die interessanteste jedoch ausgelassen wird. Lilith zeigt sich mal wieder als unempathisches, egoistisches und in vielen Punkten naiv-dämliches Wesen.
"Tatoo" spielt mit einem bekannten Bösewicht, dessen Chancen jedoch überhaupt nicht ausgenutzt werden. Das ist schade. Ansonsten werden eine Reihe von Nebenhandlungen fortgeführt, während die interessanteste jedoch ausgelassen wird. Lilith zeigt sich mal wieder als unempathisches, egoistisches und in vielen Punkten naiv-dämliches Wesen.Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Vampira Band 21 - Tatoo (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

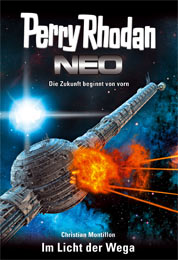 "Perry Rhodan Neo" stößt endlich in den Weltraum vor. Doch anstatt einem interessanten Weltraumabenteuer (das sowieso mit fadenscheinigen Argumenten begründet wurde) erlebt der Leser eine sinnlose Baller-Orgie. Als Ausgleich wird eine langweilige Erdhandlung angeboten, bei der außerirdische Sammler von Bull beobachtet werden. Sinnlos und langweilig ergibt keinerlei Handlungsfortschritte und viel verlorene Zeit. Das muss besser werden.
"Perry Rhodan Neo" stößt endlich in den Weltraum vor. Doch anstatt einem interessanten Weltraumabenteuer (das sowieso mit fadenscheinigen Argumenten begründet wurde) erlebt der Leser eine sinnlose Baller-Orgie. Als Ausgleich wird eine langweilige Erdhandlung angeboten, bei der außerirdische Sammler von Bull beobachtet werden. Sinnlos und langweilig ergibt keinerlei Handlungsfortschritte und viel verlorene Zeit. Das muss besser werden.Die komplette Rezension findet man auf SF-Radio:
Perry Rhodan Neo 10 - Im Licht der Wega (von Christian Montillon)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

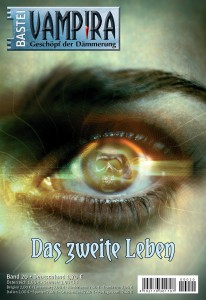 "Das zweite Leben" ist ein nett zu lesendes Zwischenspiel, in dem Lilith damit umgehen muss, dass der tote Duncan Luther zurückgekehrt ist. Der Leser erfährt zudem Kleinigkeiten aus Landrus derzeitigem Plan, Lilith zu töten und den Lilienkelch zurückzuerlangen. Wirklich schlauer ist man dadurch jedoch nicht. Das Ganze wird noch mit einem ganz normalen, stümperhaften Vampir-Plan garniert. Es wird wirklich Zeit, dass die Kerle ihren Kelch und damit auch ihr Hirn zurückbekommen.
"Das zweite Leben" ist ein nett zu lesendes Zwischenspiel, in dem Lilith damit umgehen muss, dass der tote Duncan Luther zurückgekehrt ist. Der Leser erfährt zudem Kleinigkeiten aus Landrus derzeitigem Plan, Lilith zu töten und den Lilienkelch zurückzuerlangen. Wirklich schlauer ist man dadurch jedoch nicht. Das Ganze wird noch mit einem ganz normalen, stümperhaften Vampir-Plan garniert. Es wird wirklich Zeit, dass die Kerle ihren Kelch und damit auch ihr Hirn zurückbekommen.
Die ganze Rezension findet man auf SF-Radio:
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
