 Jan Fleischhauer ist Redakteur beim Spiegel und schreibt dort seit kurzem für die Kolumne “Der schwarze Kanal”. Dort hält er, was der Name verspricht: jeden Montag wird alles links von der Union kritisiert.
Jan Fleischhauer ist Redakteur beim Spiegel und schreibt dort seit kurzem für die Kolumne “Der schwarze Kanal”. Dort hält er, was der Name verspricht: jeden Montag wird alles links von der Union kritisiert.Das ist völlig berechtigt, wenn man dem Ganzen wenigstens ein eigenes Ziel, eigene Werte entgegensetzt. Denn sonst ist man eigentlich da, wo Union und Liberale die Grünen sehen: Beim penetrantischen Dagegen.
Fleischhauer wurde vermutlich aufgrund seines Buches als Autor für den “Schwarzen Kanal” ausgewählt. 2009 veröffentlichte er rechtzeitig für die Bundestagswahl das Buch “Unter Linken – von einem der aus Versehen konservativ wurde”. Das Buch schlug hohe Wellen, es folgte ein Fernsehfilm und jetzt eben der “scharze Kanal”, auf dem Fleischhauer die Linie aus dem Buch natürlich konsequent fortführt.
Das Buch liest sich leicht und schnell. Es gibt kaum Stellen die anstrengend wirken, das Buch wirkt wie eine angenehme Abwechslung zu den sonst so umständlichen, oft langweiligen deutschen Sachbüchern.
Das liegt aber an einem Vorteil den Fleischhauer mit sich bringt: Er weiß, wo gut und wo böse ist. Denn nicht umsonst sind es immer die polarisierenden Bücher, die in Deutschland Erfolg haben. “Unter Linken” kennt nur zwei Kategorien: Links (böse) und nicht-Links (gut).
Und das ist die größte Schwäche des Buches. Die Kritik der FAZ lautete, dass Fleischhauer die Lebenswelt der 80er Jahre beschreibe, in der es solch eine klare Trennung vielleicht noch gegeben habe. Noch vor kurzem waren nicht wenig Menschen schließlich auch der Meinung, man könne sich von Begriffen wie “links” und “rechts” eigentlich gänzlich verabschieden, man habe sich ja in der Mitte getroffen. Das ist auch falsch, die Wahrheit liegt dazwischen. Nicht aber für Fleischhauer. In einigen wenigen Passagen differenziert er zwar, dass einige Thesen “nicht auf den sozialdemokratischen Gewerkschaftsfunktionär” zutreffen. Aber schon die Einordnung hat einen tendenziell negativen Beigeschmack. Mittlerweile ist es aber ja tatsächlich die Frage, was eigentlich noch Links ist. Die SPD wird von vielen seit der Agenda-Politik nicht mehr wirklich als links gesehen. Die Grünen fühlen sich in schwarz-grünen-Bündnissen immer solange wohl, bis ihr eigenes Klientel es wirklich nicht mehr aushält. Und die Linke wird von nicht wenigen einfach nur als strukturkonservative Partei gesehen. Wen meint Fleischhauer von den Parteien dann noch beziehungsweise wie begründet er, dass diese Parteien noch links sind? Genau so könnte man bei gesellschaftlichen, linksverorteten Gruppierungen verfahren. Ein paar Abgrenzungsversuche wären notwendig gewesen.
Insofern ist es auch schwierig, sich mit Fleischhauers Positionen inhaltlich auseinanderzusetzen. Es ist nicht klar, wer das Konzept, das Fleischhauer angreift eigentlich repräsentiert. Mal ist es tendenziell sozialdemokratische Bildungspolitik, ein anderes Mal ist es die Israelfeindlichkeit, die nicht nur am linken Rand, sondern auch am rechten zu finden ist. Diese mangelnde Abgrenzung macht es schwierig, das Buch ernst zu nehmen.
Fleischhauer hat übrigens auch nur in den seltensten Fällen ein Gegenkonzept. In solchen Momenten ist er dann Klischee eines Konservativen. Denn er zerlegt die Ansätze linker Gruppierungen, bietet aber kein Gegenmodell an. Am schönsten ist dabei die Stelle über Chancengleichheit. Die könne es gar nicht geben, da sich das Hirn schon im Mutterleib entwickelt. Man müsse also strikt kontrollieren, dass keine einzige Mutter während der Schwangerschaft raucht und trinkt. Da man das nicht könne, werde es auch nie Chancengleichheit geben. Eine stichhaltige Ableitung, die dem Problem ungleicher Chancen im Bildungssystem aber keine neue Lösungsmöglichkeit präsentiert. Dafür ist Fleischhauer mit dem Buch auch nicht angetreten. Fleischhauer erwähnt, dass bei “Linken” alles immer gleich ein “Projekt” sein muss. Selbst wenn man auf ein Projekt verzichtet, sollte man aber ein Anliegen haben. Denn sonst müsste man ja begründen, warum so viele Änderungsbedarf verspüren, während man selbst auf der Position steht: “Alles ist gut”. Es bleibt also die Frage, ob es ausreicht, sich immer nur darüber zu definieren, dass man ausnahmslos alles, was nach “links” riecht, ablehnt oder ob man nicht wenigstens an einigen Stellen so etwas wie einen Gegenentwurf beziehungsweise ein konträres Wertesystem skizzieren sollte.
Gelungen sind die Passagen, in denen Fleischhauer seine Herkunft, gegen die er rebbelliert hat, beschreibt. Er kommt aus einem sozialdemokratischen Elternhaus und hat die Linie erst weitergeführt, bis er sich irgendwann davon abgewandt hat. Leider macht dieser Teil nur den knappen Anfang aus, danach wird es nur noch permanentes, teilweise etwas penetrantisch Wirkendes “Dagegen”-Sein. Außerdem spielen die Szenen aus seinem Elternhaus tatsächlich in der Zeit vor 1990. Und wie sehr sich diese Zeit von der unsrigen, mit eher unpolitischen Jugendkulturen, unterscheidet, kann man unter anderem in dem Buch von di Lorenzo und Hacke erlesen, das übrigens einen eigenen Werteentwurf mit sich bringt.
Interessant ist das letzte Kapitel, das sich knapp über “die Linke und der Humor” auslässt. Das Kapitel kommt zu dem Fazit, dass Linke eben diesen nicht besitzen. Interessant ist das Kapitel am Ende eines Buches, dass zwar locker geschrieben ist, aber nicht unbedingt auf Witz setzt, sondern sich eher auf penetrante Aufarbeitung und Anschuldigungen konzentriert. Wenn man dem noch Fleischhauers Kolumnen auf Spiegel Online entgegensetzt, in denen er nach der Wahl in Baden-Württemberg den Untergang des Landes sah oder er nach der Atomkatastrophe in Fukushima die Opfer der Katastrophe mit Verkehrsopfern in Verbindung gesetzt hat. Beide Reaktionen auf – für Konservative sicherlich verstörende Ereignisse – zeugen nicht gerade von einem Übermaß an Humor.
“Unter Linken” ist gut zu lesen, inhaltlich aber nur vom “Dagegen”-Sein und teilweise einer gewissen Hässigkeit geprägt. Das Buch krankt an Ungenauigkeit und eigener Kreativlosigkeit. Die lockere Aufarbeitung dominanten, linken Gedankenguts hat zudem das Problem, dass die Lebenswirklichkeit mittlerweile anders erscheint. Die meisten Medien beäugen das linke Lager mindestens so kritisch wie das rechte. Und auch im Alltag erscheint es nicht selbstverständlich, dass die “Linken” diese Gesellschaft tatsächlich dominieren. Denn Fleischhauer erinnert zurecht daran, dass die BRD gerade einmal 20 Jahre von tendenziell “Linken” regiert wurde. Die eigentliche politische Macht war also meistens woanders konzentriert. Von der wirtschaftlichen Macht im Land gar nicht zu sprechen. Insofern ist die Wichtigkeit des Buches unklar.
Das Ziel des Buches, eine einseitige, undifferenzierte Polemik, die frühere Erfahrungen einer damals vielleicht “linksdominierten” Gesellschaft verarbeitet, ist allerdings erreicht.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

Dass ein neuer Blog, abseits des mittlerweile doch in Teilen sehr positiv gesehenen blogger.de, nicht nur Freude machen kann, kann man hier lesen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Don Carlos ist der einzige Sohn König Philip II. und ist in seine Stiefmutter verliebt. Die war ursprünglich ihm zugesprochen, doch der König nahm sie sich lieber selbst zur Frau. Carlos ist außer sich und kann sich kaum noch beherrschen. Da trifft ein altere Freund von ihm, der Marquis von Posa ein und verspricht ihm zu helfen. Dem Humanisten Posa geht es aber eigentlich um die Befreiung Flanderns. Unglücklicherweise ist die Prinzessin von Eboli in Carlos verliebt und reagiert auf dessen Zurückweisung außerordentlich zornig. Da Philip II. ein eifersüchtiger Ehemann ist, ist es Carlos Gegnern am Hofe ein Leichtes, eine Intrige gegen den Thronfolger zu planen. Posa verheddert sich in einer Gegenintrige, die Carlos auch nicht mehr retten kann.
Don Carlos ist der einzige Sohn König Philip II. und ist in seine Stiefmutter verliebt. Die war ursprünglich ihm zugesprochen, doch der König nahm sie sich lieber selbst zur Frau. Carlos ist außer sich und kann sich kaum noch beherrschen. Da trifft ein altere Freund von ihm, der Marquis von Posa ein und verspricht ihm zu helfen. Dem Humanisten Posa geht es aber eigentlich um die Befreiung Flanderns. Unglücklicherweise ist die Prinzessin von Eboli in Carlos verliebt und reagiert auf dessen Zurückweisung außerordentlich zornig. Da Philip II. ein eifersüchtiger Ehemann ist, ist es Carlos Gegnern am Hofe ein Leichtes, eine Intrige gegen den Thronfolger zu planen. Posa verheddert sich in einer Gegenintrige, die Carlos auch nicht mehr retten kann.“Don Carlos” ist Schillers umfangreichstes Drama und somit dauert es auch lange, es über die Bühne zu bringen. Dreieinhalb Stunden dauert das Stück am Thalia Theater in Hamburg und es ist eine Leistung, das das Stück dennoch nicht langweilt.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

In der Rezession verliert Elisabeth ihren Job. Sie könnte eine Stellung als Selbstständige erhalten, wenn sie 150 Mark für einen Wanderarbeiterschein aufbringen kann. Voller Hoffnung macht sich sich auf den Weg, 150 Mark zu beschaffen. Sie lernt einen Präperator des anatomischen Instituts kennen, der ihr die 150 Mark borgt. Allerdings muss sie das Geld für eine Geldstrafe verwenden, die sie erhalten hat, weil sie ohne Wanderarbeiterschein gearbeitet hat. Sie bekommt allerdings von anderer Seite den Schein, kann auch arbeiten, macht sich aber des Betrugs schuldig. Dessen wird sie überführt und auch verurteilt. Elisabeth lernt kurz darauf einen Polizisten kennen, kommt mit ihm zusammen und wird von ihm finanziell gestützt. Sie verschweigt ihm jedoch ihre Vorbestrafung, da dies seine Karriere behindern könnte. Als ihre Vergehen ans Licht kommen, trennt sich der Polizist von ihr. Daraufhin versucht sie sich, von aller Hoffnung verlassen, in einem Fluss zu ertränken. Zwar wird sie gerettet, doch in einer letzten Konfrontation mit dem Polizisten redet sie sich so in Rage, dass ihr Herz versagt.
Die Grundansatz des Stückes, das zur Zeit im “Neuen Schauspielhaus” in Bremen aufgeführt wird, weist eigentlich auf eine gesellschaftskritische Komödie hin. Schließlich ist die Konzeption, Geld für Arbeit zu bezahlen, ja recht irrsinnig. Der Untertitel “Ein Totentanz in fünf Bildern” macht jedoch deutlich, dass Humor kein großes Merkmal des Stückes ist.
Im Gegenteil: Die Stimmung ist von Anfang an negativ. Zwar macht Elisabeth zunächst deutlich, dass sie sich nicht unterkriegen lassen will, doch schnell wird klar, dass Zuversicht allein nicht ausreicht. Sie kommt allerdings durch verschiedene Zufälle an viele Möglichkeiten. In zwei Fällen werden die aber wieder verbaut weil sie nicht ganz ehrlich ist. In beiden Fällen erlauben die Zustände es ihr aber auch nicht, ehrlich zu sein. Weder hätte sie vom Präperator Geld für das Abbezahlen ihrer Geldstrafe bekommen, noch wäre der Polizist mit ihr zusammengeblieben, hätte er gewusst, dass sie vorbestraft ist. Elisabeth wird als der einzige Charakter mit aufrechten Motiven in dem Stück dargestellt, doch selbst ihr gelingt es aufgrund der Zustände deprimierender Weise nicht, ehrlich zu bleiben.
Das Stück langweilt zunächst. Die Grundidee ist gut, aber die langen Unterhaltung im anatomischen Institut sind doch etwas zäh. Außerdem wirken Anspielungen auf die “Wohlfahrtstaatsausnutzer”-Debatte und eine ausländische Arbeitslose zunächst gezwungen. Jede Szene wird zudem von lauter knarziger Musik unterbrochen. Das macht dann Sinn, wenn man die Unterbrechungen als Ankündigung auf den “Totentanz” versteht. Blöderweise wird dann zum Schluss leichtere, filmmusikähnliche Musik verwendet. Dann hätte man sich die störende Zwischenmusik auch sparen können.
Elisabeth verliert nacheinander ihren Glauben, ihre Liebe und ihre Hoffnung. So sollte man zumindest den Titel des Stücks verstehen und so heißt es meist auch, wenn man das Stück googelt. In der Inszenierung lässt sich erkennen, wann Elisabeth ihre Liebe verliert, schließlich geht die Beziehung zu dem Polizisten rasch zu Bruch. Es ist aber unklar, ob sie ihn je geliebt hat, schließlich ging es ihr in erster Linie um materielle Sicherheit. Dass sie ihre Hoffnung im Verlauf des Stückes verliert, ist ebenfalls klar und sogar noch verständlicher. Nach all den Rückschlägen, sieht sie für sich keine Zukunft mehr. Unklar ist aber, wann sie der Glauben verlassen hat. Das Stück beginnt mit einem Gebet Elisabeths. Sie betet im weiteren Verlauf auch noch ein zweites Mal, dann hört sie damit auf. Die ausländische Arbeitslose, zu der Elisabeth irgendwann Kontakt aufnimmt, wird verhaftet, kurz nachdem sie gebetet hat. Vielleicht soll das Elisabeth den Anstoß gegeben haben, sich vom Glauben abzuwenden. Eindeutige Signale dafür gibt es aber nicht.
Man hätte in diesem Fall die religiöse Handlung auch gleich weglassen können. Dadurch wäre es schwieriger gewesen, Elisabeths Situation zu Beginn zu erklären. Aber man hätte den “Glauben” in dem Stück auch als “Glauben an sich” selbst verstehen können, den der Zustand der Arbeitslosigkeit zerstört. Dadurch dass man durch Gebete den “Glauben” konkretisiert, hätte man das Thema besser auflösen müssen.
Der Mittelteil des Stückes ist gut gelungen. Elisabeth arbeitet bei einer Irene Prantl und ist Vertreterin für Damenunterwäsche. Diese Szenen sind sowohl witzig als auch gesellschaftskritisch. Prantl lobt eine Angestellte, die Frau eines Richters für ihre guten Ergebnisse und erwähnt dabei, dass das Geschäft in der Rezession nicht leicht sei. Als Elisabeth mit mageren Ergebnissen aufschlägt, wird sie harsch kritisert und entgegnet die exakt gleichen Worte wie ihre Arbeitgeberin, wofür sie beleidigt wird. Auch die Richtergattin ist sehr gelungen.
Das einzig störende Elemnt in diesem Teil ist eine Vergewaltigung, die kurz nach Elisabeths Kündigung geschieht. Hier ist nicht klar, was sie aussagen soll. Es wäre interessant zu wissen, ob dieses Ereignis auch in Horvaths Fassung des Stückes vorkommt.
Das Ende ist dann leider etwas zu “schubserisch”. Nach Elisabeths Selbstmordversuch steht sie ihrem Vergewaltiger, dem Polizisten und dem Sohn Irene Prantls gegenüber. Man schreit sich nur noch an, Elisabeth verliert endgültig ihre Würde, kriecht größtenteils auf allen Vieren und wird ständig hin- und hergeschubst. Zuletzt regt sie sich so auf, dass sie an Herzversagen stirbt. Theaterprügeleien wirken auf mich immer wie “Schubsereien”, das müssen sie ja auch, die Schauspieler können sich ja nicht wirklich verprügeln. Bei mir ist der Funke aber nicht wirklich übergesprungen, dafür war die Schlusszene zu lang, die Schauspieler zu sehr am schreien.
Gelungen war am Schluss nur, dass Elisabeth drei egoistischen Männern gegenübersteht. Nachdem sie stirbt, wiederholt der Polizist mehrmals, dass er einfach kein Glück habe. Dabei lebt er noch und hat eine gute Anstellung. Das ist auch das überraschende an dem Stück: Die Opfer sind ausnahmslos Frauen. Elisabeth und die ausländische Arbeitslose finden keine Anstellung, die Richtergattin wird in der Ehe schlecht behandelt und Irene Prantl muss mit einem verwöhnten, egoistischen Sohn kämpfen. Bei der Richtergattin und Frau Prantl muss aber noch hinzugefügt werden, dass beide selbst sehr egoistisch handeln. Aber selbst die Tatsache, dass nur zwei Frauen als Opfer der Arbeitslosigkeit gezeigt werden, ist schon bemerkenswert. Zumal das Stück 1932 geschrieben wurde und das Augenmerk sicherlich noch nicht auf Frauenproblemen lag. Die beiden arbeitslosen Frauen sorgen auch für die einzige Szenen, in der so etwas wie ein freundschaftlicher Dialog ohne Hintergedanken geführt werden kann. In diesem Stück sind alle Männer von Hintergedanken geleitet, während es zumindest zwei Frauen gibt, die aufrichtig wirken. Diese Tatsache wird allerdings nicht wirklich herausgearbeitet.
Die Inszenierung behält den Jargon des Stückes bei. Das bedeutet in diesem Fall, dass das sie fast nie ausgesprochen wird. So heißt es ständig “wissens”, “meinens” und “denkens”, was sich in Bremen irgendwie künstlich anhört und auch dafür sorgt, dass der Zuschauer dem Stück eine Weile lang fremd bleibt.
Elisabeths kann bei den Gesetzen und der Arbeitsmarktlage nicht Mensch sein. Das wird in dem Stück ganz gut deutlich. Auch dass es der ausführenden Justiz und Polizei zwar auch nicht gut geht, sie aber an der “Ordnung” festhalten, wird deutlich. Aber das Stück strengt durch den Jargon, die undeutliche Glaubensthematik und das Ende sehr an. So ist der Ansatz des Stückes gut, die Umsetzung nicht.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 Große Verwirrung bei der Bahn. Menschen wollen Fahrkarten zu einem Ort, den es gar nicht gibt. Immer wenn man versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, verschwinden die Fragenden spurlos. Der Bahnmitarbeiter Bob Paine glaubt beinahe verrückt zu werden, macht sich aber dennoch auf die Suche nach dem eigentlich nicht vorhandenen Ort "Macon Heights".
Große Verwirrung bei der Bahn. Menschen wollen Fahrkarten zu einem Ort, den es gar nicht gibt. Immer wenn man versucht, der Sache auf den Grund zu gehen, verschwinden die Fragenden spurlos. Der Bahnmitarbeiter Bob Paine glaubt beinahe verrückt zu werden, macht sich aber dennoch auf die Suche nach dem eigentlich nicht vorhandenen Ort "Macon Heights".In dieser Kurzgeschichte verändert sich die Realität. Bob Paine scheint der einzige zu sein, dem die Veränderungen auffallen. Es tauchen bisher unbekannte Versicherungen auf, der eigentlich nicht vorhandene Ort "Macon Heights" und zum Schluss verändert sich sogar Paines Familie in eine bisher unbekannte Richtung.
Das nimmt Paine natürlich jede Sicherheit. Er kann nicht mehr darauf vertrauen, dass das, was er bisher für gegeben angesehen hat, demnächst noch da ist. Selbst um seine Wohnung und seine Frau muss er Angst haben, schließlich liegt es im Bereich des Möglichen, dass sie ebenfalls verschwinden oder sich ändern.
Die Kurzgeschichte endet offen. Das ist für Kurzgeschichten sicherlich keine Überraschung und es ist ja auch gut, dass der Leser nicht weiß, wie sich das Phänomen weiterentwickelt. Allerdings wird nicht ganz deutlich, was die Kurzgeschichte eigentlich mitteilen möchte. Sie ist zwar kurzweilig und die Realitätsauflösung wird ebenfalls gut dargestellt, aber die Handlung beschränkt sich dann doch etwas auf die Suche nach Macon Heights. Außerdem wird nicht ganz deutlich, ob Paine jetzt der einzige ist, dem die Veränderungen auffallen. Schließlich gibt es zunächst mehrere Leute, die wissen, dass Macon Heights bisher nicht exisitert hat. Später halten aber alle die Existenz des Ortes für gegeben. Diese Unklarheit hätte man durchaus noch beseitigen können und es gäbe trotzdem ein offenes Ende.
"Der Pendler",17 Seiten, 1953, von Philip K. Dick, aus der Anthologie "Variante zwei".
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

 “Zero Sum Game” ist der Auftakt zu der vier-bändigen “Typhon Pact”-Reihe, die die Destiny-Reihe fortsetzt. Rezensionen der anderen drei Teile sind bereits von mir auf Trekzone erschienen, aus verschiedenen Gründen erscheint die Rezension zum Auftakt erst jetzt.
“Zero Sum Game” ist der Auftakt zu der vier-bändigen “Typhon Pact”-Reihe, die die Destiny-Reihe fortsetzt. Rezensionen der anderen drei Teile sind bereits von mir auf Trekzone erschienen, aus verschiedenen Gründen erscheint die Rezension zum Auftakt erst jetzt.Der Roman beschäfitgt sich stark mit der Kultur der Breen. Dieses Volk, dass sich in “Deep Space Nine” dem Dominion anschloss, ist dem Zuschauer zwar als harter Gegner bekannt, über die Lebensweise weiß man aber nichts.
Das ändert David Mack mit diesem Roman, ohne dabei auf die für ihn typische action-reiche Handlung zu verzichten. Es gelingt ihm auf kurzweilige Art und Weise, eine authentische Kultur zu skizzieren. Dabei erzählt er eine solide Agentenstory, die an Spionage-Geschichten aus dem Kalten Krieg erinnert.
Außerdem greift Mack die “Sektion 31“"-Handlung aus der Anfangszeit des “Deep Space Nine”-Relaunch wieder auf. Das ist gut, aber gleichzeitig bringt das auch ein negatives Thema mit sich: Denn Mack beginnt mit diesem Roman den Relaunch zu zerstören. Seit der letzten Veröffentlichung sind mehrere Jahre vergangen, die Charaktere sind in andere Positionen gerückt, Erklärungen gibt es wenige. Auch in einem anderen Punkt bleibt der Roman hinter den Erwartungen zurück. Wer nach der epischen “Destiny”-Trilogie auf etwas vergleichbares gehofft hat, wird enttäuscht. Warum das so ist und welche Schwächen der Roman noch hat, liest man in der Zweitrezension auf trekzone: Star Trek Typhon Pact: Zero Sum Game (von David Mack)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
 “Radetzkymarsch” erzählt das Schicksal dreier Generationen der adligen Familie Trotta in der k.u.k. Monarchie Östterreich-Ungarn. Die Geschichte beginnt damit, dass Joseph Trotta dem Kaiser bei der Schlacht von Solferino das Leben rettet. Aus Dank wird er in den Adelsstand befördert. Joseph Trotta hat Schwierigkeiten diesen Statuswechsel zu verarbeiten, schließlich war noch sein Großvater ein einfacher Bauer und für ihn war es schon eine große Leistung überhaupt als Leutenant in der Armee dienen zu können. Josephs Trottas Lebensgeschichte wird rasch zu Beginn des Romans abgehandelt, das Augenmerk liegt auf seinem Sohn und vor allem seinem Enkel. Denn die beiden erleben nicht nur den Verfall Österreich-Ungarns und den Weg des Reiches Richtung erster Weltkrieg, sondern auch den Verfall der eigenen Familie.
“Radetzkymarsch” erzählt das Schicksal dreier Generationen der adligen Familie Trotta in der k.u.k. Monarchie Östterreich-Ungarn. Die Geschichte beginnt damit, dass Joseph Trotta dem Kaiser bei der Schlacht von Solferino das Leben rettet. Aus Dank wird er in den Adelsstand befördert. Joseph Trotta hat Schwierigkeiten diesen Statuswechsel zu verarbeiten, schließlich war noch sein Großvater ein einfacher Bauer und für ihn war es schon eine große Leistung überhaupt als Leutenant in der Armee dienen zu können. Josephs Trottas Lebensgeschichte wird rasch zu Beginn des Romans abgehandelt, das Augenmerk liegt auf seinem Sohn und vor allem seinem Enkel. Denn die beiden erleben nicht nur den Verfall Österreich-Ungarns und den Weg des Reiches Richtung erster Weltkrieg, sondern auch den Verfall der eigenen Familie.Der Roman beginnt mit einem überraschend szenischen Einstieg. Lebhaft wird die Schlacht von Solferino erzählt, der Leser ist von Anfang an gepackt. Auch im weiteren Verlauf des Romans gelingt es Roth immer wieder spannende Passagen einzubauen, die das Lesen (besonders für ein Reclam-Buch) extrem kurzweilig machen. Das ist deswegen überraschend, weil der Roman zum größten Teil aus recht ausführlichen, immer auch etwas melancholisch-wehmütigen Passagen besteht. Denn Roth nimmt sich viel Zeit um Blicke auf die österreichisch-ungarische Gesellschaft zu werfen. An vielen Stellen treten Widersprüche auf, die Roth teilweise gar mit einem ironischen Unterton beschreibt. An vielen Stellen ist der Zerfall aber einfach spürbar.
Die meisten Zustände werden aus der Sicht des Militärs beschrieben, indem Josephs Enkel, Carl-Joseph, dient. Sein Sohn, Franz, ist Bezirkhauptmann. An ihm erlebt man noch die etwas würdevolle, starre und damit aber auch stabile Art, wie das Land verwaltet wird. Der Bezirkhauptmann plant alles und ist für Carl-Joseph eine etwas übermächtige Vaterfigur. Was allerdings auch daran liegt, dass die Frauen der Familie alle recht schnell sterben und die Männer keine gemeinsame Kommunikation findet. Briefe werden immer nach dem selben Standardformat verfasst, geredet wird nur in den seltensten Fällen. Das bessert sich etwas zum Schluss, aber da wirft der erste Weltkrieg schon seinen Schatten.
Das Militär ist kein schöner Ort. Die Offiziere sind alle gelangweilt und harren eines Krieges. In der Zwischenzeit wird gesoffen, gehurt und sich duelliert. Carl-Joseph ist diese Welt fremd und dennoch wird er in sie reingezogen. Nach einer unglücklichen Verwicklung in ein Bordell wird er an die Grenze versetzt. Dort muss er sich nicht nur mit einem sozialistischen Streik rumschlagen, sondern auch mit der Verlockung des Glückspiels. Er ist dabei furchtbar naiv und lässt sich in massive Schulden treiben, obwohl er selbst kaum spielt. Stattdessen übernimmt er regelmäßig für seine Kameraden Schulden, weil er deren Aufrichtigkeit beziehungsweise Solidität völlig überschätzt. Diese Naivität speist sich dabei aus verschiedenen Quellen. Da ist das – sehr gut dargestellte – schlechte Verhältnis zum Vater, aber auch die Berufswahl, die sich nach einer Erwartung und nicht nach einem eigenen Wunsch gerichtet hat. Außerdem hat Carl-Joseph ein etwas gestörtes Verhältnis zu Frauen. Schon in seiner Jugend hatte er eine Affäre mit der älteren Ehefrau eines Polizeikommissars. Nachdem er diese geschwängert hatte, starb sie im Kindbett, was ihn natürlich völlig aus der Bahn warf. Auch im Verlauf des Romans hat Carl-Joseph nicht Affären mit älteren Frauen, die seinem Gemütszustand nicht gerade zuträglich sind.
Der Roman ist daher in gewissem Maß auch die Verzweiflung Carl-Josephs an seiner Rolle im Leben. Erst zum Schluss kann er sich vom Militär, seinen Kameraden und der Geldsucht emanzipieren und lebt ein bescheidenes, aber glückliches Leben – bis ihn der erste Weltkrieg wieder zurückholt.
Am interessantesten ist aber wie Roth den Zustand der Monarchie beschreibt. Es gibt einige Szenen mit dem Kaiser, der der Familie Trotta natürlich gedanklich noch verbunden ist. Diese Passagen werden immer kindlicher, je älter der Kaiser wird und sorgen für angenehme Lockerung, ohne albern zu wirken. Aus den Gedankengängen des Kaisers kann man die deutlichsten Anspielungen herauslesen. Der Rest wird über die bereits erwähnten Landschafts- und Gesellschaftsbeschreibungen erreicht. Hier wird viel Wehmut transportiert, was interessant ist, das Roth selbst die Monarchie miterlebt hat, den Roman aber 1932 kurz vor dem Sieg des Nationalsozialismus über die Weimarer Republik geschrieben hat. Diese viel Platz einnehmenden Passagen sorgen für eine sehr berührende Stimmung, die deutlich macht, dass der unaufhaltsame und für die Charaktere unmerkliche Abstieg der Familie Trotta kein Einzelfall ist, sondern stellvertretend für das gesamte Reich steht.
Letztendlich ist der Tod ein Bestandteil des Werkes. Das Reich stirbt, die alten Trottas sterben und der junge Trotta stirbt natürlich auch. Bei seinen Beschreibungen streut Roth immer wieder Nebensätze ein, die andeuten, was den einzelnen Militärregimentern im ersten Weltkrieg alles droht. Dabei gleitet das Werk aber – wie auch bei den melancholischeren Passagen – nie ins Depressive ab, was eine gewisse Leistung ist.
Der Radetzkymarsch glänzt durch authentische Charaktere und eine besondere Stimmung. Das Lesen wird dadurch nie langweilig, man mag das Buch kaum aus der Hand legen. Lange hat mich kein Buch mehr so berührt wie dieses.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Dementsprechend gespalten war dann auch das Publikum. Die Abstimmung vor der Diskussion ging nahezu unentschieden aus, die Abstimmung danach ging tatsächlich 50/50 aus. Die Redakteure der Sendung sollten sich daher tatsächlich mal überlegen, ob man nicht ein Sachthema auswählt, indem Argumente in begrenztem Raum ausgetauscht werden können.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Das Meinungsinstitut Forsa sieht die Grünen in der Regel etwas besser als die anderen Parteien. 28 Prozent erscheinen wie Irrsinn, würde die Partei ihr Ergebnis von 2009 damit doch beinahe verdreifachen.
Der Grüne Höhenflug leigt aber vor allem auch an der Alternativlosigkeit der politischen Landschaft. mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Jetzt überbieten sich die Online-Magazinen mit hastig zusammengeschriebenen Thesen darüber, wer Rösler eigentlich ist. Man kommt zu der Analyse, dass es unsicher ist, ob er den Knochenjob durchhält. Oder aber man präsentiert dem Leser gleich sechs Thesen, was Rösler alles sein könnte. Dadurch wird deutlich, die Medien haben eigentlich keine Ahnung, niemand dürfte Rösler richtig einschätzen. Der neue FDP-Vorsitzende könnte somit für die ein oder andere Überraschung gut sein.
Jetzt wird viel von dem “sozialen” Teil der FDP geredet. Auch in diesem Punkt zeigen die Kommentatoren doch, dass sie wenig mitbekommen haben.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

 Die Sternenfaust muss rechtzeitig in das Zyrgon-System gelangen, da die dortige Sonne die menschlichen Kolonisten zu verstrahlen droht. Die Crew rechnet schon mit dem Schlimmsten, doch im System finden sie einen Schutzschild und eine Reihe eingefrorener Menschen.
Die Sternenfaust muss rechtzeitig in das Zyrgon-System gelangen, da die dortige Sonne die menschlichen Kolonisten zu verstrahlen droht. Die Crew rechnet schon mit dem Schlimmsten, doch im System finden sie einen Schutzschild und eine Reihe eingefrorener Menschen.Unglücklicherweise ist die Auftaufunktion nicht aktiviert. Stattdessen scheinen sich die Kolonisten in einer virtuellen Realität zu befinden. Einige Crew-Mitglieder begegeben sich ebenfalls in den Cyberspace und erleben eine unangenehme Hetzjagd und eine Sammelintelligenz.
Der Roman baut unnötigerweise einige Parallelen zu den “Borg” aus “Star Trek” auf, greift sogar wörtlich deren “Widerstand ist zwecklos”-Parole auf. Das ist unnötig, denn der Roman könnte auch so überzeugen.
Warum er das tut, liest man wie immer auf Sf-Radio:
Sternenfaust Band 161 – Cyber Tod (von Andreas Suchanek)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren

 Die Excalibur hat die Ereignisse um den "großen Vogel der Galaxis" und das Ende des Planeten Thallon überlebt. Nun wird sie und vor allem ihr Captain, Calhoun, in vielen Ecken des Raumsektors jedoch als Gottheit verehrt.
Die Excalibur hat die Ereignisse um den "großen Vogel der Galaxis" und das Ende des Planeten Thallon überlebt. Nun wird sie und vor allem ihr Captain, Calhoun, in vielen Ecken des Raumsektors jedoch als Gottheit verehrt. Um einem Planeten aus einem Bürgerkrieg zu helfen, übernimmt Calhoun tatsächlich die Rolle eines Messias, obwohl das gegen fast jede Sternenflotten-Richtlinie verstößt. Gleichzeitig wendet sich ein Volk von seinem Glauben an Xant ab, der ihm von fremden Besatzern aufgezwungen wurde. Dadurch lösen sie jedoch unheilvolle Ereignisse aus.
"Märtyrer" hat zwei gelugene Handlungsebenen und weiterhin von Peter David sehr gelungen beschriebene Charaktere. Die Thematik um religiösen Fanatismus hätte noch konkreter werden können, bleibt so aber erfrischend objektiv, indem sie einen "guten, fanatischen Schurken" aufweist.
Die komplette Rezension findet man als viert-Bewertung auf trekzone:
Star Trek New Frontier: Märtyrer (von Peter David)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
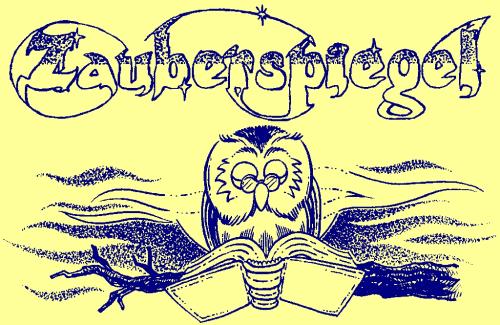
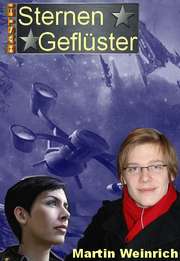 "Sternenfaust" ist im Vergleich zu der "großen" Science-Fiction Serie in Deutschland, "Perry Rhodan", deutlich bodenständiger. Dennoch gelingt es den Autoren seit einiger Zeit, eigentlich fantastische Handlungselemente glaubwürdig zu verkaufen. Dabei scheut man sich nicht vor merkwürdigen Heftttiteln und vernichteten Sternensystemen.
"Sternenfaust" ist im Vergleich zu der "großen" Science-Fiction Serie in Deutschland, "Perry Rhodan", deutlich bodenständiger. Dennoch gelingt es den Autoren seit einiger Zeit, eigentlich fantastische Handlungselemente glaubwürdig zu verkaufen. Dabei scheut man sich nicht vor merkwürdigen Heftttiteln und vernichteten Sternensystemen.Den ganzen Artikel kann man auf dem Zauberspiegel lesen:
Ganz normale Skurrilitäten
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Die CSU will also grüner sein als die Grünen. Söder betont, dass es wichtig sei, möglichst schnell aus der Atomenergie auszusteigen und in das Zeitalter der Erneuerbaren Energien einzusteigen. Dabei wolle er keinen Kuhhandel mit Konzernen betreiben.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Inhalt: Ein amerikanisches Küstenschiff greift einen chinesischen Transporter auf, der in einem Kontainer christliche Flüchtlinge transportiert. Der Präsident muss sich entscheiden, ob er ihnen Asyl gewährt und damit China verärgert oder sie wieder zurückschickt...
Toby möchte derweil eine Debatte über Schulgebete starten und benennt daher Leos Schwester, die gegen diese Tradition ist, für ein Bildungsprojekt. Doch er stößt auf deutliche heftigeren Widerstand bei den Republikanern als er gedacht hat...
Kritik: Shibboleht ist inhaltlich eine eher unspektakuläre Folge. Dass die Entscheidung über die Flüchtlinge eine komplizierte ist, war klar. Die Art und Weise wie Bartlett die Situation klärt, ist auch nicht gerade weltbewegend.
In einer Nebenhandlung muss CJ den Truthahn auswählen, der vom Präsidenten zu Weihnachten begnadigt werden soll. Doch sie kann sich nicht zwischen den beiden Hähnen entscheiden. Diese Nebenlinie sorgt zwar für ein wenig Schmunzeln, ist aber auch nicht besonders überzeugend.
Sehr gelungen ist hingegen, Tobys Bildungsvorstoß. Zwar hat er in der Episode zuvor noch einen mutigen Vorstoß in Sachen Lehrererhöhung aus finanziellen Gründen verhindert, aber nun ist er voll in seinem Element. Extrem verbissen kämpft er darum, Leos Schwester in das richtige Amt zu bekommen. Dabei geht er so hartnäckig vor, dass er gar nicht merkt, wie sehr er sich verrennt.
So ist dem Zuschauer aber schon lange bevor Leo fragt klar, dass persönliche Gründe dahinter strecken.
Tragisch ist an daran nur, dass Toby gar nicht merkt, dass er für einen heftigen Streit zwischen Leo und seiner Schwester sorgt. Man darf gespannt sein, ob das noch einmal aufgegriffen wird. Denn vermutlich wird es eine längere Verstimmung zwischen den beiden geben. Das ist natürlich schlimm für Leo, der schon seine Frau und ein paar weitere Freunde im Verlauf der ersten Staffel verloren hat.
Insgesamt ist „Shibboleth“ dennoch eine gute Folge. Hauptsächlich aber aufgrund der sehr gelungen Schulgebetshandlung. 3 von 5 Punkten.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Naumann attestiert der SPD in seinem Kommentar, dass sie sich nach dem Wahlsonntag am “meisten Sorgen um ihre Zukunft machen muss”. Interessant ist aber, dass zwar eine Profilschwäche angedeutet wird, es Naumann aber gar nicht um Inhalte geht. Stattdessen sieht er es als Hauptmanko, dass noch nicht klar ist, wer die SPD in den Bundestagswahlkampf 2013 führen soll.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
