... neuere Einträge
Blutoper (ARD-Radiotatort)
 Nachdem ich vor einiger Zeit schon einmal einen ARD-Radiotatort gehört habe, wollte ich es nun noch einmal versuchen. Damals überzeugte mich der Kriminalfall nicht wirklich. Die aktuelle Folge des Radiotatorts heißt „Blutoper“, wurde vom SWR produziert und spielt somit in Stuttgart. Den Fall kann man zwar nicht mehr im Radio hören, aber man kann ihn noch bis zum 15. Juni hier runterladen.
Nachdem ich vor einiger Zeit schon einmal einen ARD-Radiotatort gehört habe, wollte ich es nun noch einmal versuchen. Damals überzeugte mich der Kriminalfall nicht wirklich. Die aktuelle Folge des Radiotatorts heißt „Blutoper“, wurde vom SWR produziert und spielt somit in Stuttgart. Den Fall kann man zwar nicht mehr im Radio hören, aber man kann ihn noch bis zum 15. Juni hier runterladen.Wie der Titel schon verrät, dreht sich in dem Fall alles um die Oper. „Blutoper“ ist ein zeitgenössisches Stück, das bei den SWR-Radiofestspielen aufgeführt werden soll. Dafür wurde extra eine weltbekannte Opernsängerin angeheuert, die sich jedoch ungewohnterweise mit einer Zweitbesetzung versehen sieht, was sie in ihrer Ehre doch kränkt. Pikanterweise ist die zweitbesetzte Sängerin die Tochter des Hauptsponsors, einem Mannheimer Wurstherstellers namens Krieg. Bei den Veranstaltern gehen Drohbriefe an die Hauptsängerin ein, während die Zweitbesetzung einen verliebten Stalker am Telefon abwimmeln muss. Irgendwann wird die Festivalleitung ob der Drohbriefe nervös und verständigt die Polizei...
Positiv fällt auf, dass in diesem Radiotatort viel Lokalsprache gesprochen wird. Eigentlich hat jeder Charakter einen gewissen Akzent. Nicht baden-württembergisch klingt lediglich die Opernsängerin, die nun einmal einen italienischen Akzent hat. Lokale Eigenarten wurden bei den meisten Fernseh-Tatorts längst ausradiert. Der Radiotatort ist in dieser Hinsicht also eine schöne Abwechslung.
Allerdings sorgt der Akzent natürlich auch dafür, dass einige Sprecher nur schwer zu verstehen sind. Verstärkt wird das dadurch, dass die Podcast-Mp3-Datei ungewöhnlich leise ist. Ich musste meinen MP3-Player deutlich lauter stellen als sonst, um gut hören zu können.
Interessant und unterhaltend sind die beiden Polizisten. Der Kriminalkommissar enthüllt in dieser Folge seine Liebe zur Oper durch allerlei Detailwissen. Da er ansonsten scheinbar eher proletenhaft wirkt, erstaunt das sein Umfeld. Seine Kollegin ist sehr direkt und energisch und kann vor allem mit der Oper nichts anfangen. Das sorgt für einige gute Gespräche.
Der Fall selbst ist leider nicht besonders überzeugend. Das liegt in erster Linie daran, dass der Zuschauer den Täter von vornherein kennt. In dem Fall wird einfach zu früh enthüllt, wer sowohl die Drohbriefe als auch die Liebestelefonate schreibt beziehungsweise führt. Das nimmt der Geschichte natürlich viel Spannung. Da in einem solchen Fall der Zuhörer zum Schluss noch mit einem weiteren „Schuldigen“ überrascht werden muss, überrascht es auch nicht wirklich, dass im Laufe des Krimis eine weitere Person sich „schuldig“ macht. Interessant ist an dem Fall eigentlich nur die Verquickung mit dem „Hauptsponsor“, die sich aber relativ schnell als unergiebig herausstellt.
Etwas ungenutzt blieb leider das Potential der Mutter des verrückten Täters. Die psychischen Probleme des Täters wurden sehr gut erklärt, die Telefonate mit seiner Mutter sind emotional die Highlights der Folge. Hier hätte man die Dramatik durch das Zurschaustellen der Trauer der Mutter noch etwas verstärken können.
Zwischen den Sprechszenen sind immer wieder Opernausschnitte eingebunden. Allerdings keine Zitate aus bekannten Opern, sondern entweder Momente aus der „Blutoper“ oder aber opernähnliche Zusammenfassungen der bisherigen Handlung. Das ist schnittmäßig gut gemacht und passt klanglich halt gut in das Hörspiel, hat mich persönlich aber eher gestört. Es wirkt dadurch so, als habe man den Fall künstlich etwas in die Länge ziehen wollen. Nun ist es bei Radiohörspielen natürlich irgendwie nötig, für Atmosphäre zu sorgen. Aber ein Opernhaus und die Thematik dazu kann man sich gut vorstellen, ohne ständig Opern-Zusammenfassungen zu erhalten.
„Blutoper“ ist recht unterhaltsam anzuhören und überzeugt vor allem durch das Polizeiduo und den Täter. Der Täter ist gleichzeitig jedoch auch die größte Schwäche, da durch seine frühe Enthüllung viel Spannung verloren geht. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Personen gut getroffen wurden und leider für einen schlechten Fall herhalten mussten.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Bayerische Heuchlertruppe
Die CSU, im Selbstverständnis auch bayrische Staatspartei, zeigt zur Zeit auch den Unverständigsten ihr eigentliche, heuchlerische Seite. Vor kurzem überraschte der CSU-Ministerpräsident Seehofer mit der Ankündigung, demnächst bundesweit nach einem Endlager für Atommüll zu suchen. Bisher hatten Bayern nd Baden-Württemberg ihr Atomprojekt gut protektioniert und den Müll in den Norden der Republik geschickt. Das sollte nun anders werden, sagt Seehofer. Nun sagt sein Umweltministerium aber, dass es in Bayern kein Endlager geben werde. Die Gesteinsformationen eigneten sich nicht, daher bedürfe es auch keiner Suche in Bayern. Hätte sich Niedersachsen damals doch nur ebenfalls auf so eine Sprachregelung berufen.
Gestern berichtete zudem die Taz darüber, dass die CSU eine heftige Niederlage in einem Umfragestreit erlitten habe. Für eine halbe Million Euro fertigte die CSU von 2000 bis 2009 Umfragen an, in denen aber nicht nur die Sontnagsfrage gestellt wurde, sondern auch nach möglichen CSU-Strategien geforscht wurde. Ein Verwaltungsgericht hat dieses Verhalten nun als nicht verfassungsmäßig gerügt, denn die Opposition hatte um Herausgabe der Umfragen gebeten und die Informationen nicht erhalten. Damit wurde das Informationsrecht der Opposition verletzt.
Die CSU ist also eine selbstverliebte, populistische Partei. Das konnte man sich auch vorher schon denken. Aber ein aktuelles Papier der Christsozialen zeigt, dass die Partei zudem noch verdammt heuchlerisch auftritt.mehr
Gestern berichtete zudem die Taz darüber, dass die CSU eine heftige Niederlage in einem Umfragestreit erlitten habe. Für eine halbe Million Euro fertigte die CSU von 2000 bis 2009 Umfragen an, in denen aber nicht nur die Sontnagsfrage gestellt wurde, sondern auch nach möglichen CSU-Strategien geforscht wurde. Ein Verwaltungsgericht hat dieses Verhalten nun als nicht verfassungsmäßig gerügt, denn die Opposition hatte um Herausgabe der Umfragen gebeten und die Informationen nicht erhalten. Damit wurde das Informationsrecht der Opposition verletzt.
Die CSU ist also eine selbstverliebte, populistische Partei. Das konnte man sich auch vorher schon denken. Aber ein aktuelles Papier der Christsozialen zeigt, dass die Partei zudem noch verdammt heuchlerisch auftritt.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Young Elder Statesman
In der schon wieder fast eine Woche alten, aktuellen “Zeit” fand man diesmal ein interessantes Interview mit Ole von Beust. Zur Erinnerung: Ole von Beust kündigte im letzten Jahre zwei Tage vor einem Volksentscheid über die Schulreform der schwarz-grünen Koalition an, am Tag des Volksentscheids von seinem Amt zurückzutreten. Und zwar unabhängig vom Ergebnis! Bis heute finde ich es beeindruckend, wie kalt da ein Politiker seinen Koalitionspartner ausgespielt hat. Denn natürlich ging der Volksentscheid, der das vor allem grüne Projekt einer sechsjährigen Grundschule kippte, für die Regierung schief. Die Gründe für Beusts Rücktritt lagen auf der Hand, er war amtsmüde.
Die “Zeit” hat ihn jetzt interviewt und zeigt, wie schnell Politiker “Elder Statesman”-Töne von sich lassen können, wenn die Medien sie denn lassen.
Die “Zeit” hat ihn jetzt interviewt und zeigt, wie schnell Politiker “Elder Statesman”-Töne von sich lassen können, wenn die Medien sie denn lassen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Young Elder Statesman
In der schon wieder fast eine Woche alten, aktuellen “Zeit” fand man diesmal ein interessantes Interview mit Ole von Beust. Zur Erinnerung: Ole von Beust kündigte im letzten Jahre zwei Tage vor einem Volksentscheid über die Schulreform der schwarz-grünen Koalition an, am Tag des Volksentscheids von seinem Amt zurückzutreten. Und zwar unabhängig vom Ergebnis! Bis heute finde ich es beeindruckend, wie kalt da ein Politiker seinen Koalitionspartner ausgespielt hat. Denn natürlich ging der Volksentscheid, der das vor allem grüne Projekt einer sechsjährigen Grundschule kippte, für die Regierung schief. Die Gründe für Beusts Rücktritt lagen auf der Hand, er war amtsmüde.
Die “Zeit” hat ihn jetzt interviewt und zeigt, wie schnell Politiker “Elder Statesman”-Töne von sich lassen können, wenn die Medien sie den lassen.
Die “Zeit” hat ihn jetzt interviewt und zeigt, wie schnell Politiker “Elder Statesman”-Töne von sich lassen können, wenn die Medien sie den lassen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Abwärtstrends
Die Bundestagswahl 2009 ist mittlerweile eindreiviertel Jahre her und die seitdem regierende schwarz-gelbe Koalition hat noch immer keine eigene Linie gefunden. Jetzt fängt aber das bedrohlichste für die CDU an: Diskussion.
Spötter bezeichnen die Union ja gerne als “Kanzlerwahlverein”. Die Partei wähle nun einmal Kader auf den Parteitagen und sorge sonst dafür, dass Kanzler, Ministerpräsidenten und Bürgermeister gewählt würden. Von inhaltlichen Auseinandersetzungen sei in der Regel keine Spur. Und tatsächlich ist es inhaltlich in der Union meist ganz leise.mehr
Spötter bezeichnen die Union ja gerne als “Kanzlerwahlverein”. Die Partei wähle nun einmal Kader auf den Parteitagen und sorge sonst dafür, dass Kanzler, Ministerpräsidenten und Bürgermeister gewählt würden. Von inhaltlichen Auseinandersetzungen sei in der Regel keine Spur. Und tatsächlich ist es inhaltlich in der Union meist ganz leise.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Herz auch bei Merkel und den Taliban
Die Bindung der Kirchen nimmt ab, ihre Mitteilungen auch. Vor etwas mehr als einem Jahr sorgte Margot Käßmann durch ihre Popularität für eine kurze Zeit dafür, dass die Ansichten “der” evangelischen Kirche etwas mehr Aufmerksamkeit erhielten. Ihr Nachfolger – weitaus unbekannter – dringt nur selten durch, erhält – wenn er sich äußert – eine eher unbedeutende Spalte. Auch die Kirche ist also abhängig von ihren “Promis”.
Alle zwei Jahre scheint das anders: Sogar die TAZ macht zum Kirchentag eine farbige Extra-Ausgabe, die sich ausschließlich zu der evangelischen Kirche und deren Position zu der real existierenden Welt beschäftigt.mehr
Alle zwei Jahre scheint das anders: Sogar die TAZ macht zum Kirchentag eine farbige Extra-Ausgabe, die sich ausschließlich zu der evangelischen Kirche und deren Position zu der real existierenden Welt beschäftigt.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Therapie ohne Krankheit
Vor kurzem verwunderte mal wieder ein interessanter, deutscher Verband. Mehrere Zeitungen berichtete, dass der “Bund Katholischer Ärzte” Therapiemöglichkeiten für Homosexuelle anbietet. Die Berichte waren, glücklicherweise, meist negativ geprägt. Die Homepage des Verbandes spricht zwar davon, dass man Homosexualität nicht als Krankheit sehe, Therapieangebote seien dennoch möglich. Begründet wird das damit, dass einige “Betroffene” gesellschaftliche Probleme hätten. Tja, wer sich nicht akzeptiert fühlt, sollte von seinem Verhalten abweichen. Das ist doch selbstverständlich. Ein Katholik würde in einer islamischen Gesellschaft ja auch sofort konvertieren.mehr>
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
City Soushi (South Park)
Butters ist wohl der kindlichste und unschuldigste Junge aus der "South Park"-Klasse. Im Gegensatz zu den vier Hauptfiguren der Serien spielt er regelmäßig Kinderspiele wie "Cowboy und Indianer", "Postmann" und "Detektiv". In dieser Folge bringt ihn das in ernste Schwierigkeiten, denn seine Eltern denken, er besitze multiple Persönlichkeiten.
Diese Grundidee macht die Folge zu einem unterhaltsamen Spaß. Butters Eltern waren nie besonders gut. Sobald es ein Anzeichen eines Problems gab, schickten sie ihn auf sein Zimmer und vergaben drakonisch langen Hausarrest. Diesmal vermuten sie hinter seinen Spielen eine Art Schizophrenie und bringen Butters zum Doktor. Als der feststellt, dass Butters tatsächlich "krank" ist, reagiert der Vater wie immer: "Should we ground him?" Die Antwort des Doktors, die im Trailer zu betrachten ist, spielt auf einen weiteren Fetisch unserer Gesellschaft an: Es gibt nicht nur für jedes Verhalten eine medizinische Erklärung, sondern auch "tender, loving medication - heavy medication".
Mit dieser Episode verfolgt "South Park" wieder das erfolgreiche Konzept, dass die "Mehrheitsgesellschaft", in diesem Fall Eltern, Mediziner und Polizei, völlig normales verhalten als unnormal einschätzen. Denn natürlich ist es selbstverständlich, dass Kinder Busfahrer oder Indianer spielen. Für die durchregulierte Erwachsenenwelt gleicht das jedoch einer Abweichung von der Norm. Dabei bleibt das Opfer ohne Stimme zurück. Denn Butters braucht erst einmal eine Weile, bis er begreift, was überhaupt vor sich geht. Zunächst hält er das Abfragen seiner vielen Fantasiefiguren für ein amüsantes Spiel.
Die Handlung dreht erst, als sich herausstellt, dass der Butters betreuende Doktor und wirklich heftigen multiplen Persönlichkeiten leidet. Wieder einmal ist der wahre Kranke also der Arzt. Dabei wird natürlich kein Klischee ausgelassen. Der Arzt vergeht sich an Butters, spannt ihn für seine eigenen Zwecke ein und leugnet konsequent seine eigene Schwäche. Butters ist ihm jedoch über weite Strecken hilflos ausgeliefert.
Verwoben wird das Ganze mit dem recht amüsanten Streit zwischen einem chinesischen Wok-Restaurant-Besitzer und einem japanischen Sushi-Restaurant-Besitzer. Während der Japaner einfach nur seinen Geschäften nachgeht, ist der Chinese über die Anwesenheit des Konkurrenten regelrecht hysterisch. Er hat eine Abneigung gegen die suizidgefährdeten, mörderischen "Japanese Dogs" und prügelt sich regelmäßig mit seinem Konkurrenten. Aber vor allem stört ihn, dass die Amerikaner Japaner und Chinesen kaum auseinander halten können. Es wird einfach von "Asiaten" gesprochen, die kulturellen Eigenheiten werden unter den Tisch gekehrt. Dieser Handlungsstrang ist nicht nur witzig, sondern auch etwas nachdenklich. Schließlich spricht man durchaus vom "Asiaten", "Afrikaner" oder "Araber" ohne daran zu denken, dass sich hinter diesen Begriffen mehrere Kulturen verstecken können.
Leider, und das ist die einzige Schwäche der Episode, laufen die beiden Handlungsstränge nicht parallel, sondern werden zum Schluss miteinander verwoben. Diese Lösung ist weder logisch, noch abgdreht-komisch, sondern einfach unpassend konstruiert. So werfen die letzten Minuten einen Schatten auf die sonst sehr gelungene Kritik am Medikamenten- und Krankheitswahn westlicher Gesellschaft sowie der Arroganz mit der kindlicher Fantasie begegnet wird.
Die ganze Episode ist wie immer auf South Park.de auf Englisch in voller Länge, völlig legal anzusehen.
Diese Grundidee macht die Folge zu einem unterhaltsamen Spaß. Butters Eltern waren nie besonders gut. Sobald es ein Anzeichen eines Problems gab, schickten sie ihn auf sein Zimmer und vergaben drakonisch langen Hausarrest. Diesmal vermuten sie hinter seinen Spielen eine Art Schizophrenie und bringen Butters zum Doktor. Als der feststellt, dass Butters tatsächlich "krank" ist, reagiert der Vater wie immer: "Should we ground him?" Die Antwort des Doktors, die im Trailer zu betrachten ist, spielt auf einen weiteren Fetisch unserer Gesellschaft an: Es gibt nicht nur für jedes Verhalten eine medizinische Erklärung, sondern auch "tender, loving medication - heavy medication".
Mit dieser Episode verfolgt "South Park" wieder das erfolgreiche Konzept, dass die "Mehrheitsgesellschaft", in diesem Fall Eltern, Mediziner und Polizei, völlig normales verhalten als unnormal einschätzen. Denn natürlich ist es selbstverständlich, dass Kinder Busfahrer oder Indianer spielen. Für die durchregulierte Erwachsenenwelt gleicht das jedoch einer Abweichung von der Norm. Dabei bleibt das Opfer ohne Stimme zurück. Denn Butters braucht erst einmal eine Weile, bis er begreift, was überhaupt vor sich geht. Zunächst hält er das Abfragen seiner vielen Fantasiefiguren für ein amüsantes Spiel.
Die Handlung dreht erst, als sich herausstellt, dass der Butters betreuende Doktor und wirklich heftigen multiplen Persönlichkeiten leidet. Wieder einmal ist der wahre Kranke also der Arzt. Dabei wird natürlich kein Klischee ausgelassen. Der Arzt vergeht sich an Butters, spannt ihn für seine eigenen Zwecke ein und leugnet konsequent seine eigene Schwäche. Butters ist ihm jedoch über weite Strecken hilflos ausgeliefert.
Verwoben wird das Ganze mit dem recht amüsanten Streit zwischen einem chinesischen Wok-Restaurant-Besitzer und einem japanischen Sushi-Restaurant-Besitzer. Während der Japaner einfach nur seinen Geschäften nachgeht, ist der Chinese über die Anwesenheit des Konkurrenten regelrecht hysterisch. Er hat eine Abneigung gegen die suizidgefährdeten, mörderischen "Japanese Dogs" und prügelt sich regelmäßig mit seinem Konkurrenten. Aber vor allem stört ihn, dass die Amerikaner Japaner und Chinesen kaum auseinander halten können. Es wird einfach von "Asiaten" gesprochen, die kulturellen Eigenheiten werden unter den Tisch gekehrt. Dieser Handlungsstrang ist nicht nur witzig, sondern auch etwas nachdenklich. Schließlich spricht man durchaus vom "Asiaten", "Afrikaner" oder "Araber" ohne daran zu denken, dass sich hinter diesen Begriffen mehrere Kulturen verstecken können.
Leider, und das ist die einzige Schwäche der Episode, laufen die beiden Handlungsstränge nicht parallel, sondern werden zum Schluss miteinander verwoben. Diese Lösung ist weder logisch, noch abgdreht-komisch, sondern einfach unpassend konstruiert. So werfen die letzten Minuten einen Schatten auf die sonst sehr gelungene Kritik am Medikamenten- und Krankheitswahn westlicher Gesellschaft sowie der Arroganz mit der kindlicher Fantasie begegnet wird.
Die ganze Episode ist wie immer auf South Park.de auf Englisch in voller Länge, völlig legal anzusehen.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
(Kurz)Gelesen: Projekt: Ende (von Philiip K. Dick)
m-dis | 02. Juni 11 | Topic '(Kurz)Gelesen'
 In einer Mietswohnung beobachtet eine Gruppe von Kindern Edward Billings durch Schlüsselloch. Der alte Mann arbeitet permanent an einer Art Bericht. Die Kinder fürchten zunächst, dass er ein kommunistischer Spion ist, sind dann jedoch der Ansicht, dass ihm dazu einfach der Bart fehle. Tommy ist ganz besonders mutig, er kehrt später zurück, um bei Billings einzubrechen. Der Bericht ist eine detaillierte Übersicht aller menschlicher Aktivitäten auf der Erde. Auf Billings Terasse findet Tommy dann jedoch eine Sensation: Billings hat dort kleine, menschenähnliche Lebewesen. Als Tommy sie sich genauer betrachtet, tritt Billings dazu. Er eröffnet Tommy, dass es sich bei den kleinen Lebewesen um Projekt C handelt. Nachdem Projekt A (Flugkreaturen) und Projekt B (die Menschen) gescheitert sind, musste ein neues Projekt her. Wichtig ist dabei nur, dass das dritte Projekt nicht wie das zweite von dem vorherigen Projekt korrumpiert wird. Das interessiert Tommy aber herzlich wenig, er sieht in den kleinen Männchen Spielfiguren, die er haben muss. Daher stiehlt er den Kasten kurzerhand...
In einer Mietswohnung beobachtet eine Gruppe von Kindern Edward Billings durch Schlüsselloch. Der alte Mann arbeitet permanent an einer Art Bericht. Die Kinder fürchten zunächst, dass er ein kommunistischer Spion ist, sind dann jedoch der Ansicht, dass ihm dazu einfach der Bart fehle. Tommy ist ganz besonders mutig, er kehrt später zurück, um bei Billings einzubrechen. Der Bericht ist eine detaillierte Übersicht aller menschlicher Aktivitäten auf der Erde. Auf Billings Terasse findet Tommy dann jedoch eine Sensation: Billings hat dort kleine, menschenähnliche Lebewesen. Als Tommy sie sich genauer betrachtet, tritt Billings dazu. Er eröffnet Tommy, dass es sich bei den kleinen Lebewesen um Projekt C handelt. Nachdem Projekt A (Flugkreaturen) und Projekt B (die Menschen) gescheitert sind, musste ein neues Projekt her. Wichtig ist dabei nur, dass das dritte Projekt nicht wie das zweite von dem vorherigen Projekt korrumpiert wird. Das interessiert Tommy aber herzlich wenig, er sieht in den kleinen Männchen Spielfiguren, die er haben muss. Daher stiehlt er den Kasten kurzerhand...Die Menschheit als Projekt von Außerirdischen, das außer Kontrolle geraten ist.Dicks Fantasie rüttelt auf wenigen Seiten an manchem Weltbild. Es ist zwar unvorstellbar, dass es vor den Menschen eine fliegende Spezie auf der Erde gab, doch die Außerirdischen hätten ja leicht alle Spuren beseitigen können. Interessant ist hierbei vor allem das Verhalten von Tommy. Billings eröffnet ihm recht direkt, dass die Zeit der Menschheit abgelaufen ist. Das Projekt B ist gescheitert, die Menschen bekriegen sich zu sehr. Das ist Tommy aber völlig egal, ihm geht es nur um den Besitz der kleinen Lebewesen.
Er rettet die Menschheit also damit, dass er aus reiner Gier handelt. Denn sein "Spiel" mit dem Projekt C korrumpiert dieses natürlich. Tommy beginnt, den kleinen Lebewesen Kleidung zu basteln. Außerdem zeigt er ihnen gewisse soziale Konventionen, die eigentlich menschlich sind.
Es wird in der Geschichte nicht angesprochen, wie die Aktionen auf die Lebewesen wirken. Aber man kann sich gut vorstellen, dass Tommies Verhalten gottähnliche Eindrücke erschaft. Schließlich "gibt" er ihnen die Kleidung und andere Gegenstände. Wenn die Menschheit auf ähnlich Weise "korrumpiert" wurde, ist es das auch eine Erkärung, wie sich religiöse Mythen bilden konnten.
Der Film "Matrix" begeisterte 1999 viele mit der Idee, dass die Welt, in der wir Leben nicht die ist, die sie scheint. Zwar lebt die Menschheit in "Projekt: Ende" auf einem realen Planeten und nicht in einer Art Cyber-Space, dennoch gibt es gewisse Paralllelen. Denn das Schicksal der Menschheit ist relativ verplant. Eigentlich war das Projekt gesteuert geplant. Die Menschheit konnte sich zwar der fremden Kontrolle entziehen und autonom werden, zieht dabei aber die Zerstörung auf sich. Letztendlich ist die Menschheit also doch nicht unabängig, sondern gelenkt. Dieser auch nach beinahe 60 Jahren noch immer moderne Gedanke, macht die Kurzgeschichte zu einer vergnüglichen und dennoch etwas nachdenklichen Lektüre.
Etwas ärgerlich ist die Übersetzung des Titels. Wie man von "Project: Earth" auf "Projekt: Ende" kommt, ist für mich relativ unverständlich.
“Projekt: Ende”,30 Seiten, 1953, von Philip K. Dick, aus der Anthologie “Variante zwei”.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Besessen

 Der dritte Roman der Neuauflage von “Vampira” ist wieder deutlich besser als der Vorgänger. Lilith wird in einer Kirche gefangen gehalten, ein katholischer Priester versucht sich mit einem Exorzismus an ihr. Derweil muss der Polizist Warner feststellen, dass ihn immer mehr Parteien umbringen möchten. Irgendjemand will also verhindern, dass er dem Geheimnis der Vampir-Opfer auf die Spur kommt.
Der dritte Roman der Neuauflage von “Vampira” ist wieder deutlich besser als der Vorgänger. Lilith wird in einer Kirche gefangen gehalten, ein katholischer Priester versucht sich mit einem Exorzismus an ihr. Derweil muss der Polizist Warner feststellen, dass ihn immer mehr Parteien umbringen möchten. Irgendjemand will also verhindern, dass er dem Geheimnis der Vampir-Opfer auf die Spur kommt.Nach dem etwas müden “Moloch” ist “Besessen” wieder ein spannendes und unterhaltendes Heft, das zudem einige Weichenstellungen für die weitere Handlung bereitstellen dürfte.
Die ganze Rezension findet man auf SF-Radio:
Vampira Band 3 – Besessen (von Adrian Doyle)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Tachyonen Exil

 Der Zyklus startete damit, dass Dana Frost die relative Unsterblichkeit gegeben wurde. Doch gab es immer Zweifel, ob Dana wirklich ein ungewöhnlich langes Leben beschieden ist oder ob die Behandlung durch Naniten irgendwelche Nebenwirkungen mit sich bringt.
Der Zyklus startete damit, dass Dana Frost die relative Unsterblichkeit gegeben wurde. Doch gab es immer Zweifel, ob Dana wirklich ein ungewöhnlich langes Leben beschieden ist oder ob die Behandlung durch Naniten irgendwelche Nebenwirkungen mit sich bringt.Der aktuelle "Sternenfaust"-Roman fügt Dana Frosts bisherigem Leben hundert weitere hinzu. Denn auf einem Planeten, über dem sie abstürzt geht die Zeit langsamer als normal. Die paar Tage, die die Sternenfaust zur Rettung braucht, bedeutetn für sie 100 Jahre auf einem rückständigen Planeten.
Die Rezension zu dem Roman findet man auf SF-Radio:
Sterenenfaust Band 165 - Tachyonen Exil (von Simon Borner)
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
One Hit Wonder
m-dis | 30. Mai 11 | Topic 'Geschrieben'
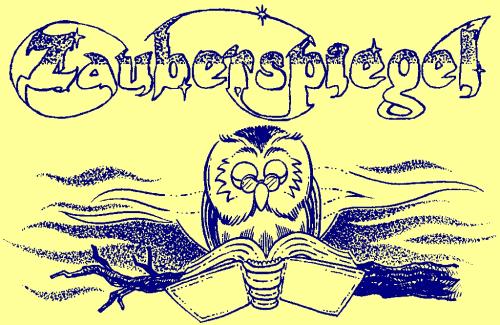
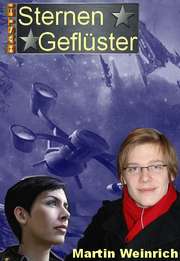 Manchmal macht es die Handlung der Serie “Sternenfaust” notwendig das Charaktere sterben. Das ist immer eine heikle Sache: Wählt man eine bekannte Person, riskiert man zukünftiges Potential zu verschenken. Außerdem ist es nicht immer einfach, einen bekannten Charakter “vorzuweisen”, schließlich muss man diesen ja erst einmal aufbauen. Wählt man jedoch eine bisher völlig unbekannte Person, riskiert man, dass deren Tod den Leser einfach kalt lässt. Schon wieder ein Marine/Jäger mit einem seelischen/Mobbing-Problem gestorben? Und?
Manchmal macht es die Handlung der Serie “Sternenfaust” notwendig das Charaktere sterben. Das ist immer eine heikle Sache: Wählt man eine bekannte Person, riskiert man zukünftiges Potential zu verschenken. Außerdem ist es nicht immer einfach, einen bekannten Charakter “vorzuweisen”, schließlich muss man diesen ja erst einmal aufbauen. Wählt man jedoch eine bisher völlig unbekannte Person, riskiert man, dass deren Tod den Leser einfach kalt lässt. Schon wieder ein Marine/Jäger mit einem seelischen/Mobbing-Problem gestorben? Und?Die Kolumne im Zauberspiegel stellt die Probleme des “Töten” in Heftromanserien dar. Denn letztendlich kann man Betroffenheit ja auch durch andere Mittel erreichen.
One Hit Wonder – Die Schwierigkeit, es beim “Töten” allen recht zu machen
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Gelesen: Rote Ernte (von Dashiell Hammett)
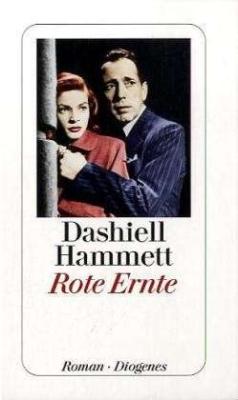 "Rote Ernte" wurde 1929 veröffentlicht. Ich wurde auf den Roman aufmerksam, weil Jakob Ajourni, von dem ich vor kurzem einen Roman gelesen habe, den Krimi pries. "Rote Ernte" war wohl ein kleiner Meilenstein und wurde von der "TIME" sogar in die Liste der besten englischsprachigen Romane von 1923 bis 2005 aufgenommen.
"Rote Ernte" wurde 1929 veröffentlicht. Ich wurde auf den Roman aufmerksam, weil Jakob Ajourni, von dem ich vor kurzem einen Roman gelesen habe, den Krimi pries. "Rote Ernte" war wohl ein kleiner Meilenstein und wurde von der "TIME" sogar in die Liste der besten englischsprachigen Romane von 1923 bis 2005 aufgenommen.Der Roman handelt von einem namenlosen Detektiv einer privaten Agentur in San Francisco, der den Mord an dem Sohn eines Großindustriellen in der Mienenstadt Peaceville aufklären soll. Der Detektiv, dessen Erlebnisse dem Leser durch die Ich-Perspektive näher gebracht werden, merkt schnell, dass der Spitzname "Pissville" absolut angebracht ist. Seit einem Streik, für den sein Auftraggeber Streikbrecher brauchte, wird die Stadt von Banden und korrupten Polizisten beherrscht. Obwohl der Detektiv den Mord, für den er eigentlich angeheurt ist, blitzschnell löst, bleibt er länger. Durch einen Trick luckst er seinem Auftraggeber den Auftrag ab, in "Pissville" aufzuräumen. Das tut er mit einer nicht ganz moralisch korrekten Methode: Er sorgt dafür, dass die vielen Machtpositionen in Peaceville sich gegenseitig ausschalten.
Zunächst wirkt der Roman überraschend schlicht und stereotyp. Der Ton der Geschichte ist so typisch Gangster-Roman haft, dass es fast schon witzig ist. Aber das wirkt halt aus heutiger Perspektive so, wo man die Sprache aus dem Off von schlechten Gangsterfilmen kennt. Zum Veröffentlichungszeitraum war der Ton vermutlich erfrischend.
Die Hauptfigur kann man nicht als Charakter bezeichnen. Sie ist intelligent, trickreich und hat einen perfekten Instinkt. Ständig überrascht sich nicht nur den Leser, sondern auch ein wenig sich selbst mit dem Überführen verschiedener Übeltäter. Mehr kann man über die Person allerdings nicht sagen. Die Motive, die Herkunft und die eigene Gefühlswelt bleiben dem Leser verschlossen. Durch die vielen Geistesblitze bleiben die Überführungsgedanken ebenfalls verschlossen. Stattdessen erlebt man einen selbstsicheren Detektiv, der vor nichts Angst hat und sich in jede gefährliche Situation ohne zu zögern stürzt. Es wirkt in diesem Zusammenhang beinahe komisch, dass die Hauptfigur zum Schluss doch noch etwas Angst entwickelt: Nämlich vor dem Chef, der Detektiv-Agentur, der mit den angewandte Methoden nicht zufrieden sein könnte.
Die Methoden führen neben etwas Angst auch zu der einzigen Gefühlsregung des Protagonisten. Sein Plan geht besser auf, als er es sich erhofft hat. Im Laufe des Romans bringen sich vier Gangstergruppen und die Polizeiführung gegenseitig um, ohne dass der Detektiv auch nur ein einziges Mal selbst eingreifen müsste. Gegenüber einer Gespielin (oder auch: einer besseren Nutte) eines Verbrecherkönigs gibt er kurz vor Schluss zu, dass ihn die angewandten Mittel beschäftigen, dass ihm zu viel Blut vergossen wurde. Da sie kurz darauf ebenfalls das Zeitige segnet, kann darauf nicht weiter eingegangen werden. Immerhin zeigt sich dadurch aber, dass auch dem Protagonisten die moralische Fragwürdigkeit seiner Methoden klar ist.
Die Handlung wirkt dann auch nur auf den ersten Eindruck und durch die Sprache etwas plump. Denn auch wenn die Verbrecherlandschaft von Peaceville zunächst sehr eindeutig wirkt, kommen immer wieder neue Dinge zutage. Mal wird ein früherer Verbrecher aus dem Knast entlassen und stellt sich als neue Macht heraus, mal formt sich eine neue Allianz zwischen zwei Verbrecherführern. Der Detetktiv ahnt durch seinen Instinkt das meiste schon im Vorraus, der Leser bekommt es dann erst ein Stück später mit. Zumal einem bei den vielen Spitznamen von "Flüster-Max" bis "Pete der Finne" auch etwas schwindelig wird.
Der Roman verschenkt an zwei Stellen allerdings etwas Komplexitätspotential. Die kriminellen Machenschaften des Auftraggebers sowie die Umtriebe eines radikalen Gewerkschaftsführers werden zu Beginn erwähnt, aber im Verlauf des Romans nicht ausgebaut. Daraus hätte man noch etwas machen können.
Ansonsten entfaltet der Roman mit schlichter Sprache und einem Ich-Erzähler, dessen Persönlichkeit im Hintergrund steht, eine fesselnde Dynamik, die nicht die hektische, auf Widerlichkeiten ausgerichtete Spannung heutiger "Thriller" entwickelt, sondern Spannung erzeugt, die durch die Aufdeckung immer tiefergehdner Korruptionsabgründe und der überraschenden Aktionen der Hauptfigur basiert.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Auf dem Weg zur Bild
Händler im Ehec Stress: “Ich werde wie ein Mörder behandelt, weil ich Gurken verkaufe”.So macht “Spiegel Online” zur Zeit Überschriften.
Erinnert sich noch jemand an das “Bild – Die Brandstifter”-Titelbild des Spiegels? Damals beschäftigte man sich in der Prinzausgabe im typisch ausführlichen Spiegelstil mit der Niveaulosigkeit der “Bild”-Zeitung. Unglücklicherweise fragt man sich immer mehr, ob das denn überhaupt berechtigt ist.
Erinnert sich noch jemand an das “Bild – Die Brandstifter”-Titelbild des Spiegels? Damals beschäftigte man sich in der Prinzausgabe im typisch ausführlichen Spiegelstil mit der Niveaulosigkeit der “Bild”-Zeitung. Unglücklicherweise fragt man sich immer mehr, ob das denn überhaupt berechtigt ist.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Crack Baby Athletic Association (South Park)
Im Fernsehen läuft immer wieder eine Werbung, die um freiwillige für die Fürsorge von "Crack Babies" wirbt. Das sind Babies, die mit einer Crack-Sucht geboren wurden, weil ihre Eltern dasselbe während der Schwangerschaft zu sich genommen haben. Nach der Geburt werden die Neugeborenen meist von ihren Eltern verstoßen und landen alleine im Krankenhaus. Kyle hält die Werbung nicht mehr aus und möchte sich für die Babies engagieren. Doch im Krankenhaus trifft er auf Cartman. Der möchte den Babies ebenfalls "helfen", in dem er ihnen mehr Aufmerksamkeit verschafft. Daher macht er Videos von den Babies, wie sie sich um Crack prügeln und stellt sie bei YouTube online. Sein Prinzip hat einen durchschlagenden Erfolg. Aber Cartman will natürlich noch mehr Profit aus den Babies rausschlagen, doch dafür braucht er einen "skruppellosen, geldgierigen Juden": In seinen Augen kann das nur Kyle sein...
"Crack Baby Athletic Association" überschreitet die Grenze zum guten Geschmack mal wieder mehrmals. Die Idee der Crack Babies ist abartig, Cartmans Skruppellosigkeit mal wieder nicht zu überbieten. Daher ist die Episode auch selten "lachhaft" komisch.
Andererseits spielt die Folge auf viele Missstände an. Cartman macht aus den Babies eine "Crack Baby Athletic Association", um daraus ein "EA-Games"-Spiel zu machen und viel Profi zu schlagen. Er will den Kindern jedoch nichts zahlen. Daher orientiert er sich an dem amerikanischen Universitätssport. Bei dem machen die Unis auch viel Geld mit ihren Athleten, zahlen ihnen aber ebenfalls nichts. Das liegt daran, dass sie eine Regel haben, dass die Studenten kein Geld erhalten dürfen, weil nur der Sport zählen sollte. Also übernimmt Cartman dieses ausbeutende Prinzip einfach. Die Szene, in der er Universitätspräsidenten befragt, wie sie mit "ihren Sklaven" umgehen, ist dann auch die witzigste.
Der beste Spruch kommt allerdings in einer anderen Szene. Cartman versucht einer werdenden, cracksüchtigen Mutter ein Kind "abzukaufen". Als sie erfährt, dass das Kind nicht erhält, findet sie das etwas unfair ist. Cartman dazu: "I don't make the rules ma'am. I'm just the one who thinks them up and writes them down." - und er bekommt was er will.
Außerdem spielt die Episode auf die Dekadenz an, die einige Hilfsorganisationen befällt, wenn sie erst einmal Erfolg haben. Die Zahl der Spendenskandale, die aufgedeckt werden, deutet das ja auch in der Realität an. "South Park" übertreibt das natürlich maßlos und lässt Cartman von dem eingeworbenen Geld einen Whirlpoll bauen, der mit Kentucky Fried Chicken-Chicken Wing-Soße befüllt ist und um den lauter McDonalds Pommes liegen. Ein Traum für Cartman, keine Hilfe für die Babies.
Hinzu kommt noch eine Nebengeschichte, in der der Gitarrist einer Band, als eine Art Santa Clause verklärt wird.
So nachdenklich die Episode mit ihren Anleihen an erfolgreiche, egoistische Start-Ups und an die kurzfristige Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Probleme auch ist, wirklich witzig ist sie - wie bereits erwähnt - nicht. Zwar langweilt die Episode nicht, aber meistens sitzt man eher ungläubig v0r dem Bildschirm als lachend. "Crack Baby Atheltic Association" regt also eher zum Nachdenken an, als dass es zusätzlich noch amüsiert.
Die gesamte Episode kann man sie wie immer auf der deutschen South-Park-Seite auf Deutsch angucken.
"Crack Baby Athletic Association" überschreitet die Grenze zum guten Geschmack mal wieder mehrmals. Die Idee der Crack Babies ist abartig, Cartmans Skruppellosigkeit mal wieder nicht zu überbieten. Daher ist die Episode auch selten "lachhaft" komisch.
Andererseits spielt die Folge auf viele Missstände an. Cartman macht aus den Babies eine "Crack Baby Athletic Association", um daraus ein "EA-Games"-Spiel zu machen und viel Profi zu schlagen. Er will den Kindern jedoch nichts zahlen. Daher orientiert er sich an dem amerikanischen Universitätssport. Bei dem machen die Unis auch viel Geld mit ihren Athleten, zahlen ihnen aber ebenfalls nichts. Das liegt daran, dass sie eine Regel haben, dass die Studenten kein Geld erhalten dürfen, weil nur der Sport zählen sollte. Also übernimmt Cartman dieses ausbeutende Prinzip einfach. Die Szene, in der er Universitätspräsidenten befragt, wie sie mit "ihren Sklaven" umgehen, ist dann auch die witzigste.
Der beste Spruch kommt allerdings in einer anderen Szene. Cartman versucht einer werdenden, cracksüchtigen Mutter ein Kind "abzukaufen". Als sie erfährt, dass das Kind nicht erhält, findet sie das etwas unfair ist. Cartman dazu: "I don't make the rules ma'am. I'm just the one who thinks them up and writes them down." - und er bekommt was er will.
Außerdem spielt die Episode auf die Dekadenz an, die einige Hilfsorganisationen befällt, wenn sie erst einmal Erfolg haben. Die Zahl der Spendenskandale, die aufgedeckt werden, deutet das ja auch in der Realität an. "South Park" übertreibt das natürlich maßlos und lässt Cartman von dem eingeworbenen Geld einen Whirlpoll bauen, der mit Kentucky Fried Chicken-Chicken Wing-Soße befüllt ist und um den lauter McDonalds Pommes liegen. Ein Traum für Cartman, keine Hilfe für die Babies.
Hinzu kommt noch eine Nebengeschichte, in der der Gitarrist einer Band, als eine Art Santa Clause verklärt wird.
So nachdenklich die Episode mit ihren Anleihen an erfolgreiche, egoistische Start-Ups und an die kurzfristige Aufmerksamkeit für gesellschaftliche Probleme auch ist, wirklich witzig ist sie - wie bereits erwähnt - nicht. Zwar langweilt die Episode nicht, aber meistens sitzt man eher ungläubig v0r dem Bildschirm als lachend. "Crack Baby Atheltic Association" regt also eher zum Nachdenken an, als dass es zusätzlich noch amüsiert.
Die gesamte Episode kann man sie wie immer auf der deutschen South-Park-Seite auf Deutsch angucken.
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
Funktionärsdämmerung? (I)
m-dis | 26. Mai 11 | Topic 'Geschrieben'
Die SPD hat zum ersten Mal seit einiger Weile gewichtige, nicht-negative Schlagzeilen. Der Grund dafür ist die Parteireform, die die Parteispitze anstoßen möchte. Während die Vorschläge teilweise als „nicht unoriginell“, ein Attribut, das in letzter Zeit eher selten mit der SPD verbunden wurde, bezeichnet wird, regt sich Widerstand in den Landesverbänden. Schade eigentlich.mehr
Permalink (0 Kommentare) Kommentieren
... ältere Einträge
